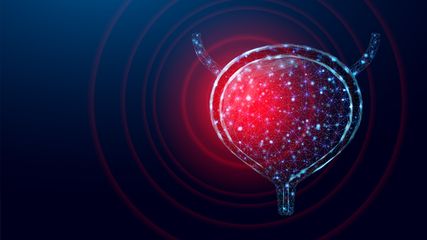Tagessymptomatik bei Kindern
Autor:innen:
Dr. Christa Gernhold
DGKP Marion Zauner
Prim. Priv.-Doz. Dr. Dr. Bernhard Haid, FEAPU FEBU
Abteilung für Kinderurologie
Ordensklinikum Barmherzige Schwestern Linz
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Harninkontinenz stellt sowohl für Kinder als auch für deren Familien eine erhebliche Belastung dar – sei es in Form einer isolierten nächtlichen Enuresis oder in Kombination mit Symptomen am Tag (nichtmonosymptomatische Enuresis, NMEN). Ein strukturiertes und therapeutisches Vorgehen ermöglicht meist eine zügige Abklärung und eine effektive Behandlung.
Keypoints
-
Differenzierte Diagnostik ist essenziell: MEN und NMEN unterscheiden sich deutlich in Ursache und Therapie – ohne gezielte Anamnese und Blasentagebuch drohen Fehlbehandlungen.
-
Alarmtherapie ist Goldstandard bei MEN: hohe Erfolgsraten bei gut informierten und motivierten Familien – jedoch nur bei strukturierter Anleitung.
-
NMEN-Therapie beginnt mit der Tagessymptomatik: Nur wenn die LUTS kontrolliert sind, sollte die nächtliche Enuresis gezielt behandelt werden – sonst besteht ein hohes Rückfallrisiko.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer monosymptomatischen (MEN) und einer nichtmonosymptomatischen Enuresis (NMEN). Nichtmonosymptomatische Enuresis nocturna ist ein nächtliches Einnässen, das von einer tagsüber gestörten Blasenfunktion begleitet wird. Das bedeutet, dass neben dem nächtlichen Einnässen auch andere Symptome wie häufiger Harndrang, unbeherrschbarer Harndrang oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen tagsüber auftreten. Die Einteilung von Harninkontinenz am Tag ist aufgrund der vielfältigen und teils überlappenden Symptome komplexer als die der nächtlichen Enuresis.
„Daytime lower urinary tract symptoms“
Der Begriff „daytime lower urinary tract symptoms“ (LUTS) umfasst verschiedene funktionelle Störungen der Blasenentleerung:
-
Gesteigerte Miktionsfrequenz: Bei Kindern spricht man von einer erhöhten Frequenz bei mehr als acht Miktionen pro Tag, eine erniedrigte Frequenz liegt bei unter drei Miktionen täglich vor.
-
Dranginkontinenz: Hierbei kommt es zu einem plötzlichen, starken Harndrang, oft verbunden mit einer kindlichen überaktiven Blase (OAB).
-
„Overactive bladder“ (OAB): Der Verdacht auf eine OAB besteht bei erhöhter Miktionsfrequenz, mit oder ohne Inkontinenz. Ein weiteres Leitsymptom ist die Drangsymptomatik. Harnwegsinfekte müssen ausgeschlossen werden.
-
Miktionsaufschub: Kinder halten den Urin absichtlich zurück – z.B. aus Unbehagen vor fremden oder schmutzigen Toiletten oder weil sie beim Spielen nicht unterbrochen werden wollen.
-
Dysfunktionales „voiding“: Dabei kommt es trotz eines neurologisch unauffälligen Befunds zu einer gleichzeitigen Kontraktion des Beckenbodens oder Schließmuskels während der Miktion. Bildgebend kann dies z.B. als „spinning top urethra“ im Rahmen des Miktionszystourethrografie (MCU) sichtbar sein.
-
Vaginaler Reflux: vor allem bei Mädchen, die kurz nach dem Wasserlassen an mäßiger Inkontinenz leiden, ohne nächtliche Inkontinenz oder andere Symptome. Ursache ist meist eine Miktion mit geschlossenen Beinen, die zu einem Rückfluss in die Vagina führt.
Enuresis nocturna
Nach der Definition der International Children’s Continence Society (ICCS) handelt es sich bei Enuresis nocturna um ein intermittierendes, unwillkürliches Einnässen während des Schlafs bei Kindern ab fünf Jahren.
Epidemiologie und Ätiologie
Etwa 10% der Siebenjährigen sind betroffen. Die Spontanremission liegt bei etwa 15% pro Jahr. Die familiäre Disposition ist hoch – bei beidseitiger elterlicher Betroffenheit liegt sie bei bis zu 77%.
Die Entstehung der Enuresis ist multifaktoriell bedingt. Es lassen sich drei Hauptursachen identifizieren:
-
Schwierige Erweckbarkeit: Eine unreife Steuerung des Nervensystems führt zu unzureichender Wahrnehmung des Harndrangs. Die Inkontinenz tritt meist aus dem Tiefschlaf heraus auf, selten während der REM-Phase.
-
Reduzierte funktionelle Blasenkapazität: Der Reifungsprozess der Blasen-Sphinkter-Koordination ist verzögert. Dadurch kann weniger Urin gespeichert werden, was das Risiko für Enuresis erhöht.
-
Nächtliche Polyurie: Ein erhöhter nächtlicher Urinoutput – oft bedingt durch niedrige Vasopressinspiegel – führt dazu, dass die Blase überfüllt wird.
Komorbiditäten
-
Obstipation: Die funktionelle Obstipation ist ein Hauptkofaktor der (N)MEN: Bei 80% der Kinder, bei denen erfolgreich abgeführt wird, sistiert auch die Harntraktsymptomatik (Inkontinenz/Drangsymptomatik). Zur Evaluierung können die Bristol Stool Scale sowie der sonografisch gemessene Rektumquerdurchmesser beitragen.
-
Atemwegsobstruktion: Enuresis wurde auch mit obstruktiven Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht, wobei eine deutliche Besserung der Symptome nach Atemwegsoperationen wie etwa Tonsillektomien beobachtet wurde.
-
Psychiatrische und neurologische Erkrankungen: Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit, Autismus-Spektrum-Störung oder Angststörungen haben ein deutlich höheres Risiko, unter einer Enuresis zu leiden. Diese Grunderkrankungen stehen auch mit einem deutlich eingeschränkten Therapieerfolg in Zusammenhang.
-
Adipositas: Übergewichtige Kinder leiden häufiger an Enuresis und sprechen schlechter auf die Behandlung an.
Diagnostik
Eine strukturierte Anamnese ist entscheidend. Erfragt werden sollten:
-
Häufigkeit und Zeitpunkt des Einnässens (erste oder zweite Nachthälfte)
-
familiäre Vorbelastung
-
Trink- und Miktionsverhalten
-
Tagsymptome (Drang, Haltemanöver)
-
Stuhlgewohnheiten
-
psychosoziale Belastungen
Ein 48-Stunden-Blasentagebuch mit Erhebung der nächtlichen Urinmenge ist ein zentraler Bestandteil:
-
Ermittlung von Trink- und Miktionsvolumina
-
Berechnung der maximalen erwarteten Blasenkapazität: EBC=(Alter+1)×30ml
-
Polyurie liegt vor, wenn die nächtliche Urinmenge ≥130% der EBC beträgt.
Die körperliche Untersuchung sollte das äußere Genitale und einen neurologischen Status (V.a.Spina bifida occulta) erfassen. Die Sonografie wird bei auffälliger Anamnese empfohlen, insbesondere jedoch bei Tagessymptomatik.
Therapieansätze (MEN & NMEN)
Allgemeine Maßnahmen
Die Basistherapie besteht aus:
-
Aufklärung und Enttabuisierung
-
Optimierung des Trinkverhaltens: tagsüber ausreichend trinken, abends einschränken; Verzicht auf kohlensäurehaltige und milchbasierte Getränke ab dem Nachmittag
-
regelmäßigen Toilettengängen (alle 2–3 Stunden, auch vor dem Schlafengehen)
-
optimaler Sitzposition bei der Miktion (z.B. mit Fußstützen)
-
Obstipationsbehandlung: Auf eine regelmäßige/tägliche Entleerung einer großen Portion geformten Stuhls sollte somit immer geachtet werden. Häufig ist eine längerfristige Therapie (mindestens 6–8 Wochen) mit einem osmotischen Laxans (Macrogol 4000 oder Optifibre) indiziert. Diätetische Maßnahmen sind bei Kindern oft schwierig in effizienter Art und Weise umsetzbar.
Alarmtherapie
Die Alarmtherapie hat – bei einer Anwendung von mindestens 8 Wochen – mit 50–70% eine hohe Erfolgsquote.
Die Funktionsweise der Alarmtherapie besteht in einem Training der Miktionshemmung durch Biofeedback: In dem Moment, in dem vor einer unbemerkten nächtlichen Miktion (bzw. sobald der Sensor mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt) Detrusorkontraktionen auftreten, erfolgen durch den Alarm die bewusste Wahrnehmung und die zentrale Hemmung. So kann der Mechanismus konditioniert werden, das Kind schläft durch und die Miktion wird unterdrückt. Folglich wird auch die funktionelle Blasenkapazität gesteigert.
Medikamentöse Therapie
Anticholinergika
Bei Kindern mit einer hohen Miktionsfrequenz (>7x/Tag), einem geringen Blasenvolumen (<65% der geschätzten Blasenkapazität) und Drangsymptomen kann eine Behandlung mit Anticholinergika die Blasenkapazität erhöhen und die Drangsymptomatik reduzieren. Die häufigsten Nebenwirkungen bei Kindern sind Verstopfung, die zu einer Verschlechterung der Enuresissymptomatik beiträgt, Mundtrockenheit (die zu Karies führen kann), trockene Augen und ZNS-Nebenwirkungen (Sehstörungen, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen). Alle Nebenwirkungen sind reversibel.
Obwohl Oxybutynin (z.B. Ditropan 5-mg-Tabletten, teilbar, 0,1–0,3mg/kg/Tag) das einzige Anticholinergikum ist, das für diese Indikation zugelassen ist, ist das Nebenwirkungsprofil bei Off-Label-Alternativen günstiger.
Propiverin (z.B. Mictonetten 5-mg-Filmtabletten, 0,8–1mg/kg/Tag) muss bewilligt werden und benötigt eine Indikation mit dem Vermerk UAW (unerwünschte Arzneimittelwirkung) unter Oxybutynin auf dem Rezept.
Trospiumchlorid (2–3 x 5 [–10]mg/Tag, bei Erwachsenen: bis 3x 15mg/Tag). Als Tipp für die Praxis kann es „off-label“ ab dem Schulalter (25kg) 7,5mg–0–7,5mg gegeben werden, da es als quartäres Ammoniumion den Vorteil hat, die Blut-Hirn- Schranke nicht zu durchdringen.
Auch andere Anticholininergika wie Mirabegron und Solifenacin weisen bei pädiatrischen Patienten eine hohe Wirksamkeit mit einer geringen Nebenwirkungsrate auf.
Desmopressin
Es wird primär bei MEN mit nächtlicher Polyurie eingesetzt. Desmopressin wird eine Stunde vor dem Schlafengehen eingenommen. Dabei sollte die Trinkmenge reduziert werden, um die seltene Nebenwirkung einer Hypervolämie und Hyponatriämie mit Ödembildung zu verhindern.
Literatur:
bei den Verfassern
Das könnte Sie auch interessieren:
Historische Momente aus Wiener urologischen Abteilungen
Der 51. Österreichische Urologenkongress in der Messe Wien vom 22. bis 25.5.2025, veranstaltet zusammen mit der bayrischen Schwestergesellschaft, fokussierte nicht nur wichtige ...
Zytoreduktive Nephrektomie im Jahr 2025 – ein evidenzfreier Raum?
Die zytoreduktive Nephrektomie (CN) ist heutzutage weiterhin ein fester Bestandteil der Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC). Doch ob und wann ein Patient einer CN ...
Blasenerhalt trotz BCG-Versagen bei High-Risk-Tumoren: intravesikale Strategien heute und morgen
Standard bei BCG-Versagen beim nichtmuskelinvasiven Blasenkarzinom ist die radikale Zystektomie. Alternativen mit Gemcitabin oder Mitomycin sind onkologisch unterlegen. Neue Ansätze wie ...