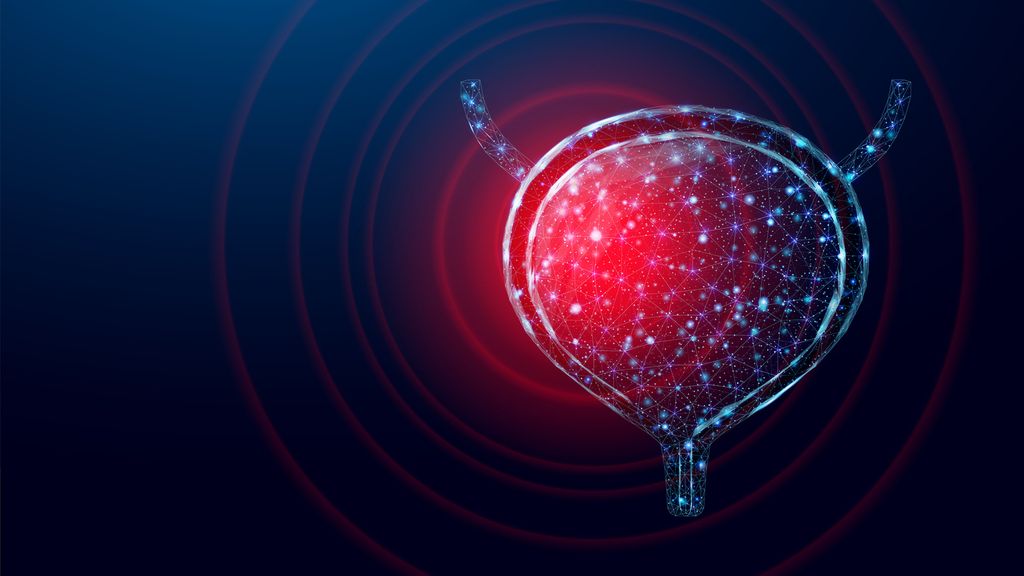
Blasenerhalt trotz BCG-Versagen bei High-Risk-Tumoren: intravesikale Strategien heute und morgen
Autor:innen:
Marie Semmler
Dr. Benedikt Ebner
Dr. Julian Hermans
PD Dr. Nikolaos Pyrgidis, MSc
PD Dr. Lennert Eismann
Prof. Dr. Gerald Schulz
Prof. Dr. Christian Stief
PD Dr. Yannic Volz
Urologische Klinik und Poliklinik, Klinikum der Universität München
Korrespondenz:
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Standard bei BCG-Versagen beim nichtmuskelinvasiven Blasenkarzinom ist die radikale Zystektomie. Alternativen mit Gemcitabin oder Mitomycin sind onkologisch unterlegen. Neue Ansätze wie TAR-Verfahren und Adenovirus-Gentherapie zeigen gutes Ansprechen und könnten die Zystektomie hinauszögern oder den Organerhalt ermöglichen.
Keypoints
-
Die radikale Zystektomie ist der Goldstandard bei BCG-Versagen. Viele Patienten wünschen sich jedoch einen blasenerhaltenden Ansatz.
-
Intravesikale Alternativen wie Gemcitabin, Mitomycin-Hyperthermie oder die sequenzielle Gemcitabin/Docetaxel-Therapie zeigen teils vielversprechende Ergebnisse, sind jedoch nicht onkologisch gleichwertig zur Zystektomie.
-
Innovative Therapien wie TAR-200 und TAR-210 (intravesikale Drug-Delivery-Systeme) und virusbasierte Gentherapien (Nadofaragene Firadenovec, Cretostimogene Grenadenorepvec) könnten künftig den Zystektomie-freien Zeitraum verlängern.
-
Immunonkologische und kombinatorische Ansätze (z.B. Pembrolizumab, Nagopendekin alfa inbakicept) bieten Perspektiven für bestimmte Patienten.
Das nichtmuskelinvasive Blasenkarzinom (NMIBC) ist die häufigste Form des Urothelkarzinoms. 2022 gab es in der EU 224777 Blasentumor-Neuerkrankungen, die altersstandardisierte Inzidenz für Blasentumoren in der EU betrug 12 pro 100000 Männern/Jahr und 2,4 pro 100000 Frauen/Jahr.1 Bei rund 75% der Patienten liegt bei Diagnosestellung eines Blasentumors ein NMIBC vor.2 Das NMIBC wird in 4 Risikogruppen eingeteilt. Für das nach WHO als „very high risk“ klassifizierte nichtmuskelinvasive Blasenkarzinom (HR-NMIBC) stellt BCG weiterhin den Therapiestandard dar. Auch für das als „intermediate risk“ klassifizierte NMIBC (IR-NMIBC) kann BCG eingesetzt werden. Das üblicherweise genutzte BCG-Schema besteht aus einer Induktionstherapie bestehend aus 6 wöchentlichen intravesikalen Applikationen, gefolgt von Erhaltungszyklen aus jeweils 3 wöchentlichen Applikationen nach 3, 6 und 12 Monaten, sowie bei HR-Tumoren, sofern verträglich, auch nach 18, 24, 30 und 36 Monaten.3 Trotz der hohen Effektivität von BCG versagt die Therapie bei rund 40% nach 5 Jahren.4 Auch die unter der BCG-Therapie auftretenden Nebenwirkungen, insbesondere in der für HR-NMIBC empfohlenen dreijährigen Erhaltungstherapie, und die damit oft verbundene vorzeitige Beendigung der BCG-Therapie tragen zu dieser Rezidivrate bei.4
BCG-Therapieversagen
Eine adäquate BCG-Exposition wird entsprechend der EAU-Guideline definiert als Therapie mit mindestens 5/6 Gaben der Induktionstherapie sowie zusätzlich 2/3 Therapiegaben der ersten Erhaltungstherapie bzw. mind. 2/6 Re-Induktionstherapie-Gaben.3 Anderenfalls kann eine erneute BCG-Therapie erwogen werden. Des Weiteren kann bei einem späten Rezidiv in Form eines pT1/pTaHG nach über 6 Monaten nach Abschluss der BCG-Therapie oder in Form eines pTis nach über 12 Monaten nach Abschluss der BCG-Therapie eine Re-Induktionstherapie erwogen werden.3
Zum aktuellen Zeitpunkt stellt die radikale Zystektomie im Falle eines Rezidivs eines HR-NMIBC unter bzw. nach adäquater BCG-Therapie weiterhin die Therapie der Wahl dar. Zu beachten ist, dass ein erneutes Auftreten eines Low-Grade-Blasenkarzinoms nicht als Rezidiv und somit BCG-Versagen zu werten ist. Da eine radikale Zystektomie mit einer relevanten Komplikationsrate und Morbidität sowie eingeschränkten Lebensqualität einhergehen kann, besteht vonseiten vieler Patienten der Wunsch nach einem blasenerhaltenden Vorgehen.5 Als Salvage-Strategie gibt es bereits einige blasenerhaltende Therapiemöglichkeiten, welche sich jedoch insgesamt bisher nicht als onkologisch äquivalent erwiesen haben.
Aktuelle intravesikale Therapiemöglichkeiten bei BCG-Versagen
Gemcitabin
Bei einem Rezidiv eines BCG-vorbehandelten Urothelkarzinoms kann die intravesikale Therapie mit Gemcitabin entsprechend der deutschen S3-Leitlinie im Rahmen eines „off-label use“ als Zweitlinientherapie erfolgen, sofern eine Zystektomie kontraindiziert ist oder die Patienten diese ablehnen.6 Hierzu liegen einige wenige prospektive Studien mit relativ geringen Fallzahlen vor: Beispielsweise wurden in der SWOG-S0353-Studie, einer Phase-II-Studie, von Skinner et al. 58 Patienten mit BCG-Rezidiv (89% davon mit HR-Erkrankung) einer Gemcitabin-Therapie zugeführt. Hierbei wurde eine Induktionstherapie (6x wöchentlich) und anschließend eine einjährige Erhaltungstherapie (monatlich) durchgeführt. Zum 3-Monats-Follow-up zeigte sich bei 47 Patienten ein krankheitsfreies Überleben bei 47%, nach 12 Monaten lag es bei 28% und nach 24 Monaten bei 21%.7 In einer multizentrischen prospektiven Phase-II-Studie wurden 80 HR-NMIBC-Patienten mit Rezidiv nach BCG in die Therapiegruppen BCG versus Gemcitabin (intravesikal) randomisiert. Hier konnten signifikante Vorteile für die Gemcitabin-Gruppe hinsichtlich des Auftretens eines Rezidivs (87,5% vs. 52,5%, p=0,002) sowie des rezidivfreien Überlebens nach 2 Jahren (19% vs. 3%, p<0,008) gezeigt werden.8
Mitomycin-Hyperthermie
Als weiteres Therapieverfahren kann die Behandlung mit Mitomycin C (MMC) unter mikrowelleninduzierter Hyperthermie als experimentelles Verfahren im Rahmen von Studien erwogen werden.6 Hierbei sollen durch die lokale Hyperthermie die Penetration und Wirksamkeit von Mitomycin C erhöht werden. Zur Erzeugung von Hyperthermie gibt es unterschiedliche Verfahren, z.B. die mikrowellen- bzw. radiofrequenzinduzierte Hyperthermie (RITE) und die Chemohyperthermie (CHT).
In der HYMN-Phase-III-Studie zeigte sich für Non-CIS-BCG-Versager kein signifikanter Vorteil des RITE-MMC-Verfahrens hinsichtlich der Rezidivrate (24-Monats-DFS RITE 53% vs. Kontrolle 24%; HR: 0,50; 95% CI: 0,22–1,17; p=0,11); für CIS-BCG-Versager war das krankheitsfreie Überleben mit RITE sogar signifikant kürzer (HR: 2,06; 95% CI: 1,17–3,62; p=0,01).9 In einer italienischen Kohortenstudie betrug das DFS bei BCG-Versagen in der HIVEC+ MMC-Kohorte im Mittel 22,61 Monate, sodass das Verfahren hier als mögliche überbrückende Alternative bei selektiven Patienten interpretiert wird.10
Sequenzielle intravesikale Instillationstherapie mit Gemcitabin/Docetaxel
Die sequenzielle intravesikale Instillationstherapie mit Gemcitabin und Docetaxel hat ihren Ursprung in der BCG-Knappheit. Aktuell kann die intravesikale sequenzielle Therapie in der EU und den USA nur als Off-Label-Therapie eingesetzt werden. Gerade in den USA ist sie aber insbesondere bei Nichtansprechen auf BCG bereits durchaus weit verbreitet, wie eine Umfrage der Society of Urologic Oncology (SUO) zeigte.11 Die intravesikale Therapie besteht meist aus einer 6-wöchigen Induktionstherapie mit wöchentlichen Instillationen, gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit monatlichen Instillationen über ein bzw. zwei Jahre.
Die bisherige Studienlage bei BCG-Therapieversagen scheint vielversprechend. Mehrere Studien konnten Raten von >65% für ein HG-krankheitsfreies Überleben nach 1 Jahr erzielen. Steinberg et al. konnten in einer multizentrischen retrospektiven Studie mit 276 Patienten mit BCG-Versagen HG-rezidivfreie Überlebensraten von 65% nach 1 Jahr und von 52% nach 2 Jahren aufzeigen. In einer retrospektiven Analyse der EuroGemDoce-Gruppe konnte in einer Kohorte von 95 Patienten mit High-Risk- oder Very-High-Risk-NMIBC, welche vorab eine BCG-Therapie erhalten haben, ein 1-Jahres-krankheitsfreies Überleben von 73% (95% CI: 62–86%), ein 1-Jahres-HG-krankheitsfreies Überleben von 79% (95% CI: 68–91%) und ein progressionsfreies Überleben von 95% (95% CI: 90–100%) erreicht werden.12
Fazit der aktuellen Therapien
Aufgrund der begrenzten Datenlage bzw. mangelnder Evidenz hinsichtlich einer möglichen Zweitlinientherapie nach BCG-Versagen stellt die radikale Zystektomie, insbesondere bei Vorliegen eines Frührezidivs, weiterhin die Therapie der Wahl dar.6 Bisher zeigten die blasenerhaltenden Therapien in dieser Konstellation, sofern ausreichend Evidenz vorliegt, ein der Frühzystektomie onkologisch unterlegenes Ergebnis. Daher haben diese Therapien nur eine schwache Empfehlung oder sind im Rahmen von Studien zu empfehlen.
Mögliche zukünftige intravesikale Therapieoptionen bei BCG-Versagen
Die Frage, ob intravesikale Therapien eine alternative Therapieoption zur radikalen Zystektomie bei Patienten mit BCG-Versagen oder BCG-Intoleranz bieten können, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Aufgrund der klinisch äußerst relevanten Thematik des BCG-Versagens wurden in den letzten Jahren zahlreiche neue Therapieansätze entwickelt. Für einige dieser Therapien erfolgte bereits die Zulassung durch die FDA oder die Zulassung bei der FDA wurde beantragt. In Europa sind die Therapieoptionen noch nicht zugelassen. Im Folgenden werden vielversprechende Studien auszugsweise erläutert.
Intravesikale Wirkstoff-Freisetzungssysteme
Mit dem Einzug der Wirkstoff-Freisetzungssysteme („drug delivery device“ oder „drug-releasing intravesical system“ [drug-RIS]) und im Verlauf der TAR-Therapien wurde erstmals die längerfristige Applikation von Wirkstoff in die Harnblase Realität.13 Bei dem TAR-System handelt es sich um ein Silikon-Device, welches sich nach Applikation über ein Kathetersystem in die Harnblase zu einem Brezel-förmigen Gebilde zusammenlegt und über Tage bis Wochen in der Harnblase verbleiben kann. Durch die kontinuierliche Abgabe des Wirkstoffs wird ein höherer lokaler Wirkstoffspiegel erzielt.14
TAR-200 (SunRISe-1&-5)
In der Phase-II-Studie SunRISe-1 (NCT04640623), wurde in den Kohorten 1–3 die TAR-200-Therapie (ein intravesikales Gemcitabin-Freisetzungssystem), die Therapie mit Cetrelimab sowie deren Kombination bei Patienten mit BCG-Versagen und HR-NMIBC-CIS (±papillärem Tumor) untersucht, welche keine Zystektomie erhielten.15
Auf dem Kongress der American Urological Association (AUA) 2025 wurden aktualisierte Daten der SunRISe-1-Studie präsentiert: Patienten der Kohorte 2 (TAR-200-Monotherapie) erreichten eine Gesamt-Komplettremissionsrate (overall CR) von 82,4% (95% CI: 72,6%–89,8%), die 1-Jahres-Komplettremissionsrate betrug 45,9%, die durchschnittliche Dauer des Therapieansprechens wurde mit 25,8 Monate (95% CI: 8,3 Monate – nicht evaluierbar) geschätzt.15 Insgesamt hat sich die TAR-200-Therapie als verträgliche Therapie herauskristallisiert, die sich hinsichtlich ihres Nebenwirkungsprofils vor allem durch dysurische Beschwerden auszeichnet.15
Aufgrund der erzielten Ergebnisse erhielt die Therapie durch die FDA den Status einer sogenannten „breakthrough therapy“ für Patienten mit BCG-Versagen und HR-NMIBC-Rezidiv, welche keiner Zystektomie zugeführt werden können oder diese ablehnen. Im Jänner 2025 wurde bei der FDA ein Zulassungsantrag für die Therapie bei BCG-unempfindlichem HR-NMIBC bei Vorliegen von CIS mit oder ohne papillären Tumor gestellt.
In der Phase-III-Studie SunRISe-5 (NCT06211764), wird die TAR-200-Monotherapie versus intravesikale Chemotherapie (nach Ermessen des Behandlers) bei Patienten mit papillärem HR-NMIBC-Rezidiv ohne CIS-Befund untersucht, welche nicht für eine Zystektomie geeignet sind oder diese ablehnen.14
TAR-210 (MoonRISe)
Die orale Therapie mit dem Tyrosinkinase-Inhibitor Erdafitinib konnte bereits im lokal fortgeschrittenen bzw. metastasierten Stadium relevante Ergebnisse erzielen und wurde daraufhin auch durch die EMA im metastasierten Stadium bei Vorliegen bestimmter FGFR3-Alterationen sowie nach vorausgegangener Therapie mit einem Immuncheckpoint-Inhibitor zugelassen.16
Insbesondere in den frühen Tumorstadien werden häufig FGFR-Mutationen gefunden: Beim Low-Risk-NMIBC stellen FGFR3-Mutationen eine der häufigsten Alterationen dar und kommen in bis zu 70% der Fälle vor.17,18 In fortgeschritteneren Stadien nehmen die Zahlen ab. Im muskelinvasiven Stadium (MIBC) wird nur noch in 15–20% der Fälle eine FGFR-Alteration beschrieben.19,20 Daher könnte die Therapie gerade beim NMIBC eine bedeutende zielgerichtete Therapieoption darstellen. Die orale Therapie mit Erdafitinib bei FGFR3/2-Mutation bei Rezidiv nach BCG beim HR-NMIBC wurde im Rahmen der THOR-2-Studie (NCT04172675) untersucht, hier konnte eine Verlängerung des rezidivfreien Überlebens (RFS) gezeigt werden.21
In der Phase-I-Studie (NCT05316155) wurde die TAR-210-Therapie, eine Therapie mittels intravesikalen Erdafitinib-Freisetzungssystems, im Rahmen der Kohorte 1 bei Patienten mit Rezidiv eines HR-NMIBC (pT1/pTaHG) nach BCG-Therapie untersucht. Auf der Konferenz der Europäischen Gesellschaft für medizinische Onkologie (ESMO) 2023 wurden Daten präsentiert, wonach in Kohorte 1 in 82% eine Rezidivfreiheit erreicht worden war.22
Nach der Phase-III-Studie MoonRISe-1 (NCT06319820), welche die TAR-210-Therapie bei IR-NMIBC untersucht, ist mit der MoonRISe-3-Studie eine Phase-III-Studie geplant, welche die TAR-210- Therapie bei BCG-vorbehandeltem papillärem HR-NMIBC als Zweitlinientherapie evaluiert.23,24
Adenovirus-basierte Therapien
Nadofaragene Firadenovec
Nadofaragene Firadenovec ist eine Adenovirus-basierte Gentherapie. Hierbei schleust ein replikationsdefektes Adenovirus das Gen für Interferon-α2b (IFN-α2b) in die Zellen ein und führt so zu einer höheren Transkription und Produktion von IFN-α2b.25 Die Wirkung erfolgt durch die direkte und indirekte immunmodulatorische Wirkung des IFNα2b-Proteins, welche das Tumorwachstum hemmt.26 Die Applikation der intravesikalen Therapie erfolgt alle 3 Monate.
In einer Phase-III-Studie (NCT02773849) mit 198 Patienten konnte bei Vorliegen eines CIS nach 3 Monaten eine Komplettremissionsrate von 53,4% erreicht werden, 24,3% der Patienten waren nach einem Jahr weiterhin frei von HG-Rezidiven.27 Bei Patienten mit High-Grade-Ta oder T1-Befund ohne CIS waren nach 3 Monaten 72,9% frei von HR-Rezidiven, nach 12 Monaten waren es 43,8%.27 Aufgrund der Datenlage wurde die Therapie mit Nadofaragene Firadenovec durch die FDA für Patienten mit NMIBC und BCG-Versagen zugelassen.
Im 5-Jahres-Langzeit-Follow-up zeigte sich ein zystektomiefreies Überleben von 49% (95% CI: 40,0–57,1%); in der CIS-Kohorte betrug es 43%, in der HG-Ta/T1- Kohorte 59%.28 Nur 5 Patienten (4 Patienten der CIS-Kohorte, 1 Patient der HG-pTa/T1-Kohorte) entwickelten einen Progress zu einem MIBC.28
Cretostimogene Grenadenorepvec (CG0070)
Cretostimogene Grenadenorepvec ist ebenfalls ein gentechnisch modifiziertes Adenovirus, das zur gezielten Lyse von Blasentumorzellen führt. Das onkolytische Virus repliziert sich nur in Zellen mit defektem RB/E2F-Pfad und trägt zusätzlich zur Stimulation der lokalen Immunantwort das Gen für GM-CSF (Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor).29 Das Instillationsschema ähnelt dem BCG-Schema: 6 wöchentliche Induktionsdosen gefolgt von 3 wöchentlichen Erhaltungstherapien zu den Monaten 3, 6, 9, 12 und 18.30
Auf Basis der Daten der Phase-II-Studie BOND2 (NCT02365818) und der Phase-III- Studie BOND-003 (NCT044552591) hat auch CG0070 von der FDA den „Breakthrough therapy“-Status erhalten.29 Die auf dem Kongress der AUA 2025 präsentierten Daten der BOND-003-Studie, in welcher Cretostimogene Grenadenorepvec beim HR-NMIBC mit CIS ± HG-Ta/T1 nach BCG-Versagen untersucht wird, geben eine Gesamt-Komplettremissionsrate („overall CR“) von 75,5% (95% CI: 66,3%–83,2%) wieder, die entsprechende Kaplan-Meier-Schätzung der 12- bzw. 24-monatigen Dauer des Ansprechens (DOR) liegt bei 64,1% (95% CI: 52,4–73,7%) bzw. 58,3% (95% CI: 46,3–68,5%).31
Nagopendekin alfa inbakicept (NAI)
Nagopendekin alfa inbakicept (NAI, vormals N-803) ist ein IL-15-Superagonist, welcher zur Aktivierung und Proliferation von NK-Zellen, Effektor- und Gedächtnis-T-Zellen führt und zu einer Wirkungsverstärkung von BCG durch potenzielle Synergie führen soll.32 NAI wurde im Rahmen der QUILT-3.032-Studie (NCT0302285) in Kombination mit BCG bei Patienten mit BCG-Versagen (CIS und/oder papillärer Tumor) bei HR-NMIBC untersucht. Hierbei erfolgte die intravesikale Therapie mit NAI+BCG im Rahmen einer Induktionstherapie + Erhaltungstherapie bzw. gegebenenfalls Re-Induktionstherapie ähnlich der Mono-BCG-Therapie. Aufgrund der eindrücklichen Resultate wurde die Kombinationstherapie bei BCG-Versagen von CIS-NMIBC ± papillärem Tumor bereits durch die FDA zugelassen.
Therapiealternativen abseits der rein intravesikalen Therapie
Um zu vermeiden, dass ein Rezidiv unter BCG-Therapie auftritt, wird an Möglichkeiten geforscht, unter der BCG-Therapie höhere Ansprechraten sowie ein länger andauerndes Ansprechen zu erreichen. Hierfür wird beispielsweise eine Immunaugmentation durchgeführt, bei welcher die BCG-Therapie mit einem PD-L1-Inhibitor oder PD-1-Inhibitor wie Pembrolizumab, Atezolizumab, Durvalumab oder Sasanlimab kombiniert wird.33–36 Auch der sequenzielle Einsatz von Mitomycin und BCG wurde im Rahmen der ANZUP-Studie untersucht.37
Auch bei BCG-Versagen gibt es alternative Therapieansätze zu der rein intravesikalen Therapie. Der Einsatz der Pembrolizumab-Monotherapie hat hier bereits durch die FDA Zustimmung erhalten.38 Ebenso werden unterschiedliche Kombinationen der oben genannten Therapien mit Pembrolizumab untersucht. Darüber hinaus könnten Tumorimpfstoffe eine weitere mögliche zukünftige Therapieoption insbesondere in den frühen Stadien des Blasentumors darstellen. Unter anderem werden mRNA-Impfstoffe beim Harnblasenkarzinom unter Zuhilfenahme von Neoantigenen untersucht.39
Fazit
Das BCG-Versagen von HR-NBMIBC stellt zum heutigen Tag weiterhin ein klinisch äußerst relevantes Problem in der Versorgung unserer Patienten dar. Bisher ist der aktuelle Goldstandard die Durchführung einer radikalen Zystektomie, welche mit einer großen Morbidität und Mortalität einhergehen kann. Die Entwicklung blasenerhaltender Alternativen spielt eine immer größere Rolle, vor allem für Patienten, die keiner Zystektomie zugeführt werden können oder diese ablehnen.
Aktuell verwendete Alternativen beinhalten intravesikale Verfahren, wie die Gemcitabin-Instillationstherapie oder die Mitomycin-Hyperthermie. Der Blick nach vorne zeigt allerdings eine spannende Landschaft neuer Therapiekonzepte:
Sowohl die Studien zu TAR-Therapieverfahren als auch zu den Adenovirus-basierten Gentherapien konnten bei BCG-Versagen ein gutes Therapieansprechen zeigen. Somit könnten diese Therapien zukünftig auch im Real-World-Setting eine klinisch relevante Verlängerung der Zeit bis zur Notwendigkeit der Durchführung einer Zystektomie für die Patienten ermöglichen. Für ausgewählte Patienten wird der Einsatz dieser Therapien möglicherweise sogar einen Organerhalt ermöglichen.
Literatur:
1 Cancer IAfRo. Global Cancer Observatory: Cancer Today – Data Visualization: Bladder cancer incidence 2022 [verfügbar unter: https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/bars?mode=population&cancers=30 2 Grabe-Heyne K et al.: Intermediate and high-risk non-muscle-invasive bladder cancer: an overview of epidemiology, burden, and unmet needs. Front Oncol 2023; 13: 1170124 3 EAU guidelines on non-muscle-invasive bladder cancer. Verfügbar unter https://uroweb.org/guidelines/non-muscle-invasive-bladder-cancer (zugegriffen am 16.07.2025) 4 Oddens J et al.: Final results of an EORTC-GU cancers group randomized study of maintenance bacillus Calmette-Guérin in intermediate- and high-risk Ta, T1 papillary carcinoma of the urinary bladder: one-third dose versus full dose and 1 year versus 3 years of maintenance. Eur Urol 2013; 63(3): 462-72 5 Volz Y et al.: Long-term health-related quality of life (HRQOL) after radical cystectomy and urinary diversion - a propensity score-matched analysis. Clinical Genitourinary Cancer 2022; 20(4): e283-e90 6 Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge des Harnblasenkarzinoms, Langversion 3.0 – März 2025 (zugegriffen am 16.07.2025) 7 Skinner EC et al.: SWOG S0353: Phase II trial of intravesical gemcitabine in patients with nonmuscle invasive bladder cancer and recurrence after 2 prior courses of intravesical bacillus Calmette-Guérin. J Urol 2013; 190(4): 1200-4 8 Di Lorenzo G et al.: Gemcitabine versus bacille Calmette-Guérin after initial bacille Calmette-Guérin failure in non-muscle-invasive bladder cancer: a multicenter prospective randomized trial. Cancer 2010; 116(8): 1893-900 9 Tan WS et al.: Radiofrequency-induced thermo-chemotherapy effect versus a second course of bacillus Calmette-Guérin or institutional standard in patients with recurrence of non-muscle-invasive bladder cancer following induction or maintenance bacillus Calmette-Guérin therapy (HYMN): a phase III, open-label, randomised controlled trial. Eur Urol 2019; 75(1): 63-71 10 Chiancone F et al.: Outcomes and complications of hyperthermic intravesical chemotherapy using mitomycin C or epirubicin for patients with non-muscle invasive bladder cancer after bacillus Calmette-Guérin treatment failure. Cent European J Urol 2020; 73(3): 287-94 11 Society of Urologic Oncology I: Use of intravesicale gemcitabine/docetaxel for NMIBC 2021: www.fda.gov/media/155370 12 Scilipoti P et al.: Gemcitabine and docetaxel for high-risk non-muscle-invasive bladder cancer: EuroGemDocegroup results. BJU Int 2025; 135(6): 969-76 13 Zhang JH et al.: Novel delivery mechanisms for existing systemic agents and emerging therapies in bladder cancer. Bladder Cancer 2023; 9(2): 109-23 14 Daneshmand S et al.: Development of TAR-200: A novel targeted releasing system designed to provide sustained delivery of gemcitabine for patients with bladder cancer. Urol Oncol 2025; 43(5): 286-96 15 Jacob J et al.: TAR-200 monothearapy in patients with bacillus Calmette-Guérin–unresponsive high-risk non–muscle-invasive bladder cancer carcinoma in situ: 1-year durability and patient-reported outcomes from SUNRISE-12025. 2025 American Urological Association Annual Meeting. April 26, 2025 16 Loriot Y et al.: Erdafitinib or chemotherapy in advanced or metastatic urothelial carcinoma. The New England Journal of Medicine 2023; 389(21): 1961-71 17 Pichler R et al.: Biological and therapeutic implications of FGFR alterations in urothelial cancer: A systematic review from non-muscle-invasive to metastatic disease. Actas Urológicas Españolas (English Edition) 2025; 49(5): 501719 18 Knowles MA, Hurst CD: Molecular biology of bladder cancer: new insights into pathogenesis and clinical diversity. Nature Reviews Cancer 2015; 15(1): 25-41 19 Tran L et al.: Advances in bladder cancer biology and therapy. Nature Reviews Cancer 2021; 21(2): 104-21 20 Dyrskjøt L et al.: Bladder cancer. Nature Reviews Disease Primers 2023; 9(1): 58 21 Catto JWF et al.: Erdafitinib in BCG-treated high-risk non-muscle-invasive bladder cancer. Annals of Oncology 2024; 35(1): 98-106 22 Vilaseca A et al.: LBA104 first safety and efficacy results of the TAR-210 erdafitinib (erda) intravesical delivery system in patients (pts) with non– muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) with select FGFR alterations (alt). Annals of Oncology 2023; 34: S1343 23 Li R et al.: MOONRISE-1: phase 3 study of TAR-210, an erdafitinib intravesical targeted releasing system, versus intravesical chemotherapy in patients with FGFR-altered intermediate-risk non–muscle-invasive bladder cancer. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2025; 43(3_Suppl): 53 24 Shore N et al.: editor Phase 3 Study of TAR-210 (intravesical erdafitinib releasing system) vs intravesical chemotherapy in patients with BCG–treated high-risk non–muscle-invasive bladder cancer. 120th AUA Annual Meeting 2025; 2025 25 Shore ND et al.: Non-muscle-invasive bladder cancer: An overview of potential new treatment options. Urol Oncol 2021; 39(10): 642-63 26 Narayan VM et al.: Mechanism of action of nadofaragene firadenovec-vncg. Front Oncol 2024; 14: 1359725 27 Boorjian SA et al.: Intravesical nadofaragene firadenovec gene therapy for BCG-unresponsive non-muscle-invasive bladder cancer: a single-arm, open-label, repeat-dose clinical trial. Lancet Oncol 2021; 22(1): 107-17 28 Narayan VM et al.: Efficacy of intravesical nadofaragene firadenovec for patients with bacillus Calmette-Guérin-unresponsive nonmuscle-invasive bladder cancer: 5-year follow-up from a phase 3 trial. J Urol 2024; 212(1): 74-86 29 Packiam VT et al.: An open label, single-arm, phase II multicenter study of the safety and efficacy of CG0070 oncolytic vector regimen in patients with BCG-unresponsive non-muscle-invasive bladder cancer: Interim results. Urol Oncol 2018; 36(10): 440-7 30 Li R et al.: Oncolytic adenoviral therapy plus pembrolizumab in BCG-unresponsive non-muscle-invasive bladder cancer: the phase 2 CORE-001 trial. Nat Med 2024; 30(8): 2216-23 31 Tyson MD et al.: Final results: BOND-003 Cohort C- phase 3, single-arm study of intravesical cretostimogene grenadenorepvec for high-risk BCG-unresponsive non-muscle invasive bladder cancer with carcinoma in situ. Journal of Urology [Internet] 2025 32 Chamie K et al.: IL-15 superagonist NAI in BCG-unresponsive non-muscle-invasive bladder cancer. NEJM Evid 2023; 2(1): EVIDoa2200167 33 Kamat AM et al.: KEYNOTE-676: phase III study of BCG and pembrolizumab for persistent/recurrent high-risk NMIBC. Future Oncol 2020; 16(10): 507-16 34 De Santis M et al.: A phase III, randomized, open-label, multicenter, global study of durvalumab and bacillus calmette-guérin (BCG) versus BCG alone in high-risk, BCG-naïve non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) patients (POTOMAC). J Clin Oncol 2019; 37(7_suppl): TPS500-TPS 35 Shore ND et al.: Sasanlimab plus BCG in BCG-naive, high-risk non-muscle invasive bladder cancer: the randomized phase 3 CREST trial. Nature Medicine 2025 36 Inman BA et al.: A phase 1b/2 study of atezolizumab with or without bacille Calmette-Guérin in patients with high-risk non-muscle-invasive bladder cancer. Eur Urol Oncol 2023; 6(3): 313-20 37 Hayne D et al.: Mitomycin plus BCG as adjuvant intravesical therapy for high-risk, non–muscle-invasive bladder cancer: A randomized phase 3 trial (ANZUP 1301). Journal of Clinical Oncology 2025; 43(17_suppl): LBA4504-LBA 38 Necchi A et al.: Pembrolizumab monotherapy for high-risk non-muscle-invasive bladder cancer without carcinoma in situ and unresponsive to BCG (KEYNOTE-057): a single-arm, multicentre, phase 2 trial. The Lancet Oncology 2024; 25(6): 720-30 39 Giudice GC, Sonpavde GP: Vaccine approaches to treat urothelial cancer. Hum Vaccin Immunother 2024; 20(1): 2379086
Das könnte Sie auch interessieren:
Zytoreduktive Nephrektomie nach Systemtherapie bei metastasiertem RCC
Die Erstlinientherapie beim metastasierten Nierenzellkarzinom (mRCC) hat sich gewandelt: Weg von der operativen Primärtherapie hin zu einer gezielten Selektion durch systemische Therapie ...
Historische Momente aus Wiener urologischen Abteilungen
Der 51. Österreichische Urologenkongress in der Messe Wien vom 22. bis 25.5.2025, veranstaltet zusammen mit der bayrischen Schwestergesellschaft, fokussierte nicht nur wichtige ...
Zytoreduktive Nephrektomie im Jahr 2025 – ein evidenzfreier Raum?
Die zytoreduktive Nephrektomie (CN) ist heutzutage weiterhin ein fester Bestandteil der Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC). Doch ob und wann ein Patient einer CN ...


