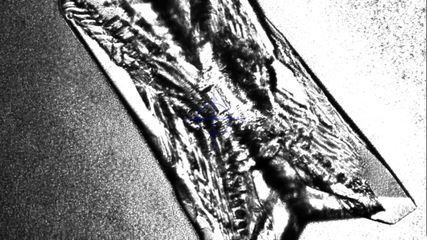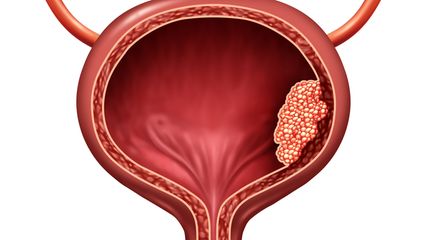©
Getty Images/iStockphoto
Renaissance der evidenzbasierten konservativen Therapie
Leading Opinions
Autor:
Dr. med. Sonja Brandner
FMH Gynäkologie und Geburtshilfe<br> Schwerpunkt operative und Urogynäkologie, Frauenzimmer Bern<br> E-Mail: frauenzimmer-bern@hin.ch
30
Min. Lesezeit
19.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Im Zuge der kontroversen Diskussionen um Nutzen und Risiken der modernen Prolapschirurgie, insbesondere der Meshchirurgie, gewinnt die konservative Therapie wieder an Bedeutung. Anlässlich des SGGG 2019 in St. Gallen wurde die Evidenz der verschiedenen konservativen Therapien erläutert.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Zuwarten ohne Therapie ist bei asymptomatischer Patientin eine Option.</li> <li>Die Entscheidungsfindung in der Therapiewahl ist ein individueller Prozess, welcher eine massgeschneiderte Beratung erfordert.</li> <li>Physiotherapie kann bei leichtem Deszensus (Grad I und II nach ICS) die Symptome und das Körpergefühl verbessern.</li> <li>Die lokale Östrogenisierung bildet die Basis und hilft irritative Symptome zu verbessern. Auch bei Brustkrebspatientinnen soll diese Therapie evaluiert werden.</li> <li>Pessare sind bei entsprechender Instruktion eine effiziente und risikoarme Alternative zur operativen Therapie.</li> </ul> </div> <p>Ungefähr 50 % aller Frauen erleiden im Verlaufe ihres Lebens einen genitalen Prolaps. Die Lebensqualität, insbesondere die Blasen-, Darm- und Sexualfunktion, ist eingeschränkt, Patientinnen beklagen ein Fremdkörpergefühl, manchmal auch in Verbindung mit Urininkontinenz. In Abhängigkeit vom Leidensdruck und von der Präferenz der Patientinnen besteht die Wahl zwischen operativen und nicht operativen Therapien. Seit die FDA vor einigen Jahren eine Warnung bezüglich der Anwendung von Netzen in der Deszensuschirurgie herausgegeben hat, nehmen die kritischen Stimmen weltweit zu. Patientinnenorganisationen und Gesundheitsbehörden in verschiedenen Ländern machen auf das Risiko aufmerksam, das mit künstlichen Netzen verbunden ist. Allen voran in Grossbritannien, wo aktuell bis auf Weiteres weder vaginale noch abdominelle Netze und auch keine Inkontinenzschlingen mehr eingelegt werden dürfen. Unter anderem auch deswegen hat die Bedeutung der konservativen Therapie wieder stark zugenommen. Die Erfolgsraten der chirurgischen Therapie sind vor allem im vorderen Kompartiment mit 63 % «overall success» nicht befriedigend. Durch eine apikale Fixation und/oder Anwendung eines Netzes können die Rezidivraten deutlich gesenkt werden (Tab. 1). In Kauf genommen werden müssen aber Komplikationsraten je nach Literatur zwischen 4 und 10 %, postoperative Dyspareunie und Schmerzen in bis zu 8 % sowie Mesherosionen bei Netzeinlagen in bis zu 25 % der Fälle. Nicht zu vergessen sind die sich häufenden Hinweise darauf, dass jeder operative Eingriff durch Freisetzung von Entzündungsmediatoren die kognitive Funktion bei älteren Patientinnen beeinträchtigen kann. Das alles sind Gründe, weshalb alle Leitlinien und Expertenempfehlungen die konservative Therapie als First-Line-Therapie empfehlen (Tab. 2).<br />Befragt man die Patientinnen nach ihren Therapiepräferenzen, wählen zwei Drittel die Pessartherapie als First-Line- Behandlung. Nur rund ein Viertel davon will sich später operieren lassen. Vor allem die jüngeren und sexuell aktiven Patientinnen entscheiden sich primär für eine Operation. Schmerzen sowie Blasen- und Stuhlentleerungsstörungen sind weitere Gründe, welche die Patientinnen eher einen chirurgischen Ansatz wählen lassen.<br />Neben der aktuellen Lebenssituation spielen Alter, Komorbiditäten, allfällige Familienplanungsabsichten, Voroperationen sowie Art und Lokalisation des Prolapses eine wesentliche Rolle in der Entscheidungsfindung. Selbstbestimmung und individualisiertes Therapiekonzept bilden heute die Grundlage in der Beratung. Grundsätzlich muss ein asymptomatischer Prolaps nicht behandelt werden. Nur 20 % der unbehandelten Senkungen sind im Laufe der Zeit progredient.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Gyn_1903_Weblinks_lo_gyn_1903_tab1_s20_brandner.png" alt="" width="640" height="354" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Gyn_1903_Weblinks_lo_gyn_1903_tab2_s21_brandner.png" alt="" width="640" height="197" /></p> <h2>Lifestyle-Veränderungen</h2> <p>Oft genügt eine sorgfältige Beratung über Lebensstilmodifikationen. Ein Rauchstopp kann irritative Symptome verbessern. Bei übergewichtigen Patientinnen sollen Optionen zur Gewichtsreduktion angesprochen werden. Ein Gewichtsverlust verbessert nicht nur die Prolapssymptome. Eine Abnahme des Körpergewichtes von 10 % kann die Belastungsinkontinenz um 50 % verbessern. Zu den Lifestyle-Modifikationen gehört auch eine adäquate Behandlung der Obstipation.</p> <h2>Lokale Östrogenisierung</h2> <p>Mit und ohne Pessartherapie stellt die lokale Östrogenisierung die Basis der konservativen Prolapstherapie dar. Sie kann Prolapssymptome lindern und verhindert Erosionen bei der Pessartherapie. Zu Diskussionen führt immer wieder die Frage, welches Risiko die lokale Östrogenisierung bei Mammakarzinompatientinnen birgt. Die Datenlage ist nach wie vor kontrovers. Grundsätzlich sollte man bei überschaubarem Risiko den Patientinnen den Nutzen einer lokalen Östrogenisierung nicht vorenthalten, im Zweifelsfall mit der behandelnden Onkologin das individuelle Risiko besprechen. Es soll die niedrigstdosierte Formulierung gewählt werden. Bei der Pessartherapie hat sich eine Verdünnung z. B. mit Bepanthen® bewährt.</p> <h2>Physiotherapie</h2> <p>In den letzten Jahren hat sich die Evidenzlage verbessert, welche zeigt, dass gezieltes Beckenbodentraining bei mässigem Prolaps zur Symptomlinderung beiträgt. Die grösste randomisierte und kontrollierte Studie ist der POPPY-Trial.<sup>1</sup> An weit über 1000 Probandinnen konnte gezeigt werden, dass Physiotherapie im Vergleich zu lediglich Lifestylemodifikation eine deutliche Verbesserung der Prolapssymptome und der Lebensqualität mit sich brachte. Entsprechend gilt aktuell die Empfehlung, dass bei Grad-I- und Grad-II-Prolaps Beckenbodentraining bei einer spezialisierten Physiotherapeutin angeboten werden soll.</p> <h2>Pessartherapie</h2> <p>Obwohl die Pessartherapie sehr alt, weit verbreitet und günstig ist, wird sie nur von zwei Dritteln der (Uro-)Gynäkologinnen/Gynäkologen angeboten.<sup>2</sup> Viele Gynäkologinnen/Gynäkologen geben an, nie in der Anpassung von Pessaren und der Instruktion betreffend ihre Anwendung unterrichtet worden zu sein.<sup>3</sup> Der aktuellste Cochrane-Review von 2013 kommt zum Schluss, dass dringend randomisierte Studien nötig sind, um einen Konsens zu Indikation, Anwendung und Follow-up von Pessartherapie zu erhalten.<sup>4</sup> Verschiedene Studien konnten zeigen, dass mit einer Pessarversorgung sowohl Fremdkörpergefühl und Blasensymptome verringert als auch die Sexualfunktion verbessert wird. Letzteres hat wahrscheinlich vor allem mit dem verbesserten Körperbild zu tun. Kuhn et al. zeigten, dass unter Pessartherapie Lust, Lubrifikation und sexuelle Zufriedenheit signifikant erhöht wurden.<sup>5</sup> Verschlechterung von Blasenentleerung, inkomplette Stuhlentleerung und Inkontinenz sind Faktoren, welche den Erfolg der Pessartherapie mindern können.<br />Die meisten Patientinnen können erfolgreich mit einem Pessar versorgt werden. In einer Studie von Lesley et al. waren es 89 % aller Patientinnen, 71 % von ihnen konnten das Pessar selbstständig anwenden.<sup>6</sup> Kurze Vagina, weiter Hiatus, Rektozelen und Voroperationen sind Faktoren, die den Erfolg reduzieren. Der Schlüssel zur erfolgreichen Anwendung liegt wohl einerseits in der individuellen Wahl des richtigen Pessars sowie andererseits in der umfassenden Instruktion in der Handhabung. Im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum haben wir in der Schweiz eine Vielzahl von Pessaren zur Verfügung.<br />Bei uns am meisten verwendet werden Würfelpessare. Sie zeichnen sich durch einen guten Support aus, haben aber durch den Aufbau des Vakuums eine höhere Erosionsrate. Bei larvierter Belastungsinkontinenz können Urethraloder Urethraschalenpessare sowohl die Senkung als auch die Inkontinenz suffizient beheben. Schalen- und Ringpessare eignen sich vor allem für Patientinnen, die wenig mobil sind und bei denen ein selbstständiger Wechsel nicht infrage kommt. Im Gegensatz zum Würfelpessar, welches meist täglich gewechselt wird, können diese für 3 Monate in situ belassen werden. Vaginalspülungen können der unangenehmen Fluorbildung vorbeugen. Zeigen sich Druckstellen oder sogar Ulzerationen, bieten weiche Wegwerfpessare eine (vorübergehende) Alternative.<br />Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine individualisierte konservative Therapie einen hohen Stellenwert in der Behandlung von Prolapsbeschwerden hat. Die einzelnen Standbeine sollen der Patientin angeboten und erläutert werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Hagen S et al.: Lancet 2014; 383: 796-806 <strong>2</strong> Velzel J et al.: Int Urogynecol J 2015; 26: 1453-8 <strong>3</strong> Bugge C et al.: Int Urogynecol J 2013; 24: 1017-24 <strong>4</strong> Bugge C et al.: Cochrane Review 2013; (https://doi.org/10.1002/14651858. CD004010.pub3) <strong>5</strong> Kuhn A et al.: Fertil Steril 2009; 91: 1914-8 <strong>6</strong> Lesley AM et al.: Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006; 17: 155-9</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Der Infektstein als therapeutische Herausforderung
Rund 10% aller Harnsteine sind sogenannte Infektsteine. Die therapeutische Herausforderung besteht im schnellen Steinwachstum, in der Rezidivneigung und einer Obstruktion der Harnwege. ...
Psychische und körperliche Auswirkungen verschobener elektiver Operationen
Pflege- und Personalmangel führten in Österreichs Urologie zu deutlichen Einschränkungen in der elektiven operativen Versorgung. Eine Studie der Medizinischen Universität Graz zeigt, ...
Perioperative Therapie mit Enfortumab Vedotin + Pembrolizumab bei Cisplatin-ungeeigneten Patienten mit MIBC
Die Phase-III-Studie KEYNOTE-905/EV-303 schließt eine entscheidende und seit Langem offene Versorgungslücke bei muskelinvasivem Blasenkarzinom: Für Cisplatin-ungeeignete Patient:innen ...