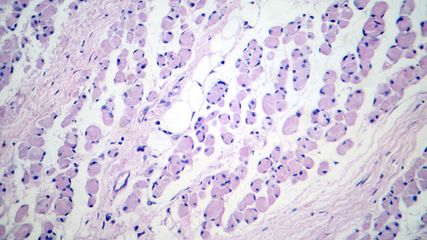Status quo für die Mehrheit und ein erster Durchbruch für wenige ALS-Betroffene
Unser Gesprächspartner:
Prof. Dr. med. Markus Weber
Leiter des Muskelzentrums/ALS Clinic
HOCH Health Ostschweiz
Kantonsspital St. Gallen
E-Mail: markus.weber@h-och.ch
Das Interview führte Dr. rer. nat. Torsten U. Banisch
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Seit der Einführung von Riluzol als erstes Medikament für die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) hat sich das Therapiefeld kaum verändert und musste viele wissenschaftliche Rückschläge verkraften. Doch mit einer weitgehenden Optimierung der symptomatischen Therapien und einem ersten Durchbruch bei den krankheitsverändernden Therapien kann man leicht optimistisch in die Zukunft blicken.
Herr Prof. Weber, wie hat sich dasTherapiefeld der ALS im letzten Jahrzehnt aus Ihrer Sicht als Leiterdes Muskelzentrums im Kantonsspital St. Gallen verändert?
M. Weber: Nun, das Therapiefeld der ALS hat sich leider in den letzten Jahren kaum verändert. Bei den krankheitsmodifizierenden Therapien sind wir nahezu auf dem gleichen Level wie vor circa 30 Jahren, als die Studie zu Riluzol veröffentlicht wurde. Seitdem gab es keine signifikanten Änderungen. Es gab immer wieder einen Hoffnungsschimmer aufgrund von Phase-II-Studien, die dann aber nicht bestätigt werden konnten. Wir haben also bisher bei den krankheitsmodifizierenden Therapien keine wirklich grossen Fortschritte gemacht, mit Ausnahme von Tofersen. Dieser Wirkstoff war ein wirklicher Durchbruch, jedoch eignet er sich nur für eine sehr kleine Anzahl von ALS-Patient:innen mit einer Mutation im SOD1-Gen.
Wie kann man ALS frühzeitig feststellen und was ist bei der ALS-Diagnostik weiter zu beachten?
M. Weber: Die ersten ALS-Symptome sind häufig Faszikulationen, also Muskelzuckungen, und Muskelkrämpfe. Generell sind alle muskulären Symptome, die oberhalb des Knies auftreten, ernst zu nehmen, wie Krämpfe in den Oberschenkeln, Bauchmuskeln und den Armen. Diese treten häufig schon Monate vor den eigentlichen Schwächeerscheinungen auf.
Alle anderen Symptome sind von subtiler Natur und können aufgrund des zumeist späten Krankheitsbeginns zwischen 60 und 70 Jahren auch auf das Alter geschoben werden. So können ein häufiges Stolpern, feinmotorische Störungen, ein vermehrtes Räuspern oder eine verwaschene Sprache, der Verlust der Hochton-Singfähigkeit als Symptome einer ALS unerkannt bleiben. Das ist auch der Grund, warum es manchmal sehr lange dauert, bis die Diagnose ALS gestellt wird. Aber auch diesbezüglich haben wir uns verbessert: Im Durchschnitt liegen zwischen Symptombeginn und Diagnose um die 9 bis 11 Monate. Noch vor einigen Jahren waren es 13 bis 14 Monate. Das liegt auch an der grösseren medialen Präsenz von ALS und dem daraus resultierenden gesteigerten Bewusstsein der Betroffenen und auch der Ärztinnen und Ärzte, sollten diese subtilen Symptome vorliegen.
Es unterscheiden sich die sporadische, familiäre und endemische Form der ALS voneinander. Was ist über die Auslöser der sporadischen Form bekannt und warum tritt auch die vererbte Form erst im späteren Lebensalter auf?
M. Weber: Generell ist zu beachten, dass man mit einer familiären/genetischen Variante früher erkrankt als bei einer sporadischen ALS. Wir haben zum Beispiel eine 14-jährige Patientin mit der erblichen Form an unserer Klinik. Das Auftreten der ALS-Symptomatik kann als Stufenprozess beschrieben werden, der über Jahre hinweg versteckt verlaufen kann und schliesslich durch uns nicht bekannte Auslöser zum Durchbruch der ALS-Symptome führt. Dies ist auch eine mögliche Erklärung für den oftmals späten Krankheitsbeginn zwischen 60 und 70 Jahren. Welche Faktoren, neben einer Mutation, hier eine Rolle spielen, ist leider noch nicht geklärt. Hätten wir hierfür Anhaltspunkte, könnte man in Zukunft womöglich auch präventiv eingreifen.
Als den derzeitigen Therapiestandards kommt den symptomatischen Therapien eine tragende Rolle zu, auch da bisher keine ursächlichen Therapien zugelassen sind. Was sind die grössten Herausforderungen in der Praxis der ALS-Behandlung?
M. Weber: Wir betreuen in unserer Klinik gerade 250 Patient:innen mit ALS. Bei jeder Untersuchung werden alle Symptome überprüft und je nach Symptomkonstellation erfolgt dann ein individualisierter Therapievorschlag. Dies ist wichtig, da die Probleme, die die Patient:innen mitbringen, sehr unterschiedlich sein können. 95% unserer Patient:innen haben zudem eine weitere Anreise. Somit versuchen wir natürlich, die meisten Behandlungen, sei es Physiotherapie, Logopädie oder eine psychiatrische Betreuung, an wohnortnahen Institutionen und Therapiestellen zu gewährleisten. Zu den am häufigsten zu behandelnden ALS-Symptomen zählt der vermehrte Speichelfluss, gegen den wir sehr gute Medikamente haben. Gleiches gilt für Muskelkrämpfe. Auch Symptome wie Atemnot oder Tagesmüdigkeit sind gut handhabbar. Eines der grössten Probleme, die wir haben, ist ein zäher Schleim hinten im Rachen der Patient:innen. Dagegen gibt es bisher keine guten Medikamente und selbst ein maschineller Hustenassistent, der Cough Assist, kann hier nur kurzfristig, für 1 bis 2 Stunden, Abhilfe schaffen.
1996 wurde mit Riluzol das erste ALS-Medikament zugelassen, das der Glutamat-Überaktivität bei ALS entgegensteuert. Wie sind Ihre Erfahrungen hiermit, gerade in Hinblick auf neuere Daten von Beobachtungsstudien, die eine längere Überlebenszeit von 6–19 Monatenals bisher angenommen ermitteln konnten?
M. Weber: Riluzol ist bei uns der Therapiestandard und wir klären unsere Patient:innen immer darüber auf, dass die in der Fachinformation angegebene dreimonatige Lebensverlängerung nicht die Real-World-Datenlage widerspiegelt. Die Riluzol-Zulassungsstudie schloss damals auch Patient:innen ein, die eine Krankheitsdauer von bis zu 5 Jahren hatten, also schon sehr weit fortgeschritten waren. Bei einer medianen Einschlusszeit in die Studie von 21 Monaten und einer medianen Überlebenszeit von 24 Monaten hat somit ein Grossteil der Patient:innen in der Studie erst im letzten Drittel ihrer Erkrankung Riluzol erhalten, und dennoch konnte ein Nutzen gezeigt werden.
Die neuen Beobachtungsstudien basieren dementsprechend auf neu diagnostizierten und früher mit Riluzol behandelten Patient:innen. Nichtsdestotrotz verschlechtert sich der Zustand der Patient:innen unter der Therapie, aber eben verlangsamt. Hier müssen die Patient:innen genau darüber aufgeklärt werden, was von der Riluzol-Therapie erwartet werden kann.
Alternative Therapieansätze wieAntioxidanzien (Edaravone) oder aktuell Reldesemtiv führten in den respektiven Studien trotz anfänglich positiver Daten zu keinem Durchbruch. Worauf beruhen die vielen Fehlschläge in der ALS-Forschung?
M. Weber: Gerade in einem Therapiefeld ohne wirkliche krankheitsmodifizierende Therapien sind solche Rückschläge natürlich sehr schwer. Es gibt vermutlich mehrere Gründe, warum es Phase-II- und Phase-III-Studien gibt, deren positive Signale in grösseren Phase-III-Studien nicht bestätigt werden.
Verständlicherweise ist bei der ALS der Druck, wirkungsvolle Therapien zu entwickeln, enorm, aber aus all den Studien haben wir und auch die FDA gelernt, keine Zulassungen mehr auf Grundlage von Phase-II-Studiendaten zu erteilen, selbst in einem Therapiefeld wie der ALS.Ein weiteres Problem bei der Therapiefindung, rezent auch am Beispiel von Reldesemtiv gezeigt, ist, dass mit einem Muskelzellaktivator nur die Peripherie der Erkrankung anvisiert wird. Zudem werden oftmals nur einzelne Stoffwechselvorgänge für einen Therapieansatz gewählt, aber ALS ist eben sehr komplex. Riluzol zum Beispiel greift in mehrere Stoffwechselprozesse ein, was dessen Erfolge in der Behandlung erklären könnte. Meiner persönlichen Meinung nach brauchen wir den richtigen Cocktail, die richtige Kombination, die an verschiedenen Stellen der ALS eingreifen kann.
Ein positiver Ausblick für eine Subgruppe von ALS-Patient:innen mit SOD1-Mutationen ist das Antisense-Oligonukleotid Tofersen. Der Wirkstoff wurde im Juni 2024 von der EMA zugelassen. Wie ist Ihre Einschätzung und haben Sie bereits Praxiserfahrungen sammeln können?
M. Weber: Die Therapie mit Tofersen ist wirklich ein Game-Changer, anders kann man es nicht formulieren. Das ist ein Riesendurchbruch im Therapiefeld der ALS. Wenn man den primären Endpunkt der Studie betrachtet, dann war auch diese Studie erst einmal negativ, aber wir haben sehr viel daraus gelernt. Zum einen wissen wir jetzt, dass eine placebokontrollierte ALS-Studie über ein halbes Jahr zu kurz für eine Beurteilung ist. Manche Therapien brauchen einfach länger, bis sie eine messbare Wirkung zeigen. Zum anderen haben wir jetzt Real-World-Daten, die wir in der Zwischenzeit generiert haben, die mehr als beeindruckend sind. Bei circa 2/3 der Patient:innen kann der Krankheitsverlauf unter Tofersen stabilisiert werden und bei weiteren 10% tritt sogar eine Besserung auf. Die durch die Therapie erreichte Stabilisierung der ALS bleibt über Monate und sogar Jahre erhalten. So etwas haben wir bislang noch nicht mit einem Therapieansatz gesehen.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass ein Durchbruch erzielt wurde. Leider betrifft er nur einen sehr kleinen Teil der ALS-Patient:innen. Wenn man davon ausgeht, dass 5 bis 10% der ALS-Fälle erblich sind, und davon nur 30% eine Mutation im SOD1-Gen als nötige Voraussetzung für ein Therapieansprechen haben, dann sprechen wir von ungefähr 1% aller ALS-Patient:innen, die für eine Therapie mit Tofersen infrage kommen.
Aber im Grossen und Ganzen macht dieser Behandlungserfolg doch hoffnungsvoll. Auch in unserer Klinik haben wir schon Erfahrung mit Tofersen sammeln können. Ein Teil unserer Patient:innen hatte bereits an den Studien dazu teilgenommen. Gerade überblicken wir 4 Patient:innen unter Tofersen und die Verläufe sind durchaus positiv.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das könnte Sie auch interessieren:
Epilepsie: «Wir können heute die Therapie viel mehr individualisieren»
Jahrhundertelang versuchte man, Epilepsiekranken mit Exorzismus ihre angeblichen «Dämonen» auszutreiben. Heute gibt es mehr als 30 wirksame Medikamente, präzisere Diagnostik und neue ...
Optimierung und Individualisierung der SMA-Behandlungsstandards
2017 wurde mit Nusinersen ein erstes vielversprechendes Therapeutikum für SMA in der Schweiz zugelassen und das Therapiefeld nachhaltig verändert. Mit einer neuen Tabletten-formulierung ...
Die Alzheimer-Erkrankung: Status quo durch neue Therapeutika
Durch die wahrscheinliche Zulassung von plasmabasierten Biomarkern und gegen Amyloid gerichteten monoklonalen Antikörpern steht in der Schweiz möglicherweise ein Paradigmenwechsel in der ...