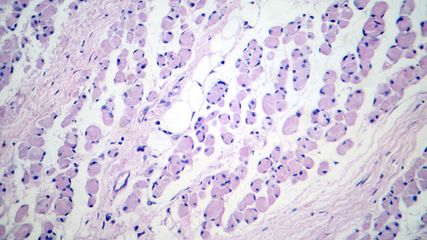Die Alzheimer-Erkrankung: Status quo durch neue Therapeutika
Unser Gesprächspartner:
Dr. med. Martin Ott
Facharzt für Allgemeine Medizin, spez. Geriatrie
Leitender Arzt in der Memory Clinic Entlisberg
Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich
E-Mail: martin.ott@zuerich.ch
Das Interview führte Dipl.-Ing. Dr. techn. Manuel Spalt-Zoidl
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Durch die wahrscheinliche Zulassung von plasmabasierten Biomarkern und gegen Amyloid gerichteten monoklonalen Antikörpern steht in der Schweiz möglicherweise ein Paradigmenwechsel in der Diagnostik und der Behandlung der Alzheimer-Krankheit bevor. In einem Interview mit Dr. med. Martin Ott, leitender Arzt in der Memory Clinic Entlisberg, erläuterte der Geriater die Fortschritte, aber auch die Herausforderungen, die mit diesen Errungenschaften einhergehen. Ausserdem unterstrich er die Wichtigkeit der nichtpharmakologischen Therapie und der sorgfältigen Diagnostik, damit auch Demenzen, deren Ursache nicht die Alzheimer-Krankheit ist, nicht in Vergessenheit geraten.
Wo stehen wir aktuell bei der Diagnose der Alzheimer-Erkrankung und welche Fortschritte haben die Diagnostik in den letzten Jahren nachhaltig verändert?
M. Ott: Bei der Diagnostik der Alzheimer-Erkrankung ist im Moment sehr viel im Umbruch. Gerade mit den neuen Biomarkern zeigt sich, dass nicht alles, was klinisch wie eine Alzheimer-Demenz aussieht, auch tatsächlich eine solche ist. Unsere Patient:innen werden mehrheitlich von niedergelassenen Hausärzt:innen überwiesen. In der Regel sind das ältere Menschen, bei denen bereits eine deutliche Veränderung im Alltag aufgetreten ist. Als ersten Schritt überprüfen wir stets, ob es sich tatsächlich um eine Demenzform handelt oder aber eine somatische oder psychische Erkrankung zu den Symptomen führt. Des Weiteren wird überprüft, um welche Demenzform es sich genau handelt, da die Alzheimer-Erkrankung nicht die einzige Ursache von Demenzen ist. Erst dann werden Empfehlungen für Antidementiva und nichtpharmakologische Therapien erarbeitet. Für den Nachweis der Alzheimer-Krankheit wären, vor allem in frühen Erkrankungsstadien, einfach nachzuweisende Biomarker äusserst nützlich. Dies wird vor allem bei jüngeren Patient:innen eine grosse Rolle spielen.
Im Rahmen der Diagnostik arbeiten wir in der Memory Clinic heute vermehrt mit Biomarkern, die wir durch Liquorpunktion gewinnen. Dabei sehen wir uns Amyloid-Spezies wie das Verhältnis von Amyloid-beta 42 zu Amyloid-beta 40 und phosphorylierte Tau-Spezies wie pTau217 an. In ausgewählten Fällen überprüfen wir auch den Glukosemetabolismus anhand von Positronen-Emissions-Tomografien (PET) mit 18F-Fluorodeoxyglukose. Alternativ wären auch Amyloid- oder Tau-PET-Scans möglich, wobei Letztere noch nicht kassenpflichtig sind und somit noch keine Anwendung in unserer Klinik finden. Gerade bei Liquoruntersuchungen muss man bedenken, dass es sich um einen Eingriff handelt. Da wir hauptsächlich ältere Patient:innen in der Memory Clinic versorgen, müssen deren Nutzen und Risiken sorgfältig abgewogen werden. Bei jüngeren Patient:innen sieht die Sache wie gesagt anders aus. Hier werden die Liquordiagnostik, aber auch potenzielle neue Biomarker, wie solche aus dem Plasma, sicher einen höheren Stellenwert haben.
Welche Biomarker werden Ihrer Einschätzung nach einen Para-digmenwechsel in der Diagnostik der Alzheimer-Erkrankung darstellen?
M. Ott: Mit der Entwicklung von liquorbasierten Biomarkern ist sicherlich schon ein grosser Fortschritt bei der Diagnostik der Alzheimer-Erkrankung gelungen. Der nächste Entwicklungsschritt wären blutbasierte Biomarker. Diese sollen angeblich ja bald genauso spezifisch und sensitiv sein wie liquorbasierte Biomarker. Nach deren Zulassung würde uns sicher eine einfachere Art der Befundung zur Verfügung stehen. Allerdings darf während der Einführung dieser einfachen Nachweismethoden nicht vergessen werden, dass viele Menschen auch schon vor dem Auftreten klinischer Symptome wissen möchten, ob sie pathologische Biomarker haben. Zudem können diese auch bei hoher Sensitivität und Spezifität falsch positive Ergebnisse liefern, die in Abwesenheit von klinischen Symptomen kaum erkannt werden können. Das wird zu vielen unnötigen, möglicherweise sehr teuren Behandlungen und psychischen Problemen wie Angstzuständen, Stress oder Depression führen. Besonders wichtig ist ausserdem, dass man Patient:innen ohne eine zugelassene Behandlung in frühen Krankheitsstadien durch solche Tests in eine sehr schwierige Situation bringt. Beispielsweise muss beim Abschluss einer Lebensversicherung laut Gesetz angegeben werden, dass ein positiver Nachweis von pathologischen Biomarkern für die Alzheimer-Erkrankung vorliegt. Die Versicherungsraten werden dadurch teurer oder ein Abschluss unmöglich.
Ich denke, dass auch die Forschung an einem einfacheren Nachweis des Transactive Response DNA Binding Protein 43 (TDP-43) relevant sein könnte. Meines Wissens ist der Nachweis des Biomarkers gegenwärtig nur post mortem mit Sicherheit möglich. Auch die Weiterentwicklung von Tau-PETs könnte eine relevante Forschungsrichtung darstellen.
Wie beurteilen Sie den Stellenwert und die Entwicklung der pharma-kologischen Therapie der Alzheimer-Erkrankung?
M. Ott: Vor 25 Jahren ist Memantin auf den Markt gekommen. Seit dieser Zeit habe ich eigentlich keine wesentlichen Neuerungen bei der Wirksamkeit von Antidementiva gesehen. Bei einigen Patient:innen wirken diese Medikamente zwar sehr gut, bei vielen jedoch nicht. Die Versprechungen der letzten Jahrzehnte, dass neue wirksame Medikamente auf den Markt kommen, machen uns natürlich immer wieder Hoffnung, wurden bis jetzt jedoch nicht gehalten. Mit der Entwicklung der monoklonalen Antikörper, die gegen aggregierte Formen des Amyloids gerichtet sind, hoffen wir jetzt auf eine neue Behandlungsoption. Die Medikamente sind gegenwärtig in der Schweiz noch nicht zugelassen.
Trotz der statistisch signifikanten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten aus klinischen Studien werden diese neuen Medikamente einige Diskussionen auslösen. Sie sind nicht billig und nur für Menschen mit einer frühen nachgewiesenen Alzheimer-Demenz zugelassen. Ausserdem weiss man noch nicht genau, wie lange sie wirken und wie lange sie verabreicht werden müssen. Schliesslich müssen Patient:innen aufgrund der potenziellen «amyloid-related imaging abnormalities» sehr engmaschig begleitet werden und sich häufig einer Magnetresonanztomografie (MRT) und einer neurologischen Untersuchung unterziehen. Betrachtet man den Untersuchungsaufwand, der vor und während dieser Therapie betrieben werden muss, und auch die Ängste vor den Mikroblutungen und anderen Nebenwirkungen, ist die positive Wirkung auf die Lebensqualität der Betroffenen im Alltag vermutlich nicht immer gegeben. Dennoch halte ich es für einen guten Behandlungsansatz, der eine weitere sorgfältige Beobachtung verdient hat.
Welche Hindernisse sehen Sie in der Grundversorgung von Menschen mit der Alzheimer-Erkrankung?
M. Ott: Für die Grundversorgung muss zunächst die Frage geklärt werden, welche Patient:innen überhaupt für eine Therapie mit den neuen Arzneimitteln infrage kommen. Gemäss Studien sollen diese ja so früh wie möglich eingesetzt werden, optimalerweise sogar schon vor den ersten klinischen Symptomen. Das ist ethisch jedoch bedenklich, da man dann per Definition ja Gesunde behandeln würde. Ausserdem bleibt die Frage, wer die Kosten für diese Therapie und vor allem die damit einhergehende engmaschige Überwachung übernimmt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass durch die Zulassung der neuen Medikamente die Gefahr besteht, dass andere Therapieoptionen und auch andere Ursachen der Demenz vergessen werden. Tatsächlich sind aber auch andere Demenzformen sehr herausfordernd für die Betroffenen und auch deren Angehörige. Das ist eine schwierige Situation, besonders auch, weil man noch nicht genau weiss, wie gut die neuen Medikamente im Praxisalltag abschneiden.
Wie hoch schätzen Sie den Stellenwert der nichtpharmakologischen Therapie ein?
M. Ott: Ich denke, der Stellenwert der nichtpharmakologischen Therapie kann für alle Patient:innen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gerade für Patient:innen, bei denen Antidementiva nicht gut wirken, sowie deren Angehörige stellen nichtpharmakologische Therapien die wichtigste Massnahme dar. Sie umfassen Informationen über den Krankheitsverlauf und rechtliche Fragen sowie Beratung, wie man mit bestimmten Verhaltensauffälligkeiten umgehen kann. Ausserdem sind Übungen wie Gedächtnistraining und Ergotherapie für Patient:innen besonders relevant, um ihre Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten. Wichtig bleibt das Beratungsgespräch mit Angehörigen, um aufzuzeigen, wie sie mit dieser sehr einschneidenden Familiensituation umgehen und Unterstützung holen können.
Man darf nicht vergessen, dass auch nichtpharmakologische Therapien Geld kosten. Mit der Zulassung von neuen pharmakologischen Therapien besteht natürlich die Gefahr, dass sich die Finanzierungssituation ändert und für nichtpharmakologische Alternativen weniger Ressourcen zur Verfügung stehen. Dies kann die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen stark beeinträchtigen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommt.
Wie würden Sie den Wissensstand über die Alzheimer-Erkrankung bei Allgemeinmediziner:innen und der allgemeinen Bevölkerung bewerten?
M. Ott: Die Situation hat sich in den letzten Jahren definitiv stark gebessert und ich würde den Wissensstand von Allgemeinmediziner:innen und der allgemeinen Bevölkerung über die Alzheimer-Erkrankung als sehr gut bewerten. Wir arbeiten eng mit den Allgemeinmediziner:innen zusammen und stehen ihnen für Fragen, wie zum Beispiel zur medikamentösen Behandlung oder wie sie mit gewissen Verhaltensauffälligkeiten umgehen können, zur Verfügung. Auch in der allgemeinen Bevölkerung hat sich in der Schweiz viel getan. Wir haben eine nationale Demenzstrategie, die das Ziel hat, die Bevölkerung aufzuklären. Klar ist aber, dass auf die Gesellschaft eine riesige Herausforderung zukommen wird. Ich gehe davon aus, dass durch die Zulassung von plasmabasierten Biomarkern und potenziell wirksamen Medikamenten die Aufmerksamkeit für und die Inzidenzen von Alzheimer- und Demenzerkrankungen steigen werden. Die Frage wird sein, wer in Zukunft all diese Menschen betreuen und versorgen wird.
Im Bereich der Alzheimer-Erkrankung herrscht somit definitiv noch sehr viel Diskussions- und Forschungsbedarf. Auch wenn ich hoffe, dass die neuen Medikamente eine Veränderung bringen, müssen diese weiterhin genau beobachtet und im Praxisalltag erforscht werden. Besonders wichtig ist auch, dass die nichtpharmakologischen Therapien und auch die anderen Formen der Demenz nicht vergessen werden.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das könnte Sie auch interessieren:
Epilepsie: «Wir können heute die Therapie viel mehr individualisieren»
Jahrhundertelang versuchte man, Epilepsiekranken mit Exorzismus ihre angeblichen «Dämonen» auszutreiben. Heute gibt es mehr als 30 wirksame Medikamente, präzisere Diagnostik und neue ...
Optimierung und Individualisierung der SMA-Behandlungsstandards
2017 wurde mit Nusinersen ein erstes vielversprechendes Therapeutikum für SMA in der Schweiz zugelassen und das Therapiefeld nachhaltig verändert. Mit einer neuen Tabletten-formulierung ...
Status quo für die Mehrheit und ein erster Durchbruch für wenige ALS-Betroffene
Seit der Einführung von Riluzol als erstes Medikament für die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) hat sich das Therapiefeld kaum verändert und musste viele wissenschaftliche Rückschläge ...