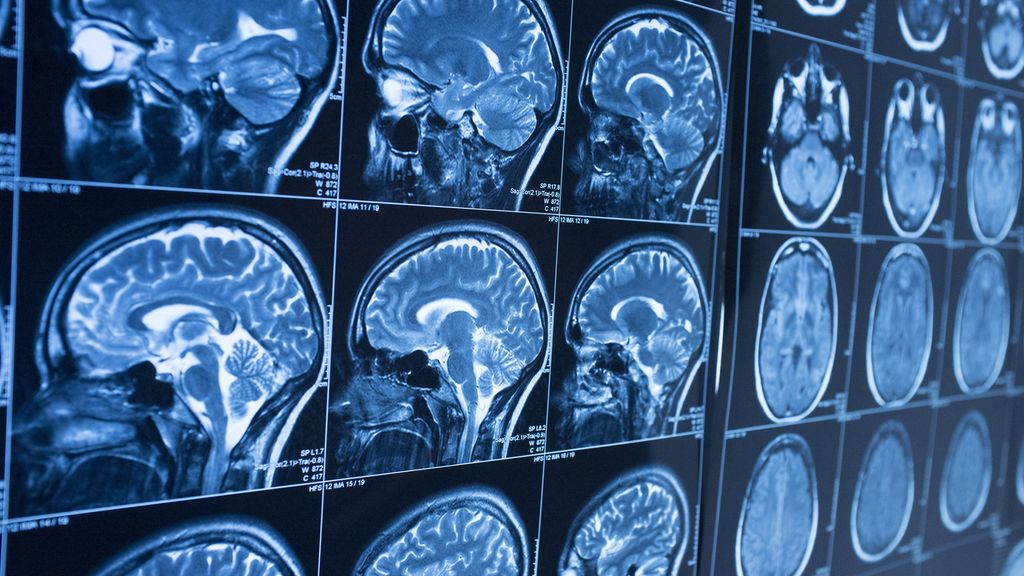
©
Getty Images/iStockphoto
Das Delir und seine Folgen – darum ist Intervention obligat
Jatros
Autor:
Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Iglseder
Abteilungsvorstand<br> Uniklinikum Salzburg<br> Christian-Doppler-Klinik<br> Universitätsklinik für Geriatrie der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, Salzburg
30
Min. Lesezeit
28.06.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Eine Vielzahl von körperlichen Erkrankungen kann Delirien auslösen. Die Vulnerabilität älterer Menschen gegenüber diesen Auslösern bewirkt, dass sie besonders häufig von einem Delir betroffen sind. Präventive Maßnahmen und eine effiziente Intervention haben bei der Vermeidung von Langzeitfolgen und der Reduktion der gesundheitsökonomischen Belastung besondere Bedeutung.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Das Delir ist ein hochrelevantes Zustandsbild, das neben einer erhöhten Komplikationsrate häufig kognitiv und funktionell schlechte Outcomes definiert.</li> <li>Es bedeutet zudem eine enorme ökonomische Belastung für das Gesundheitssystem.</li> <li>Evidenzbasierte Maßnahmen können die Inzidenz senken und den Verlauf mildern.</li> </ul> </div> <h2>Begriffsbestimmung, Symptome</h2> <p>Der Begriff Delir leitet sich vom Lateinischen „de lira ire = aus der Spur geraten“ ab und wurde von Aulus Cornelius Celsus etwa 100 nach Christus geprägt. Bereits 500 Jahre früher findet sich im Corpus Hippocraticum die Beschreibung zweier psychischer Störungen, die bei hohem Fieber und schweren körperlichen Erkrankungen auftreten: „Phrenitis“ (Erregung) und „Lethargus“ (Lethargie).</p> <p>Als Kernsymptome des Delirs sind Störungen von Kognition und Bewusstsein anzusehen, wobei die mögliche Ausprägung bis zum Koma reicht. Diagnostisch wegweisend ist die Unfähigkeit, Aufmerksamkeit zu richten, zu fokussieren und zu halten; die eingeschränkte Wahrnehmung von Umweltreizen und das inadäquate Reagieren auf solche Reize sind ebenfalls charakteristisch. Unter den kognitiven Störungen stehen Auffassungs- und Gedächtnisstörungen neben der häufig besonders auffälligen situativen Desorientiertheit im Vordergrund. Als Wahrnehmungsstörungen sind Verkennungen und optische, gelegentlich auch szenische Halluzinationen anzuführen; inhaltliche Denkstörungen im Sinne einer paranoiden Symptomatik sind im zeitlichen Verlauf meist fluktuierend. Psychomotorisch dominiert oft als Leitsymptom die Unruhe, es kann aber auch eine ausgeprägte Antriebsstörung vorliegen, wobei ein Wechsel zwischen diesen Ausprägungen häufig anzutreffen ist. Anhand der Ausprägung der Psychomotorik wird versucht, die hyperaktiven Delirien den hypoaktiven gegenüberzustellen, wobei die hypoaktiven Varianten häufig verkannt werden. Bis zu 40 % der Betroffenen weisen ein gemischtes Bild auf, tageszeitlich gibt es allenfalls eine geringe Akzentuierung in den Nachtstunden, aber keine eindeutige Präferenz. Daneben imponiert oft eine erheblich gesteigerte Schreckhaftigkeit, die besonders im Zusammenhang mit ärztlichen oder pflegerischen Interventionen auffällig wird. Der Beginn eines Delirs ist definitionsgemäß akut bis subakut (Stunden bis Tage) und steht nicht selten im Zusammenhang mit dem Auftreten einer körperlichen Erkrankung. Dabei ist anzumerken, dass die definitive Identifikation eines auslösenden Faktors häufig nicht gelingt, auch die Abgrenzung therapieassoziierter Delirien vom delirogenen Potenzial der Grundkrankheit ist nicht immer klar möglich. Die Dauer ist sehr variabel und reicht von wenigen Stunden bis zu Monaten, wobei die maximale Dauer der Störung definitionsgemäß 6 Monate beträgt. Meistens klingen delirante Zustände innerhalb von 1–2 Wochen wieder ab. Der Begriff „Delir“ wird im klinischen Alltag häufig durch synonyme Begriffe ersetzt: organisches Psychosyndrom, hirnorganisches Syndrom, akuter exogener Reaktionstyp, akute zerebrale Insuffizienz, Durchgangssyndrom oder Verwirrtheitssyndrom.</p> <p>Postoperative Delirien treten regelhaft zwischen dem 1. und 7. Tag nach der Operation auf. Grundsätzlich kann man das unmittelbare postoperative Immediatdelirium und das mit einer Latenz von bis zu einer Woche auftretende Intervalldelirium unterscheiden, bei Notfalloperationen ist das Risiko im Vergleich zu elektiven Operationen deutlich erhöht. Das Risiko eines präoperativen Delirs steigt bei hüftnahen Frakturen mit zunehmender Latenz zwischen Verletzung und Operation.</p> <p>Die Anfälligkeit alter Menschen gegenüber einer Vielzahl auslösender Störungen macht das Delir in hohem Ausmaß zu einer Erkrankung des Alters – das Delir ist die häufigste psychische Störung bei alten Menschen, ein typisches geriatrisches Syndrom, dem unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen können.</p> <p>Neben dem Alter ist als zweiter hochrelevanter Risikofaktor eine neurokognitive Beeinträchtigung (Demenz) zu nennen. Ein Delir gilt als häufigste Komplikation bei hospitalisierten alten Menschen, die Prävalenz wird mit 11–42 % angegeben, für hüftnahe Frakturen findet sich in Alterskollektiven eine Delirinzidenz von 10–65 % , am höchsten ist das Risiko auf Intensivstationen, wo 70 bis 87 % der alten Menschen ein Delir entwickeln.</p> <h2>Folgen</h2> <p>Die richtige Diagnose und ein adäquates Management sind für die Prognose der Betroffenen entscheidend. Die Prävention dieses komplexen, potenziell lebensgefährlichen Problems umfasst das Erkennen von Risikopatienten, Vermeiden von kausalen Faktoren sowie ein rechtzeitiges Reagieren auf Prodromalsymptome. Eine kausale Therapie, d.h. die Behandlung der auslösenden Erkrankung, ist ebenso unumgänglich wie pflegerische und milieutherapeutische Maßnahmen sowie gegebenenfalls eine symptomatische Behandlung.</p> <p>Ein Delir beeinträchtigt die Prognose der Betroffenen: Je länger ein Delir besteht und je schwerer der Verlauf ist, desto höher ist das Risiko für kognitive Folgeschäden: Insbesondere Patienten mit vorbestehendem neurokognitivem Defizit (Demenz) erreichen nach einer Delirepisode häufig nicht mehr das kognitive Ausgangsniveau.</p> <p>Ein Delir verlängert die Krankenhausaufenthaltsdauer aufgrund der Indexerkrankung durchschnittlich um eine Woche. Ebenso steigen das Risiko von Stürzen mit Verletzungsfolgen und das Risiko krankenhausassoziierter Infektionen. Die Letalität aufgrund der Indexerkrankung erhöht sich durch ein Delir auf das Doppelte. Patienten mit einem Delir haben nach der Krankenhausentlassung einen höheren Bedarf an Betreuung und ein höheres Risiko für die Aufnahme in ein Pflegeheim.</p> <p>Auch für Intensivstationen liegen Zahlen vor: Bei Vorliegen eines Delirs ist die Letalität während der Hospitalisierung (aber auch danach) mehr als doppelt so hoch (Ø 2,19x; p<0,001), es verlängern sich die Dauer des Aufenthalts auf einer ICU (Ø 1,38 d; p<0,001), die Krankenhausaufenthaltsdauer (Ø 0,97 d; p<0,001) und die Beatmungsdauer (Ø 1,79 d; p<0,001), zudem imponiert ein höherer Grad kognitiver Beeinträchtigung 3 und 12 Monate nach der Hospitalisierung.</p> <p>Ein Delir kann vollständig ausheilen, allerdings können die Symptome bei bis zu einem Drittel der Betroffenen persistieren, was Indikator einer schlechten Prognose ist.</p> <p>Aus diesen Fakten ergeben sich auch klarerweise ökonomische Folgen. Daten aus dem deutschen Sprachraum sind zu rar, um daraus ökonomische Rückschlüsse zu ziehen; für den Krankenhausbereich konnte in einer kleinen Untersuchung erhoben werden, dass Delirpatienten durchschnittlich etwa 240 Minuten an zusätzlichem Personalaufwand benötigen und errechnete Personal- und Sachkosten von etwa 1200 Euro während des stationären Aufenthaltes anfallen. Aus den Vereinigten Staaten liegen Zahlen vor, die Mehrbelastungen für das gesamte Gesundheitssystem von bis zu 150 Milliarden Euro pro Jahr schätzen. Untersuchungen aus Kanada zeigen, dass 48 % aller Patienten nach hüftnahen Frakturen ein Delir erleiden. Könnte man diese Zahl halbieren, betrüge das Einsparungspotenzial 3 079 000 € oder 45 288 Belagstage pro Jahr.</p> <h2>Prävention</h2> <p>Aufgrund der weitreichenden Folgen kommt der Prävention des Delirs eine herausragende Bedeutung zu. Proaktive geriatrische Konsultation konnte in einer randomisierten, kontrollierten Studie die Delirinzidenz nach hüftnahen Frakturen von 50 % auf 28 % senken: Die Empfehlungen beinhalten adäquate Sauerstoffzufuhr, Korrektur von Flüssigkeits- und Elektrolytstörungen, Behandlung von Schmerzen, Absetzen von unnötigen Medikamenten, frühes Entfernen von Blasenkathetern, adäquate Kalorienzufuhr, frühe Mobilisierung und Rehabilitation, Früherkennung und Behandlung von postoperativen Komplikationen, Vermeiden sensorischer Überstimulation und medikamentöse Behandlung bei hyperaktivem Delir.</p> <p>Das konsequente Vorgehen nach einem Protokoll, das Risikofaktoren wie Schlafmangel, Immobilität, sensorische Defizite sowie Pharmakotherapie und Dehydration kontrolliert, konnte eine Reduktion des Delirrisikos um bis zu 30 % bewirken, auch eine frühe Verlegung in eine ambulante Rehabilitation kann die Delirinzidenz signifikant verringern.</p> <p>Die Behandlung in einer spezialisierten geriatrischen Einheit reduziert das absolute Risiko um 20 % und verkürzt die durchschnittliche Dauer des Delirs um 5 Tage. Einzelne Prodromalsyndrome treten bei Hüftfrakturen bis zu 4 Tage vor dem Vollbild des Delirs auf und ermöglichen bei zeitgerechter Identifikation eine adäquate Intervention.</p> <h2>Intervention</h2> <ul> <li>Vermeiden kausaler Faktoren: unnötige Hospitalisierung, Polypharmakotherapie</li> <li>Rechtzeitiges Erkennen von Prodromalsymptomen: Nervosität, lebhafte Träume, Schlaflosigkeit, passagere Halluzinationen</li> <li>Falls eine stationäre Aufnahme erforderlich ist, sollte von Anfang an geriatrisch qualifiziert betreut werden.</li> <li>Zum Standard einer guten Krankenhausbehandlung Demenzkranker, die besonders Delir-gefährdet sind, sollte die Möglichkeit einer ständigen Begleitung der Patienten durch ihre pflegenden Angehörigen oder andere nahe Bezugspersonen gehören. Diese Forderung bedeutet, dass alten, multimorbiden, kognitiv beeinträchtigten Menschen von der Aufnahme bis zur Entlassung eine Kontaktperson („Sitter“) zur Seite gestellt werden soll, die sie möglichst bei allen Untersuchungen, Wegen, Verlegungen etc. begleitet. So kann das Risiko für Delir und Desorientiertheit vermindert werden.</li> <li>Präoperativ sind Delir-Screening, Assessment von Demenz, Depression, Angsterkrankungen, Suchterkrankungen (Alkohol, Benzodiazepine, Nikotin), Identifikation von Delirien in der Vorgeschichte, geriatrisches Konsil und Medikamentencheck empfehlenswert.</li> <li>Perioperativ ist Stress so gering wie möglich zu halten; reorientieren, für Fragen Zeit geben und optimale Schmerztherapie ergänzen das Repertoire.</li> </ul> <p>Für diese Beispiele komplexer Interventionen liegen auch Ergebnisse aus einem Cochrane-Review vor, und zwar sowohl für konservative (RR: 0,63; 95 % CI: 0,43– 0,92) als auch für chirurgische Settings (RR: 0,71; 95 % CI: 0,59–0,85). Für eine medikamentöse Prävention, z.B. mit Haloperidol, ist die Evidenz dagegen wenig belastbar.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Optische Kohärenztomografie bei Multipler Sklerose – wie viel ist genetisch?
Mit der optischen Kohärenztomographie kann durch die Messung retinaler Schichtatrophie die neuroaxonale Schädigung bei Multipler Sklerose erfasst werden. Eine neue Studie gibt Einblick ...
APOE und Anti-Amyloid-Therapien: Genetik im klinischen Alltag
Mit der Zulassung der ersten krankheitsmodifizierenden Therapien hat ein Paradigmenwechsel in der Behandlung der Alzheimerkrankheit begonnen. Anti-Amyloid-Antikörper können den ...
Besondere Aspekte in der Behandlung älterer MS-Patient:innen
Mit der zunehmenden Verschiebung der Prävalenz von Patient:innen mit Multipler Sklerose in höhere Lebensdekaden rücken spezifische klinische und therapeutische Herausforderungen dieser ...


