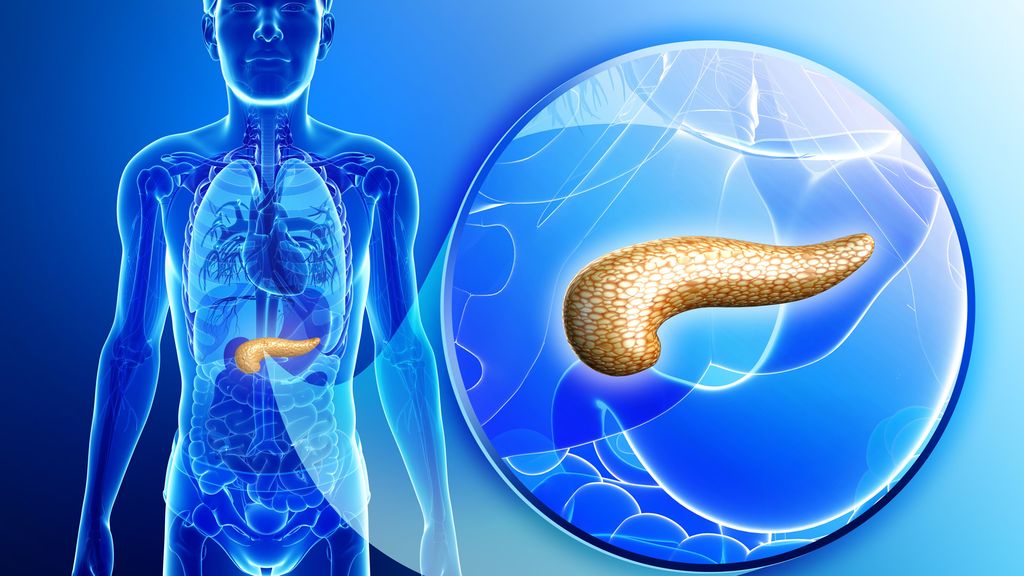
©
Getty Images/iStockphoto
Wer profitiert von bariatrischer Chirurgie?
Jatros
30
Min. Lesezeit
13.11.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Jahrestagung der Österreichischen Adipositas Gesellschaft wurde gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Adipositas- und Metabolische Chirurgie veranstaltet und stand im Zeichen von Prävention, Medikation und Operation. Bariatrische Chirurgie kann zu dramatischen Reduktionen des Körpergewichts führen und eine Remission eines Typ-2-Diabetes bewirken. Die Eingriffe bergen aber auch Risiken mit unerwünschten Spätfolgen. Die Indikationsstellung wurde daher intensiv diskutiert.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Aus der Sicht des Chirurgen kann nach jedem Eingriff von einem optimalen Ergebnis gesprochen werden, wenn der Eingriff ohne Probleme verläuft, wenn die Lebensqualität nach dem Eingriff nicht beeinträchtigt ist und wenn das Ziel des Eingriffs erreicht wurde. Im Falle der bariatrischen Chirurgie bedeutet das, dass es nicht zu schwerwiegenden postoperativen Komplikationen kommt, dass keine schwerwiegenden Spätkomplikationen auftreten und dass sich langfristig weder inadäquater Gewichtsverlust noch neuerliche Gewichtszunahme einstellen bzw. kein persistierendes oder rezidivierendes metabolisches Syndrom auftritt. Die Art der möglichen Komplikationen hängt vom gewählten Eingriff ab, so Prof. Dr. Stephan Kriwanek, Leiter der Chirurgischen Abteilung am Sozialmedizinischen Zentrum Ost – Donauspital, Wien, der sich in seinem Vortrag auf mögliche negative Aspekte konzentrierte.<br /> So ist die bariatrische Chirurgie mit einer nicht zu unterschätzenden Letalität verbunden, die mit 0,2 bis 0,5 % angegeben wird. Kriwanek: „Diese Gefahr durch die Operationen ist in den letzten Jahren jedoch deutlich gesunken.“ Ein sehr ausgeprägtes Übergewicht ist aber ein Risikofaktor für postoperative Komplikationen. Weitere prädisponierende Faktoren für ein ungünstiges Outcome sind männliches Geschlecht, höheres Alter, Diabetes und Schlafapnoe. Das Mortalitätsrisiko steigt mit der Zahl der Komorbiditäten. Kriwanek: „Bei vier Komorbiditäten liegt die Letalität des Eingriffs bereits bei sieben Prozent. Das bedeutet natürlich eine Kontraindikation für die Operation – auch wenn manche Patienten dazu durchaus bereit wären.“ Diese Faktoren müsse man, so Kriwanek, bei der Wahl des Eingriffs und der Planung der Operation berücksichtigen.</p> <h2>Hypoglykämie nach Magenbypass reduziert die Lebensqualität</h2> <p>Auch langfristige Komplikationen müssen bedacht werden. So führt eine Sleeve- Gastrektomie nach zehn Jahren bei mehr als der Hälfte der Patienten zu einem Reflux und bei 14 % zu einem Barrett-Ösophagus.<sup>1</sup> Man werde, so Kriwanek, erst sehen, was das in 20 bis 30 Jahren bedeute. Offen sei zum Beispiel, bei wie vielen Patienten Reoperationen erforderlich werden. Skandinavische Registerdaten zeigen auch hohe Rehospitalisierungsraten nach Magenbypass. Eine Reihe weiterer Komplikationen kommt vor. So zeigt eine Studie aus den USA, dass 3,9 % der Patienten Anastomosenulzera entwickeln.<sup>2</sup><br /> Ein besonderes Problem ist die postprandiale Hypoglykämie nach Magenbypass, von der laut Studiendaten nach fünf Jahren rund acht Prozent der Patienten nach Roux-en-Y-Magenbypass betroffen sind.<sup>3</sup> Diese stellt ein schwerwiegendes Problem dar, da sie bis zur Bewusstlosigkeit führen kann und die Lebensqualität der Betroffenen massiv reduziert. Unterschiedliche Reoperationen können erforderlich werden.</p> <h2>Mehrzahl der Patienten erreicht langfristige Gewichtsreduktion</h2> <p>Eine langfristige Gewichtsreduktion wird nach bariatrischen Eingriffen von einer Mehrzahl der Patienten erreicht. Aber nicht von allen. Eine Studie aus den 1990er-Jahren zeigte bei rund zehn Prozent der Patienten eine eingeschränkte Wirksamkeit des Eingriffs.<sup>4</sup> Bei einem Teil der Betroffenen waren technische OPFehler die Ursache, manche Patienten schafften es aber auch, den Magenbypass durch Snacking zu überlisten. Neuere Daten aus den USA zeigen, dass ca. 15 % der Patienten weniger als 40 % ihres Übergewichts verlieren.<sup>5</sup> Eine rezente Studie fand eine neuerliche Zunahme des kompletten abgenommenen Gewichts innerhalb von zehn Jahren bei rund zehn Prozent der Patienten. Betroffen waren Patienten mit deutlichen, vor allem kardialen, Komorbiditäten.<sup>6</sup> Ein Grund für die eingeschränkte Wirksamkeit der bariatrischen Operation könnte bei diesen Patienten ein durch die Herzkrankheit begründeter Bewegungsmangel sein.<br /> Nicht zuletzt wies Kriwanek auch auf den ökonomischen Aspekt der bariatrischen Chirurgie hin. Sie kann zu einer langfristigen Besserung von Adipositas, metabolischem Syndrom und Typ-2-Diabetes führen und ist daher für das Gesundheitssystem eine kostengünstige Alternative zu dauerhafter konservativer Therapie. Insgesamt stehen die erzielbaren Erfolge in einem sehr günstigen Verhältnis zu den Risiken.</p> <h2>Bariatrische Operationen senken langfristig die Mortalität</h2> <p>Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik von der 1. Medizinischen Abteilung der Krankenanstalt Rudolfstiftung wies auf Studiendaten hin, die bei Patienten nach bariatrischen Eingriffen eine deutliche Reduktion der Mortalität infolge von koronarer Herzerkrankung, Diabetes und Krebs zeigten.<sup>7</sup> Ludvik: „Es wurde sogar diskutiert, ob man mit bariatrischer Chirurgie den Typ-2-Diabetes heilen kann. Mittlerweile wissen wir allerdings, dass das nicht geht.“ Die Verbesserung zu quantifizieren ist nicht einfach, zumal die verfügbaren Vergleichsstudien mit älteren oralen Antidiabetika durchgeführt wurden und die Therapie damit nicht mehr dem heutigen Standard der Diabetologie entspricht. Studiendaten zeigen aber substanzielle Reduktionen des HbA<sub>1c</sub> über 24 Monate, je nach verwendeter Methode bis in den Normalbereich. Nach zwei Jahren war es nach der Chirurgie bei einem Großteil der behandelten Patienten zu Diabetesremissionen gekommen.<sup>8</sup> In der STAMPEDE-Studie konnte in einem Kollektiv adipöser Patienten mit unkontrolliertem Diabetes und einem Ausgangs-HbA<sub>1c</sub> von durchschnittlich 9,2 % bei rund 40 % der Patienten nach einem Jahr eine Remission erreicht werden.<sup>9</sup> Allerdings zeigte das Follow-up über fünf Jahre, dass der Diabetes bei einem Teil der Patienten mit der Zeit zurückkehrte.<sup>10</sup> Risikofaktoren für das Ausbleiben der Remission waren, so Ludvik, höheres Alter, längere Krankheitsdauer, höherer Bauchumfang, Insulinbedarf, geringerer Gewichtsverlust und höheres Ausgangsgewicht.<br /> Daten über einen langen Beobachtungszeitraum sind aus der prospektiven SOS-Studie verfügbar. Sie zeigen über 16 Jahre eine Reduktion der Mortalität durch die bariatrische Chirurgie. Diabetesremissionen wurden in dieser Studie nach zwei Jahren bei rund 70 % der Patienten erreicht, nach zehn Jahren befanden sich noch etwas über 30 % in Remission. Ebenso wurde bei adipösen Patienten ohne Diabetes die Inzidenz eines manifesten Diabetes reduziert, wobei die Erfolge ebenfalls nach zwei Jahren deutlicher waren als nach zehn Jahren. Die SOS-Studie zeigte auch eine substanzielle Reduktion der Inzidenz von Krebserkrankungen – dies allerdings nur bei Frauen. Ludvik: „Das sind mit Sicherheit hormonabhängige Tumoren. Man muss allerdings auf das Kolonkarzinom achtgeben, denn dessen Inzidenz wird durch den Magenbypass erhöht.“ Bemerkenswerterweise zeigt die SOS-Studie, dass Patienten mit höherem oder niedrigerem Ausgangs-BMI gleichermaßen von der bariatrischen Chirurgie profitieren.<sup>11</sup></p> <h2>Indikationsstellung anhand des Stoffwechsels, nicht des BMI</h2> <p>Es gibt aber eine Grenze, unter der der Patient nicht mehr von einem bariatrischen Eingriff profitiert. Für den BMI wurde versucht, diese Indikationsgrenzen zu modellieren. Dazu wurde das jährliche Sterberisiko in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und BMI ebenso herangezogen wie die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 30 Tagen nach einem bariatrischen Eingriff zu versterben. Die Berechnung zeigt beispielsweise, dass ältere Patienten ohne Diabetes nicht operiert werden sollen. Auch beim Diabetiker steigt das Risiko mit dem Alter. Es mehren sich die Hinweise, dass bei der Indikationsstellung zur bariatrischen Chirurgie das Körpergewicht nicht ausschlaggebend sein sollte. Der BMI erwies sich nämlich nicht als Prädiktor in Hinblick auf die Wirksamkeit des Eingriffs bezüglich eines der untersuchten Endpunkte. Als guter Prädiktor für die Wirkung der Operation auf Mortalität, kardiovaskuläre Ereignisse und Diabetesinzidenz erwies sich der Insulinspiegel. Ludvik: „Ein hoher Insulinspiegel bedeutet eine ausgeprägte Insulinresistenz.“ Diese Ergebnisse legen, so Ludvik, nahe, dass die Empfehlungen für die bariatrische Chirurgie angepasst werden sollten. Um jene Patienten zu identifizieren, die am meisten von einem bariatrischen Eingriff profitieren, sollte mehr Augenmerk auf metabolische Parameter und weniger auf den BMI gelegt werden.<br /> Ludvik wies auch darauf hin, dass sich neue Entwicklungen auf dem Medikamentensektor in den nächsten Jahren als echter „game changer“ entpuppen könnten: „Wir wissen, dass die Wirkung der bariatrischen Chirurgie nicht nur auf Restriktion und Malabsorption beruht, sondern auch auf der Beeinflussung der Sekretion verschiedener Peptidhormone im Darm. Analoga des Peptidhormons GLP1 werden bereits in der Diabetestherapie genützt. In Studien werden jetzt allerdings bereits duale Agonisten von Peptidhormon-Rezeptoren untersucht. Mit ihnen werden dramatische Reduktionen sowohl des Körpergewichts als auch des HbA<sub>1c</sub> erreicht. Ich denke, dass wir in ein paar Jahren Medikamente haben werden, mit denen Sie das Körpergewicht um 20 % reduzieren können – dies allerdings nur, wenn sie lebenslang injiziert werden.“</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Gemeinsames Symposium der Österreichischen Adipositas
Gesellschaft und der Österreichischen Gesellschaft für
Adipositas- und Metabolische Chirurgie im Rahmen der
gemeinsamen Jahrestagung der Österreichischen Adipositas
Gesellschaft und der Österreichischen Gesellschaft
für Adipositas- und Metabolische Chirurgie, 19. Oktober
2018, Wien
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Felsenreich DM et al.: Obes Surg 2018; 28(11): 3586-94 <strong>2</strong> Schulman AR et al.: Obesity (Silver Spring) 2017; 25(3): 522-6 <strong>3</strong> Raverdy V et al.: Ann Surg 2016; 264(5): 878-85 <strong>4</strong> Kriwanek S et al.: Langenbecks Arch Chir 1995; 380(2): 70-4 <strong>5</strong> American Gastroenterological Association: Gastroenterology 2002; 123(3): 879-81 <strong>6</strong> Hawkins RB et al.: Surg Obes Relat Dis 2017; 13(10): 1710-6 <strong>7</strong> Adams TD et al.: N Engl J Med 2007; 357(8): 753-61 <strong>8</strong> Mingrone G et al.: N Engl J Med 2012; 366(17): 1577-85 <strong>9</strong> Schauer PR et al.: N Engl J Med 2012; 366(17): 1567-76 <strong>10</strong> Schauer PR et al.: N Engl J Med 2017; 376(7): 641-51 <strong>11</strong> Sjöström L: J Intern Med 2013; 273(3): 219-34</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...
Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil
Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...


