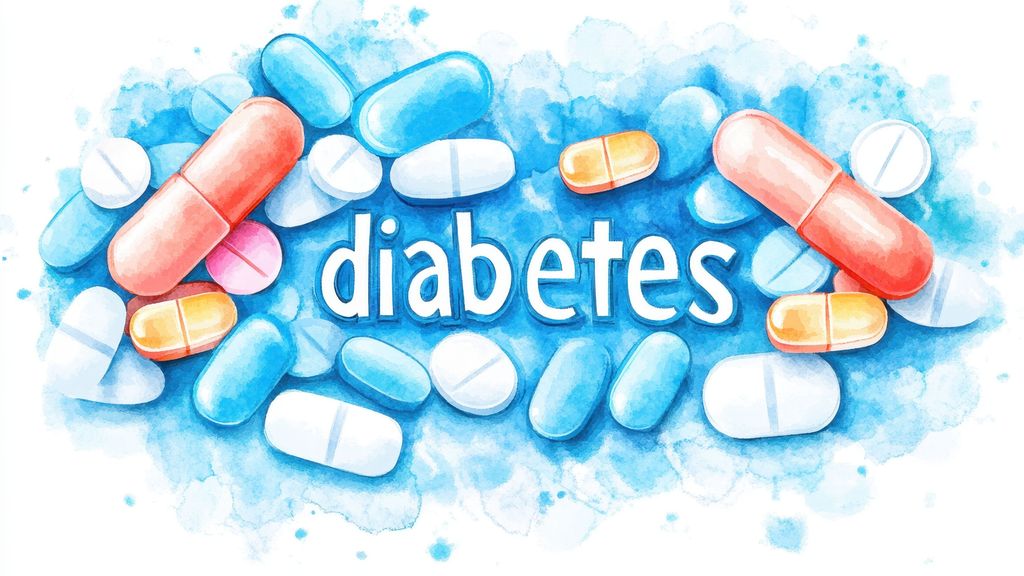
Vergessene Antidiabetika: In schwierigen Situationen können die 4G hilfreich sein
Bericht:
Claudia Benetti
Medizinjournalistin
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die neuen oralen Antidiabetika, insbesondere die GLP-1-Rezeptor-Agonisten und die SGLT2-Inhibitoren, haben die Diabetestherapie grundlegend verändert und früher etablierte Medikamente aus dem Alltag verdrängt. Doch die 4G – Gliptine, Gliclazid, Glinide und Glitazone – können in speziellen Situationen nach wie vor hilfreich sein, wie Prof. Dr. med. Peter Wiesli, Chefarzt Innere Medizin, Kantonsspital Frauenfeld, am FOMF Diabetes Update Refresher erklärte.
Keypoints
-
Gliptine (DPP-4i) sind eine Alternative zu GLP-1-RA bei BMI <28kg/m2.
-
Gliclazid kann in besonderen Situationen zur Überbrückung eine Alternative zu Basalinsulin sein.
-
Glinide sind eine Alternative zu Bolusinsulin, wenn eine zusätzliche Injektion abgelehnt wird.
-
Glitazone stellen in Kombination mit einem SGLT2i oder einem GLP-1-RA grundsätzlich eine Option bei Insulinresistenz dar (in Ausnahmefällen).
-
Insulin soll nicht kombiniert werden mit Gliclazid, Gliniden oder Pioglitazon.
Gliptine (DPP-4i): Alternative zu GLP-1-RA
Die Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie, SGED, empfiehlt für die Behandlung des Typ-2-Diabetes (DT2) im ersten Schritt die Kombination von Metformin mit einem SGLT2-Inhibitor (SGLT2i) oder einem GLP-1-Rezeptor-Agonisten (GLP-1-RA).1 Von den früher etablierten Antidiabetika werden nur noch die Gliptine (DPP-4-Hemmer, DPP-4i) erwähnt. Diese Medikamente waren vor einigen Jahren nach Metformin noch das Antidiabetikum der ersten Wahl. Heute werden sie vor allem als Alternative zu den GLP-1-RA eingesetzt, zum Beispiel bei einem BMI unter 28kg/m2 oder bei Unverträglichkeit.
Die anderen noch verfügbaren alten Antidiabetika – Glinide, Glitazone und Gliclazid – wurden in den Schweizer Diabetesleitlinien aber nicht etwa vergessen. «Sie wurden bewusst nicht mehr erwähnt, weil sie nur noch selten eingesetzt werden», erklärte Wiesli. In speziellen, verzwickten Situationen können sie aber auch heute noch eine wichtige Rolle spielen.
Gliclazid: vorübergehende Alternative zu Basalinsulin
So zum Beispiel bei Patient:innen mit Insulinmangel und einer entgleisten Stoffwechsellage. «Primär wird in dieser Situation natürlich mit Insulin behandelt», erklärte Wiesli. Wenn es aber Freitagnachmittag ist, fehlt in der Regel die Zeit, um eine ambulante Insulinbehandlung mit all den nötigen Instruktionen zu initiieren. Auch bei fremdsprachigen Patient:innen kann es unmöglich sein, sofort eine Insulintherapie zu starten, wenn kein:e Dolmetscher:in zur Verfügung steht. In diesen Fällen ist das Gliclazid (noch im Handel: Diamicron Uno®) eine Alternative. Mit dem Medikament lässt sich die nötige Zeit gewinnen, um in Ruhe den Diabetestyp abzuklären und das längerfristige Management zu bestimmen.
Die Wirkung von Gliclazid tritt schnell ein und die Dosis muss nicht auftitriert werden. Sobald die Stoffwechsellage kompensiert ist, kann es gestoppt werden. «Gliclazid ist gut verträglich, es wirkt schnell und gut und ist preisgünstig. Es kann aber Hypoglykämien verursachen und soll deshalb nicht mit Insulin kombiniert werden, es führt zu einer Gewichtszunahme und die Wirkung ist nicht anhaltend2», so der Referent. Aus diesem Grund spielt das Gliclazid heute nur noch in Spezialsituationen als vorübergehende Alternative zu einem Basalinsulin oder bei MODY eine Rolle.
Insulinmangel: Klinik und Behandlung
Ein Insulinmangel ist typisch für einen Typ-1-Diabetes (DT1), kommt aber auch bei DT2 vor. Er tritt häufig bei schlanken Menschen und bei langer Diabetesdauer auf. Typische klinische Zeichen des Insulinmangels sind Polyurie, Polydipsie, Gewichtsabnahme sowie eine entgleiste Stoffwechsellage. Hinweise auf einen Insulinmangel können Erkrankungen des exokrinen Pankreas (z.B. chronische Pankreatitis), positive Autoantikörper (DT1), eine Ketonämie/Ketonurie sowie eine C-Peptid/Glukose-Ratio (CGR) <40 sein.
Die primäre Behandlung bei Insulinmangel besteht in der Gabe von Insulin. Bei DT2 mit Insulinmangel kann gleichzeitig die Behandlung mit Metformin in Kombination mit einem GLP-1-RA gestartet werden. Diese Medikamente müssen aber langsam auftitriert werden. Die Dosis von Metformin muss alle 7 Tage, diejenige des GLP-1-RA alle 4 Wochen angepasst werden. Bei einer entgleisten Stoffwechsellage sind deshalb die Gliptine, die DPP-4i, eine gute Alternative, weil sie von Beginn an voll dosiert werden können. Falls der Beginn einer Behandlung mit Basalinsulin nicht möglich ist, ist wie oben erwähnt die Gabe von Gliclazid zusätzlich zu Metformin und einem DPP-4i eine gute Option.
Ketoazidose
SGLT2i dürfen bei Insulinmangel wegen des Risikos für eine Ketoazidose nicht gegeben werden. Die Zeichen einer Ketoazidose sind unspezifisch. Dazu gehören Übelkeit/Erbrechen, Dyspnoe/Tachypnoe, Kussmaul’sche Atmung sowie Bauchschmerzen und ein schlechter Allgemeinzustand. Risikofaktoren sind Insulinmangel (z.B. Erstdiagnose eines Typ-1-Diabetes, pankreopriver Diabetes, Absetzen von Insulin), verminderte Glukoneogenese (z.B. bei hohem Alkoholkonsum), reduzierte Zufuhr von Kohlenhydraten (z.B. Fasten, Gastroenteritis) sowie Stress (z.B. Operation, extreme körperliche Aktivität). Behandelt wird eine Ketoazidose mit Insulin und Flüssigkeit. Ist der Blutzucker normal, muss zusätzlich Glukose infundiert werden. «Ketonkörper im Kapillarblut können auch in der Hausarztpraxis einfach gemessen werden», so Wiesli. Es lohnt sich, das entsprechende Gerät anzuschaffen.
Glinide: wenn ein zusätzliches Bolusinsulin abgelehnt wird
«Glinide sind im Prinzip kurz wirksame Sulfonylharnstoffe», erläuterte Wiesli. So wie das Gliclazid eine Alternative zum lang wirksamen Basalinsulin ist, ist das Repaglinid eine Alternative für das kurz wirksame Bolusinsulin. Es kann auch bei Niereninsuffizienz eine Option sein. Die Nebenwirkungen entsprechen denjenigen der Sulfonylharnstoffe (Hyoglykämien, Gewichtszunahme). Ein Nachteil der Glinide ist, dass sie zu jeder Mahlzeit eingenommen werden müssen. «Dies ist auch der Grund, warum sich diese Medikamente auch zu Zeiten der Sulfonylharnstoffe nie richtig durchgesetzt haben», so der Spezialist. Grundsätzlich wäre Repaglinid aber eine Option für Patient:innen mit einem starken postprandialen Blutzuckeranstieg, z.B. immer nach dem Abendessen, die nicht gewillt sind, zu dieser Mahlzeit ein zusätzliches Bolusinsulin zu applizieren.
Glitazone: eine Option bei Insulinresistenz
Eine weitere «vergessene» Medikamentenklasse sind die Glitazone. Sie werden praktisch nicht mehr verwendet. In der Schweiz ist noch das Pioglitazon erhältlich. Häufige Nebenwirkungen sind Gewichtszunahme, Flüssigkeitsretention (Ödeme) und periphere Frakturen (nur bei Frauen). Es gibt Assoziationen mit einem erhöhten Herzinsuffizienzrisiko, dem Makulaödem und möglicherweise mit Harnblasenkarzinomen. Die generelle Empfehlung lautet deshalb heute, dass Pioglitazon abgesetzt werden soll.
In den Therapieempfehlungen für den DT2 der amerikanischen und europäischen Gesellschaften ADA und EASD von 2024 werden die Glitazone jedoch für Patient:innen mit einer etablierten kardiovaskulären Erkrankung oder einem erhöhten kardiovaskulären Risiko nach den GLP-1-RA und SGLT2i als weitere Option erwähnt.3 Diese Empfehlung basiert auf einer Metaanalyse von prospektiven Studien mit Pioglitazon.4 Sie zeigte eine signifikante Reduktion des Risikos für den 3-Punkte-MACE (kombinierter Endpunkt aus Myokardinfarkt, Schlaganfall, kardiovaskulärer Tod) um 14% und des Schlaganfallrisikos allein um 23%. In der Metaanalyse wurde keine Zunahme von Krebs, Frakturen insgesamt, Makulaödem und Blasenkarzinom beobachtet. Erhöht war das Risiko für Herzinsuffizienz beziehungsweise für die Hospitalisation wegen Herzinsuffizienz sowie nur bei Frauen auch das Risiko für Frakturen und Anämie. Pioglitazon sollte wegen der Nebenwirkungen nur in einer niedrigen Dosis und nur in Kombination mit einem SGT2i oder einem GLP-1-RA verschrieben werden.
Eine Option kann Pioglitazon bei einer Insulinresistenz sein. Wiesli empfahl allerdings, Pioglitazon nur in Rücksprache mit einer Diabetologin oder einem Diabetologen zu verschreiben. Pioglitazon sollte möglichst niedrig dosiert werden, idealerweise wird es kombiniert mit einem SGLT2i (bei Herzinsuffizienz) oder einem GLP-1-RA (bei Gewichtsproblemen), aber wenn möglich nicht mit Insulin. Die Wirkung tritt erst nach einigen Wochen ein.
Insulinresistenz
«Wenn Patient:innen mehr als 0,5E/kgKG Basalinsulin spritzen müssen oder ihr Tagesinsulinbedarf mehr als 1E/kgKG beträgt, ist dies ein Hinweis auf eine Insulinresistenz», erklärte Wiesli.Auch bei einer C-Peptid-/Glukose-Ratio >100, bei Inaktivität, einer Steroidtherapie, hohen Triglyzeridwerten sowie einer Acanthosis nigricans muss an eine Insulinresistenz gedacht werden. Lipohypertrophien vermindern die Wirkung von Insulin ebenfalls, es liegt hier aber keine Insulinresistenz vor.
Bei Patient:innen mit Insulinresistenz wirken Bolus- besser als Basalinsuline. Manchmal bringen auch konzentrierte Insuline (z.B. Glargin300, Degludec200, Lispro200) bessere Therapieresultate. Auch Metformin, SGLT2i und GLP-1-RA sind bei Insulinresistenz hilfreich sein.
Quelle:
FOMF Diabetes Update Refresher, 7. bis 9. November 2024, Zürich
Literatur:
1 Gastaldi G et al.: Swiss recommendations of the Society for Endocrinology and Diabetes (SGED/SSED) for the treatment of type 2 diabetes mellitus (2023). Swiss Med Wkly 2023; 153: 40060 2 Nathan DM et al.: Glycemia reduction in type 2 diabetes - glycemic outcomes. N Engl J Med 2022; 387: 1063-74 3 American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes-2024. Diabetes Care 2024; 47 (Suppl 1): S158-78 4 Sinha B et al.: Assessing the need for pioglitazone in the treatment of patients with type 2 diabetes: a meta-analysis of its risks and benefits from prospective trials. Sci Rep 2020; 10: 15781
Das könnte Sie auch interessieren:
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...
Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil
Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...


