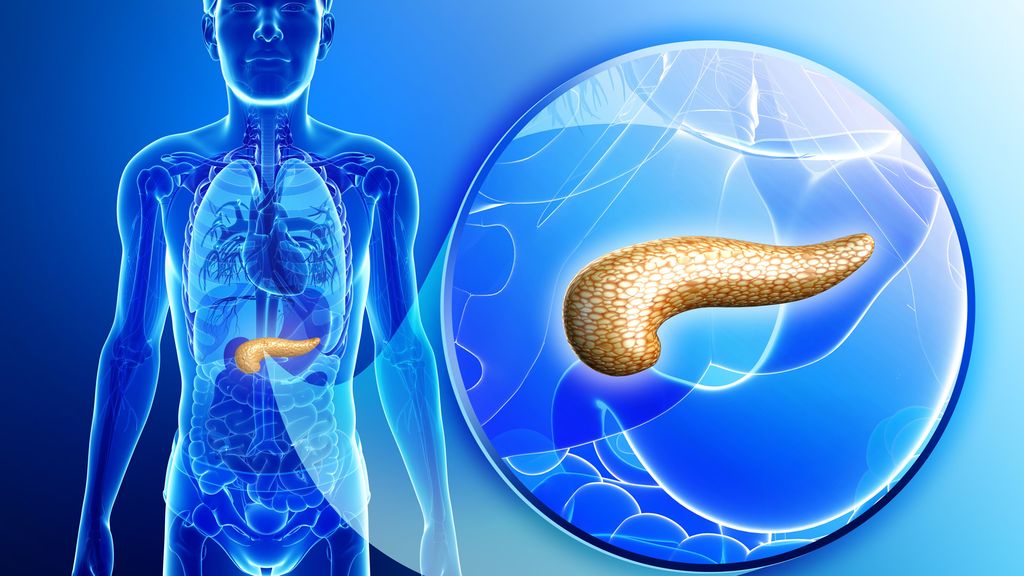
©
Getty Images/iStockphoto
Die neue Initiative „Diabetes und Ihr Herz“
Jatros
30
Min. Lesezeit
08.03.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Initiative „Diabetes und Ihr Herz“ hat sich zum Ziel gesetzt, Betroffenen, aber auch interessierten Personen den Zusammenhang zwischen Diabetes und Herzerkrankungen bewusst zu machen. Zwei Protagonisten der Initiative stellen im Interview klar, weshalb es so wichtig für Arzt, Patient und Angehörige ist, sich darüber Gedanken zu machen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Welche Bedeutung hat die Krankheit Diabetes in Österreich?<br /><br /> <em>R. Weitgasser:</em> Sieht man sich die Zahl der betroffenen Typ-2-Diabetiker an, so wurde diese vor 6–7 Jahren auf rund 650 000 Menschen in Österreich geschätzt. Genaue Daten haben wir leider nicht. Da die Zahl der Erkrankungen steigt, geht der aktuelle Österreichische Diabetesbericht 2017 von einer Zahl von bis zu 809 000 Betroffenen aus. In Anbetracht dessen, dass Österreich etwa achteinhalb Millionen Einwohner hat, ist das also eine ganze Menge. Betrachtet man etwa die Patientenklientel unserer Abteilung für Innere Medizin, so hat bei einem durchschnittlichen Patientenalter von etwa 75 Jahren heute schon jeder Zweite bis jeder Dritte einen Diabetes. Anhand dieses Beispiels wird klar, dass es sich um eine kostenintensive Erkrankung handelt. Hinzu kommt natürlich das Leiden jedes einzelnen Patienten unter der Erkrankung. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es sich um eine progrediente Erkrankung handelt.<br /><br /> <em><br /><strong>C. Francesconi:</strong></em> Aus den genannten Zahlen geht also hervor, dass knapp 8 % der Bevölkerung wissentlich oder unwissentlich betroffen sind. Da rund die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig ober adipös ist, ist das Potenzial für eine noch weitere rasche Verbreitung des Typ-2-Diabetes gegeben. Aus medizinischer Sicht ist das eine Riesenaufgabe, nicht nur für das Gesundheitssystem, sondern auch für die Gesamtbevölkerung, weil natürlich abgesehen vom Leiden des Einzelnen der sozioökonomische Faktor sehr wichtig ist. Aus meiner Sicht ist in dieser Hinsicht vor allem die Frage der integrierten Versorgung noch lange nicht geklärt. Außerdem ist die Versorgung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und für die betroffenen Patienten auch nicht zufriedenstellend.<br /> <br /><strong>Wie ist es um das Wissen der Österreicher rund um das Thema Diabetes bestellt, insbesondere bei oder vor Diagnosestellung?<br /><br /> <em>C. Francesconi:</em></strong> Ich sehe in meinem Alltag, dass, bedingt durch die Vielzahl von Kampagnen, die in den letzten Jahren besonders auch von der ÖDG, aber auch von Selbsthilfegruppen und der Diabetesinitiative gemacht wurden, sich insgesamt die Awareness in der Bevölkerung in Bezug auf den Begriff Diabetes stark verbessert hat.<br /><br /> <em><br /><strong>R. Weitgasser:</strong></em> Das sehe ich genauso. In den letzten Jahren haben sich neben den genannten Organisationen auch die betreuenden Hausärzte sehr um die Information der Bevölkerung bemüht, sodass das Wissen recht gut ist. Diabetes kennt eigentlich jeder. Im Detail fehlt aber noch das Wissen über Diabetes in Kombination mit anderen Risikofak­toren. <br /> <br /><strong>Wie steht es bei diagnostizierten Diabetikern um ihr Wissen in Bezug auf das kardiovaskuläre Risiko im Zusammenhang mit Diabetes?<br /><br /> <em>C. Francesconi:</em></strong> Der direkte Zusammenhang zwischen Typ-2-Diabetes und der Entstehung von Gefäßkomplikationen im Allgemeinen und speziell Herzkomplikationen ist noch viel zu wenig bei den Patienten angekommen. Hier höre ich nach den Schulungen immer wieder, dass Betroffene sagen: „Aha, das habe ich gar nicht gewusst.“ Für die meisten Betroffenen ist es schon gut, wenn der Hausarzt den Blutzucker halbwegs gut im Griff hat. Dass auch der Blutdruck und vor allem die Lipide, hier im Speziellen das LDL-Cholesterin, eine wichtige Rolle schon im Vorfeld der Entstehung des Diabetes spielen und insbesondere bei der Entstehung von Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. wichtig sind, ist bei den meisten überhaupt nicht im Bewusstsein verankert.<br /><br /> <em><br /><strong>R. Weitgasser:</strong></em> Genau diese Erfahrungen machen wir auch bei unseren Patienten, die regelmäßig in der Ambulanz betreut werden oder stationär aufgenommen sind, und deren Angehörigen. Fragt man da genauer nach, sieht man, dass der Diabetes nicht so ohne Weiteres mit kardiovaskulären Risikofaktoren in Verbindung gebracht wird. Sie wissen zwar, dass bei Diabetes mehr Herzinfarkte und mehr Schlaganfälle auftreten. Dass aber gerade die dafür relevanten Faktoren wie Hyperlipidämie und arterielle Hypertonie im Sinne eines metabolischen Syndroms bei den meisten Diabetes-Typ-2-Patienten kombiniert vorliegen, ist den Betroffenen nicht bewusst. Verinnerlicht ist die Meinung: Wenn der Zucker wieder etwas besser ist, passt das schon. Patienten zu motivieren und auch darüber aufzuklären, dass auch andere Faktoren wie eine gute Blutdruckeinstellung oder eine lipidsenkende Therapie sowie die Umstellung des Lebensstils notwendig sind, ist nicht einfach, weil es den Menschen ganz einfach nicht klar ist. Das ist mit ein Grund für die neue Initiative „Diabetes und Ihr Herz“. <br /> <br /><strong>Welche Ziele verfolgt die Initiative?<br /><br /> <em>R. Weitgasser:</em></strong> Wichtig ist die Aufklärung, dass es diese Faktoren gibt und dass diese mit gleicher Priorität wie der Diabetes behandelt werden müssen. Wir möchten Betroffene auch darüber informieren, dass es mittlerweile gute Medikamente gibt, die auf diese Risikofaktoren wirken, dadurch die Morbidität und Mortalität reduzieren und zugleich die Einstellung des Diabetes verbessern. Die Initiative ist zwar primär auf Patienten ausgerichtet, aber auch bei unseren ärztlichen Kollegen erhoffen wir uns einen Impact. So dauert es immer noch relativ lange, bis bei kardiologischen Patienten der Diabetes diagnostiziert ist. Leider wird im Zuge einer KHK-Diagnose, bei einem Herzinfarkt nicht immer daran gedacht, einen HbA1c-Wert oder die Zuckerwerte zu überprüfen oder einen OGTT durchzuführen. Bei den Lipiden wiederum liegt es eher daran, dass die Zielwerte oft nicht erreicht werden und dass die am häufigsten verschriebenen Medikamente, die Statine, von den Patienten oft nach einer Zeit nicht mehr eingenommen werden. Das hat zwei Gründe – einerseits die fehlende Symptomatik, andererseits der Vorbehalt der Patienten gegenüber diesen Medikamenten wegen möglicher Nebenwirkungen. Zwar wurden Statine bereits millionenfach eingesetzt, dennoch kämpfen wir darum, unsere Patienten zur dauerhaften Einnahme zu motivieren. Die schlechte Meinung dazu wird oft von Bekannten transportiert, treten dann auch noch Muskelschmerzen auf, ist es oft aus mit der Einnahme. Dabei war der Betroffene eventuell nur am Vortag Tennis spielen – eine befürchtete echte Myopathie liegt oft gar nicht vor.<br /><br /> <em><br /><strong>C. Francesconi:</strong></em> Die unterschiedlichen Kampagnen der Initiative bringen zunächst einmal die Aufmerksamkeit der Betroffenen und führen die Leute dann dazu, dass sie mehr wissen wollen, um ihr eigenes Risiko für sich herunterfahren zu können, und das könnte den Anstoß dazu geben, dass Patienten auch aktiv Aufklärung und Schulung bei den Ärzten einfordern, was sehr schön wäre. Für die behandelnden Ärzte ist es wichtig, im Erstgespräch mit dem Patienten das Risiko in simplen Worten zu erklären – was den Patienten dazu befähigt, viele Therapien auch zu verstehen und zu akzeptieren, dass das so sein soll und so sein muss. Man könnte in sehr kurzer Zeit die Akzeptanz des Patienten für seine Medikamente stark erhöhen, wenn man das von Anfang an zum Thema macht und auch anspricht.<br /> <br /><strong>Ein wichtiger Punkt von „Diabetes und Ihr Herz“ ist also die Motivation der Betroffenen?<br /><br /> <em>C. Francesconi:</em></strong> Ja, und damit auch die Erkenntnis, dass die Therapie eine lebenslange Herausforderung darstellt. Dass sie oft schon vor der Manifestation, wenn man schon offensichtlich sieht, der Patient geht in Richtung Typ-2-Diabetes, eine Option ist, um das Risiko zu minimieren. Dass diese Therapie oft eine lebenslange ist, die immer wieder adaptiert werden muss, um ihr Ziel zu erfüllen. Dass es große Unterschiede in den Auswirkungen einzelner Medikamente auf die Risikoreduktion gibt, ist für die Patienten, wie ich glaube, wirklich noch ein Buch mit sieben Siegeln. Da spielt die Schulung natürlich eine ganz wichtige aufklärende Rolle.<br /><br /> <em><br /><strong>R. Weitgasser:</strong></em> Und das ist gar nicht so einfach. Das Wichtige ist, in der Diabetesschulung des Patienten darauf hinzuweisen, dass es sich um eine sehr lange, meist lebenslange Beibehaltung der Medikation handelt und nicht um eine, die man eine Zeit lang nimmt oder reduzieren kann und schließlich absetzt. Schon gar nicht alleine, ohne den Arzt zu konsultierten. Diese Aufklärung ist zwar in unseren aktuellen Schulungsprogrammen enthalten, aber es fehlt noch der Fokus auf die Patientenmotivation.<br /> Verständlicherweise will nicht jeder eine Handvoll Medikamente in der Früh und am Abend einnehmen. Aber wenn man die Evidenz des Risikos bzw. der Risikoreduktion betrachtet, dann sind Medikamente, die das kardiovaskuläre Risiko reduzieren, für einen Patienten mit Diabetes Typ 2 einfach notwendig. Dazu gehören geeignete Antidiabetika, eine Medikation für die Hypertonie- und Lipidsituation sowie häufig noch ein Thrombozytenaggregationshemmer. Das sind halt dann 3, 4 oder 5 unterschiedliche Medikamente. Ich halte es zur Motivation der Patienten für sehr wichtig, sie aufzuklären, dass dies Medikamente sind, die sehr gut wirken, insgesamt wenige Nebeneffekte haben, auf jeden Fall eine Langzeittherapie sind; und dass es wichtig ist, dass man sie nicht intermittierend nimmt, weil sie sonst ihre Wirkung nicht entfalten können. Eines der Hauptprobleme mit unseren Patienten ist, dass wir sie nach einer Spitals- oder Ambulanzentlassung lange nicht sehen und sie oftmals später in einer Akutsituation mit exorbitanten Werten vorstellig werden, weil sie 2 oder 3 Medikamente weggelassen haben, da sie sich gedacht haben: „Ich spüre ja nichts; ich brauche das nicht.“ Die Leute wissen wahrscheinlich, dass die Medikamente protektiv wirken, aber sie verinnerlichen es vermutlich nicht. An der notwendigen Adhärenz auch in Bezug auf den Lebensstil müssen wir dringend arbeiten.<br /> <br /><strong>Welche Aktivitäten von „Diabetes und Ihr Herz“ gab es bisher?<br /><br /> <em>R. Weitgasser:</em></strong> Da gab es einiges – etwa einen prominent besetzten Spot, der nicht nur im Fernsehen lief, sondern auch auf dem Info-Screen, also jenen Bildschirmen, die in U-Bahn-Stationen, zum Teil aber auch in Bus und Straßenbahnen zu finden sind. Außerdem gibt es Flyer, die vor allem über die Diabetesvereinigungen weitergegeben wurden, aber auch an Ärzte zur Auflage in ihren Arztpraxen. Den TV-Spot konnte übrigens auch jeder Teilnehmer der ÖDG-Jahrestagung sehen – er lief ja oft in den Pausen. Es gibt natürlich auch eine entsprechende Homepage mit Informationen, auf der Fragen zu finden sind, die jeder Diabetiker dem behandelnden Arzt stellen sollte.<br /><br /> <em><br /><strong>C. Francesconi:</strong></em> Ein wichtiger Teil dieser Homepage sind nicht nur die Fragen und die recht einfach gehaltenen Informationen für die Patienten direkt auf der Homepage, sondern insbesondere die Links vor allem zur Homepage von ÖDG und „Face Diabetes“, wo ja auch die Risk-Scores zu finden sind oder wo ein Quiz gemacht werden kann. So ist man als Patient oder als Angehöriger eines Patienten relativ gut informiert, man erhält neben weiterführenden Informationen auch den Zugang zum ÖDG-Newsletter und erfährt Konkretes über Selbsthilfeorganisationen, wo man Gleichgesinnte trifft, wo man sich auch beraten lassen oder an Bewegungsgruppen etc. teilnehmen kann. Es wird also eine Fülle an guter Vernetzung und Information geboten.<br /> <br /><strong>Was können die behandelnden Ärzte im Hinblick auf die Herzgesundheit von Diabetikern tun?<br /><br /> <em>R. Weitgasser:</em></strong> Die großen Diabetesstudien der letzten Jahre haben gezeigt, dass manche Medikamente kardiovaskulär noch besser wirken als andere. Da diese Informationen so großes Aufsehen erregt haben, sind sie vielfach schon in den Köpfen der niedergelassenen Ärzte drin. Es ist auch wichtig, dass wir über die früher als glukozentrische Sicht bezeichnete Therapie hinausgehen. Alle Risikofaktoren, sei es Gewicht, wenig Bewegung etc., sollten bei vaskulären Patienten – mit einer TIA, einer Apoplexie, mit einer KHK, mit beginnenden peripheren vaskulären Veränderungen – bedacht werden. Dies trifft insbesondere auch auf psychiatrische Patienten zu. Es ist ja bekannt, dass ungefähr 30 % aller depressiven Patienten einen Diabetes haben und umgekehrt circa ein Drittel der Diabetespatienten unter Depressionen leidet. Es gibt also einen Faktor, der nicht unbedingt direkt der Kardiologie zuzuordnen ist, aber doch auch häufig damit verbunden ist. Wichtig ist auch das regelmäßige Follow-up. Patienten im DMP „Therapie Aktiv“ akzeptieren dieses, sonst fallen sie ja aus dem Programm. Bei Betroffenen außerhalb von „Therapie Aktiv“ oder ohne Hausarzt, der sie gut betreut, ist das natürlich viel problematischer. Die regelmäßige Betreuung durch den Hausarzt oder den Internisten sollte für jeden Patienten mit entsprechender Befundkonstellation auf jeden Fall gewährleistet sein. Gut wäre es natürlich, die Patienten in „Therapie Aktiv“ zu bringen. <br /> <br /><strong>Fragen von Patienten und niedergelassenen Kollegen drehen sich oft um Folgendes: Wie soll man Vorsorge abgesehen von der Untersuchung der Laborwerte und der klinischen Untersuchung betreiben? Ist es sinnvoll, eine Duplexuntersuchung der Karotis oder eine Ergometrie zu machen? In welchen Abständen ist ein Echo zu machen? Dazu kann man sagen, dass die Symptomatik entscheidend dabei ist. Bestehen keine Beschwerden, dann bringt es auch nichts, jedes Jahr die Füße mit Nervenleitgeschwindigkeitsuntersuchungen zu kontrollieren; hier reicht es, sich den klinischen Befund anzusehen. Ähnliches gilt auch für die oben genannten apparativen Untersuchungen. Es ist nicht nachgewiesen, dass diese einen Effekt haben, wenn noch kein Event, z.B. ein Infarkt, eingetreten ist. <br /><br /> <em>C. Francesconi:</em></strong> Ein wichtiger Aspekt ist, dass man die Kollegenschaft ins Boot bekommt. Für den Patienten ist ganz wesentlich, dass wir alle – die behandelnden Ärzte –, egal ob in einer Ambulanz, auf einer Station oder einer Ordination, das Gleiche sagen. Das Gleiche heißt auch, dass wir alle ungefähr auf dem gleichen Wissensstand sein müssen. Patienten sollten von allen Ärzten hören, dass sie ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko mit ihrer Grunderkrankung Diabetes haben und dass man dagegen etwas tun kann. Wir wissen, Bewegung ist das beste Werkzeug, das wir haben, um dieses Risiko zu reduzieren. Primär ist also, dass der Lebensstil, getragen von der Bewegung, etwas sein sollte, das man trotz der großen Evidenz für die Wirkung der Medikamente in der Therapie nicht vergessen sollte. Aber natürlich gehört auch dazu, Patienten darüber aufzuklären, dass eine standardisierte Medikation bereits im Anfangsstadium der Erkrankung dazu führen kann, dass das Herz-Kreislauf-Risiko sinkt. Das ist ja kein Widerspruch. Trotz frustraner Erlebnisse, von denen Kollegen immer wieder in Gesprächen erzählen, sollten wir bei den Patienten dranbleiben. Es stimmt schon, dass viele zum Teil nicht compliant sind. Andererseits: Wenn man davon ausgeht, dass viele Patienten ihre Tabletten nicht schlucken, dürfte man auch keine Rezepte ausstellen. Das betrifft natürlich vor allem die zuvor genannten Statine. Man darf nicht vergessen, dass diese in den letzten 10 Jahren einen großen Anteil an der Reduktion des Risikos für kardiovaskuläre Ereignisse gehabt haben, weil sie flächendeckend eingesetzt werden. Außerdem haben wir seit zwei Jahren mit Empagliflozin ein orales Antidiabetikum und im Falle von Liraglutid ein zu injizierendes Antidiabetikum, die in der Lage sind, zumindest bei bestimmten Patienten das Risiko zu senken. Dieses Wissen müssen wir in einer simplen, für den Patienten fassbaren Art an ihn weitergeben. Und dies wiederholt, und dabei sollten wir, wie vorhin gesagt, ins gleiche Horn stoßen. Ein gerade aktueller Punkt ist auch die Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie. Dies ist eine große Katastrophe, vor allem auch für die Stoffwechselpatienten oder solche, die es noch werden. Ich glaube, auch hier ist es ganz wichtig, dass sich die Ärzteschaft einig ist und mit einer Sprache und ähnlichen Worten versuchen, die Patienten auch beim Rauchverzicht bei der Stange zu halten.<br /> <br /><strong>Welche Aktivitäten sind in Zukunft geplant?<br /><br /> <em>R. Weitgasser:</em></strong> Wichtig ist, dass Aktivitäten wie die genannten wiederholt werden, damit sich das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Diabetes und kardiovaskulärem Risiko festigt. Wir möchten die Inhalte natürlich weiterentwickeln. Damit auch etwas weitergeht, engagieren sich außer uns beiden auch Prof. Heinz Drexel und Prof. Thomas Wascher direkt in der Initiative. Natürlich können wir dabei auf die geballte Kompetenz der ÖDG und ihrer Mitglieder zurückgreifen. Außerdem gehen wir auch in Richtung der DMP-Ärzte von „Therapie Aktiv“. Zudem arbeiten wir mit der Diabetikervereinigung, dem Herzverband, Diabetes Austria und den Aktiven Diabetikern zusammen. Also alle, die direkt die Patienten als ihre Zielgruppe sehen, sind bei dieser Kampagne mit im Boot, damit zu dieser Thematik regelmäßig aus möglichst vielen Richtungen Informationen und Motivation fließen.<br /><br /> <em><br /><strong>C. Francesconi:</strong></em> So ist es. Die Initiative wird im Wesentlichen von vier Pro­tagonisten getragen. Im Hintergrund wird sie aber selbstverständlich von der gesamten ÖDG-Vorstandsriege und im weitesten Sinn auch von allen engagierten Kolleginnen und Kollegen getragen, die im täglichen Gespräch mit den Patienten stehen. Ob das jetzt die DMP-Ärzte sind oder Kollegen in Spezialambulanzen oder in Rehazentren: Wir alle sitzen in unterschiedlichen Positionen im Gesundheitsapparat und haben dadurch, wenn wir zusammenarbeiten, eine sehr große Reichweite. Und die sollten und wollen wir auch in Zukunft nutzen.<br /> Vielen Dank für das Gespräch!<br />Das Interview führte <span class="Proxima-Condensed-Bold">Christian Fexa</span></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>Homepage<br /><a href="http://www.diabetesherz.at">www.diabetesherz.at</a><br /><a href="http://www.facediabetes.at/quiz.html">www.facediabetes.at/quiz.html</a></p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...
Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil
Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...


