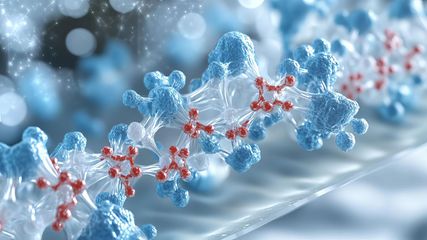Rolle der Prophylaxe bei der Therapie des hereditären Angioödems
Bericht:
Lydia Unger-Hunt
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Im Management des hereditären Angioödems (HAE) ist eine kontinuierliche präventive Therapie unerlässlich, um zukünftige Schübe zu verhindern und die Erkrankung besser zu managen: die Kurzzeitprophylaxe für den Schutz während eines geplanten chirurgischen Eingriffs sowie die Langzeitprophylaxe für die effektive Reduktion der HAE-Attacken und die Verbesserung der Lebensqualität.
Reine Akutbehandlungen können den langfristigen Verlauf der HAE nicht steuern und sie verhindern auch nicht das Auftreten neuer Anfälle beziehungsweise senken nicht das Risiko der damit verbundenen Komplikationen wie Atemnot.
Patient:innen, die nur die On-demand-Behandlung erhalten, können also nach wie vor häufige HAE-Attacken erleben und müssen zudem mit der anhaltenden Furcht vor einer Attacke umgehen – selbst wenn diese dann nicht eintreten sollte.1 Zudem müssen alle möglichen Trigger so gut wie möglich vermieden werden, was normale tägliche Aktivitäten beeinträchtigen und die Lebensqualität der Betroffenen stark verschlechtern kann.2–4
Einer grossen Bedeutung im Management des HAE kommen daher die präventiven Massnahmen zu. Diese werden in Kurzzeit- und Langzeitprophylaxe unterteilt:
-
Die Kurzzeitprophylaxe («short-term prophylaxis», STP) soll Komplikationen verhindern, die etwa durch operative Eingriffe im Mund-und Halsbereich entstehen können.
-
Die Langzeitprophylaxe («long-term prophylaxis», LTP) umfasst die dauerhafte Gabe von Medikamenten und soll dadurch neue Attacken überhaupt verhindern. Endziel ist die Verbesserung der Lebensqualität beziehungsweise eine Normalisierung des Lebens der Betroffenen.
Aktuelle Leitlinien-Empfehlungen
Die 2021 aktualisierten Leitlinien der WAO/EAACI zur Therapie der HAE empfehlen:2
-
Die STP vor allen medizinischen, chirurgischen oder zahnmedizinischen Eingriffen zu erwägen sowie vor allen anderen Ereignissen, die ein Angioödem bei einer Person auslösen können.
-
Die LTP bei allen Patient:innen mit HAE zu erwägen, denn sie kann die Zahl der Attacken signifikant reduzieren, und viele Betroffene erreichen ein komplettes Ansprechen. Nur mittels LTP sind derzeit die vollständige Krankheitskontrolle sowie eine Normalisierung des Lebens für Betroffene möglich.
Die langfristige Prophylaxe sollte zudem individualisiert durchgeführt werden, unter Berücksichtigung von Lebensqualität, Verfügbarkeit von Gesundheitsressourcen, Krankheitskontrolle und persönlicher Belastung. Da all diese Faktoren im Laufe der Zeit variieren können, sollten alle Patient:innen mindestens einmal jährlich auf eine LTP hin untersucht werden. Eine erfolgreiche LTP erfordert eine hohe Compliance; daher sollten die Präferenzen der Patient:innen berücksichtigt werden.
Effektivität der LTP
Eine LTP ist im Vergleich zur On-demand-Behandlung mit einer überlegenen Krankheitskontrolle und Lebensqualität assoziiert: Einer Studie zufolge verbesserte sich der Score im Angioödem-Control-Test von 5,0 auf 15,0; in einer anderen Untersuchung hatten Personen nach Umstieg auf LTP signifikant niedrigere Werte von Angst und Depression sowie eine Verbesserung des Angioödem-Lebensqualitäts-Scores von 34,1 auf 18,8.5,6
Drei Hauptwirkstoffe für die LTP
Die Leitlinien empfehlen als Erstlinien-LTP-Option 1pdC1-INH zum Ersatz des C1-INH den monoklonalen Anti-Kallikrein-Antikörper Lanadelumab sowie den Plasmakallikrein-Inhibitor Berotralstat.
Aus menschlichem Plasma gewonnenes («plasma-derived», PD)C1-INH wird weltweit für die langfristige Prophylaxe von HAE-Anfällen empfohlen, die Verabreichung erfolgt in der Regel zweimal wöchentlich intravenös oder subkutan. Die subkutane Behandlung bringt sehr gute, dosisabhängige präventive Effekte und stellt eine bequemere Option im Vergleich zur intravenösen Verabreichung dar.7 Die regelmässige Anwendung von pdC1-INH verbessert die Lebensqualität im Vergleich zur akuten Behandlung; thromboembolische Ereignisse sind selten und treten meist bei Vorliegen zusätzlicher Risikofaktoren auf.8,9
Lanadelumab ist ein subkutan injizierbarer monoklonaler Antikörper gegen aktives Plasma-Kallikrein und wird aufgrund seiner Wirksamkeit und der subkutanen Verabreichung zur langfristigen Prophylaxe von HAE-Anfällen empfohlen. Die Standarddosis beträgt 300mg alle zwei Wochen, wobei bei gut kontrollierten Patient:innen auch ein Intervall von vier Wochen möglich ist.10 Der Wirkstoff ist sicher und verursacht nicht mehr Nebenwirkungen als ein Placebo.11, 12
Berotralstat ist ein oraler Plasma-Kallikrein-Inhibitor und wird als bevorzugte LTP empfohlen.13, 14 Die Standarddosis beträgt 150mg täglich, kann jedoch auf 110mg reduziert werden, wenn Leberfunktionsstörungen, Arzneimittelwechselwirkungen oder gastrointestinale Beschwerden vorliegen. Die häufigsten Nebenwirkungen sind gastrointestinale Reaktionen, die zu Beginn der Behandlung auftreten, mit der Zeit abnehmen und in der Regel von selbst abklingen.15 Berotralstat wurde im Apex-Studienprogramm unter anderem in einer offenen Verlängerungsstudie analysiert.16 Nach 96 Wochen zeigte sich eine Reduktion der Anfallsraten gegenüber dem Ausgangswert um 90,8% (150mg) beziehungsweise 74,9% (110mg); die Probanden waren an 93,1% der Tage anfallsfrei. Zudem ging der Bedarf an Bedarfsmedikation in der 150-mg-Gruppe um 88,5% zurück. Die Lebensqualität verbesserte sich signifikant, insbesondere im Funktionsbereich, und therapieassoziierte Nebenwirkungen waren meist mild bis moderat.17
Weitere Wirkstoffe spielen eine untergeordnete Rolle
Androgene sind effektiv, aber aufgrund ihrer androgenen und anabolen Effekte, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und Kontraindikationen sowie zahlreichen Nebenwirkungen (Virilisierung bei Frauen, Menstruationsstörungen, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen) kritisch zu betrachten.17–19 Zudem ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich. Sie sollten nur als Zweitlinienbehandlung dienen, wenn die Erstlinienoptionen nicht verfügbar sind.
Antifibrinolytika wie Tranexamsäure werden nicht routinemässig für die langfristige Prophylaxe von HAE empfohlen, da es an Wirksamkeitsdaten mangelt; sie können aber in bestimmten Fällen hilfreich sein, wenn andere Prophylaxeoptionen nicht verfügbar oder Androgene kontraindiziert sind.20,21
Die schlussendliche Wahl eines prophylaktischen Wirkstoffs sollte immer in gemeinsamer Entscheidung von ärztlicher und Patientenseite gefällt werden.2
Präferenzen aus Patientensicht
Laut in den USA durchgeführten Untersuchungen würden 98% der unter LTP stehenden Patient:innen eine orale Therapie bevorzugen; 96% derjenigen, die derzeit keine LTP einsetzen, würden diese erwägen, wenn eine praktischere Option verfügbar wäre.22 Ähnlich lauten die Ergebnisse einer Untersuchung in Deutschland: Hier zeigten sich 74% der Personen unter nichtoraler LTP entweder «sehr» oder «äusserst interessiert» am Wechsel zu einer oralen LTP.23,24
Fazit
Prophylaktische Massnahmen zielen darauf ab, wiederkehrende Anfälle zu vermeiden und soweit wie möglich eine Normalisierung des Lebens zu erreichen.
Die Langzeitprophylaxe hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, da sie nicht nur die Anfallshäufigkeit signifikant reduziert, sondern auch die Lebensqualität verbessert. Hierzu kommen Medikamente wie rekombinantes C1-INH, Lanadelumab und Berotralstat zum Einsatz. Diese Optionen haben sich in klinischen Studien als sicher und wirksam erwiesen, wobei wohl besonders die orale Verabreichung von Patient:innen bevorzugt wird.
Insgesamt stellt die Langzeitprophylaxe eine vielversprechende Option für HAE-Patient:innen dar, die eine nachhaltige Krankheitskontrolle und eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität anstreben.
Literatur:
1 Azmy V et al.: Clinical presentation of hereditary angioedema. Allergy Asthma Proc 2020; 41(Suppl 1):S18-S21 2 Maurer M et al.: The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema – the 2021 revision and update. Allergy 2022; 77(7): 1961-90 3 Christiansen SC et al.: Before and after, the impact of available on-demand treatment for HAE. Allergy Asthma Proc 2015; 36(2): 145-50 4 Busse PJ et al.: US HAEA Medical Advisory Board 2020 Guidelines for the Management of Hereditary Angioedema. J Allergy Clin Immunol Pract 2021; 9(1): 132-50.e3 5 Weller K et al.: Validation of the angioedema control test (AECT) – apatient-reported outcome instrument for assessing angioedema control. J Allergy Clin Immunol Pract 2020; 8(6): 2050-7 6 Zarnowski J et al.: Prophylactic treatment in hereditary angioedema is associated with reduced anxiety in patients in Leipzig, Germany. Int Arch Allergy Immunol 2021; 182(9): 819-26 7 Longhurst H et al.: Prevention of hereditary angioedema attacks with a subcutaneous C1 inhibitor. N Engl J Med 2017; 376(12): 1131-40 8 Andarawewa S, Aygören-Pürsün E: Subcutaneous C1-inhibitor concentrate for prophylaxis during pregnancy and lactation in a patient with C1-INH-HAE. Clin Case Rep 2021; 9(3): 1273-5 9 Weller K et al.: Health-related quality of life with hereditary angioedema following prophylaxis with subcutaneous C1-inhibitor with recombinant hyaluronidase. Allergy Asthma Proc 2017; 38(2): 143-51 10 Buttgereit T et al.: Lanadelumab efficacy, safety, and injection interval extension in HAE: areal-life study. J Allergy Clin Immunol Pract 2021; 9(10):3744-51 11 Banerji A et al.: Effect of lanadelumab compared with placebo on prevention of hereditary angioedema attacks: arandomized clinical trial. JAMA 2018; 320(20): 2108-21 12 Banerji A et al.: Long-term prevention of hereditary angioedema attacks with lanadelumab: the HELP OLE study. Allergy 2022; 77(3): 979-90 13 Wedner HJ et al.: Randomized trial of the efficacy and safety of berotralstat (BCX7353) as an oral prophylactic therapy for hereditary angioedema: results of APeX-2 through 48 weeks (Part 2). J Allergy Clin Immunol Pract 2021; 9(6): 2305-14 14 Aygören-Pürsün E et al.: Oral plasma kallikrein inhibitor for prophylaxis in hereditary angioedema. N Engl J Med 2018; 379(4): 352-62 15 Manning ME, Kashkin JM: Berotralstat (BCX7353) is a novel oral prophylactic treatment for hereditary angioedema: review of phase II and III studies. Allergy Asthma Proc 2021; 42(4): 274-82 16 Kiani-Alikhan S et al.: Once-daily oral berotralstat for long-term prophylaxis of hereditary angioedema: the open-label extension of the APeX-2 randomized trial. J Allergy Clin Immunol Pract 2024; 12(3): 733-43.e10 17 Sheffer AL et al.: Clinical and biochemical effects of stanozolol therapy for hereditary angioedema. J Allergy Clin Immunol 1981; 68(3): 181-7 18 Zotter Z et al.: Frequency of the virilising effects of attenuated androgens reported by women with hereditary angioedema. Orphanet J Rare Dis 2014; 9: 205 19 Bouillet L, Gompel A.: Hereditary angioedema in women: specific challenges. Immunol Allergy Clin North Am 2013; 33(4): 505-11 20 Lundh B et al.: A case of hereditary angioneurotic oedema, successfully treated with epsilon-aminocaproic acid. Studies on C‘1 esterase inhibitor, C‘1 activation, plasminogen level and histamine metabolism. Clin Exp Immunol 1968; 3(7): 733-45 21 Blohmé G : Treatment of hereditary angioneurotic oedema with tranexamic acid. A random double-blind cross-over study. Acta Med Scand 1972; 192(4): 293-8 22 Geba D et al.: Hereditary angioedema patients would prefer newer-generation oral prophylaxis. J Drug Assess 2021; 10(1): 51-6 23 Greve J et al.: Expert consensus on prophylactic treatment of hereditary angioedema. Allergo J Int 2022; 31(7): 233-42 24 Magerl M et al.: The current situation of hereditary angioedema patients in Germany: results of an online survey. Front Med (Lausanne) 2024; 10: 1274397
Das könnte Sie auch interessieren:
Sorgfältige Differentialdiagnostik ist wichtig
Die Diagnostik des HAE erfolgt mittels Bluttests zur Messung der C1-INH- und C4-Konzentration im Plasma, und bei Bedarf mitttels genetischer Analysen. Eine sorgfältige ...
Auch auf unspezifische Vorzeichen achten
Das hereditäre Angioödem (HAE) ist gekennzeichnet durch schubartige ödematöse Schwellungen der Haut und der Schleimhäute, die zu Symptomen wie ein – auch einseitig – geschwollenes ...
Ursache des Hereditären Angioödems (HAE): ein Fehler im System
Die Ursache des hereditären Angioödems ist vereinfacht gesagt eine genetisch ausgelöste, fehlgeschlagene Kettenreaktion in Proteinen und Enzymen. Dadurch entsteht zu viel Bradykinin, ...