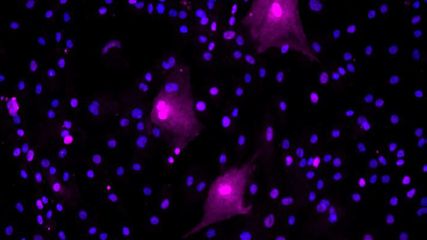©
Getty Images/iStockphoto
Effektive Sturzprävention kann den Notfall verhindern
Jatros
30
Min. Lesezeit
19.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Unverzichtbarer Bestandteil einer multiprofessionellen Osteoporosetherapie sollte die Prävention in Form einer Sturzprophylaxe sein. Kommt es zu einer proximalen Femurfraktur, ist die Operation innerhalb von 48 Stunden aufgrund von Antikoagulanzien oft nicht möglich.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Der demografische Wandel geht mit einer Verschiebung der Populationen einher, die Generation über 65 wird sich bis zum Jahr 2050 etwa verdoppeln, die Population der über 80-Jährigen sogar verdreifachen.<sup>1</sup> Mehr als ein Drittel der Todesfälle bei über 65-Jährigen geht laut einer europaweiten Studie auf Stürze zurück.<sup>2</sup> Etwa ein Drittel der Menschen in dieser Altersgruppe stürzt einmal pro Jahr, davon erleidet wiederum mehr als die Hälfte Folgestürze innerhalb eines Jahres. 10 % der Gestürzten versterben schon in der Klinik, im ersten Jahr nach einer Hüftfraktur liegt die Mortalität bei über 50-Jährigen bei 20,2 %.<sup>3</sup><br /> 90 % aller Patienten mit hüftgelenksnaher Fraktur haben eine verminderte Knochendichte. Das höhere Alter ist ein starker Sturzprädiktor, und auch die Verletzungsfolgen sind schwerer.<sup>4</sup> 50 % aller Patienten erlangen nicht mehr ihre ursprüngliche Mobilität. Immobilität führt zu einem enormen Kraftverlust, der Kraftabbau verläuft dreimal so schnell wie der Aufbau. „Während der durchschnittlichen Heilungsdauer einer Fraktur von vier bis sechs Wochen schmilzt der Muskel förmlich dahin“, erklärt Prim. Mag. Dr. Gregor Kienbacher, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, Klinikum Theresienhof Frohnleiten. Die gute Nachricht: In der postoperativen Phase kann durch ein gezieltes Rehabilitationsprogramm mit biomechanischer Diagnostik und individuellen gangtherapeutischen Interventionen eine Reduktion von Sturzereignissen um 46 % erreicht werden.<sup>5</sup></p> <h2>Der Sturz: biomechanische Betrachtungen</h2> <p>Der Mensch muss permanent viele äußere Kräfte ausgleichen, wobei bereits kleine Störungen dramatische Änderungen der Haltung verursachen können. Schon der Stand ist ein hochdynamisches Gleichgewichtsproblem, bei dem die sogenannte Haltungskontrolle dafür sorgt, dass sich die Projektion des Körperschwerpunktes stets innerhalb der Unterstützungsfläche befindet. Beim Gang wiederum liegt der Körperschwerpunkt nur während sehr kleiner Zeitintervalle innerhalb der Unterstützungsfläche, weshalb es extrem vieler Ausgleichsbewegungen bedarf.<br /> Gesteuert werden diese Vorgänge durch ein neuroanatomisches System im Rückenmark („central pattern generator“, CPG), das laufend selbstständige Aktionspotenziale entsendet und so für zyklische Bewegungsformen sorgt. „Neuere Studien zeigen eine Plastizität dieser neuronalen Schaltkreise hinsichtlich einer sensomotorischen Beeinflussung im Rückenmark auch nach einer Hirn- oder Rückenmarkläsion, die wir in der Rehabilitationstherapie nutzen“, sagt Kienbacher.<br /> Der Sturz selbst als „schwerkraftbedingte Bewegung des Körperschwerpunktes, der unbeabsichtigt zur Ruhe kommt“ steht zu 80 % mit lokomotorischen Problemen im Zusammenhang. Das lokomotorische System ist sehr komplex und leitet im Wesentlichen die sensorischen Informationen aus visuellen, auditiven, vestibulären und propriozeptiven Wahrnehmungen durch sensorische Afferenzen in das Zentralnervensystem. Dort werden die Informationen prozessiert und an die peripheren Effektorgane (v. a. Muskulatur, Gelenke) abgegeben, wo Adaptionsvorgänge in der Bewegung die statische und dynamische Balance erhalten.<br /> „Die moderne Sturzprophylaxe konzentriert sich heute auf das Individuum und nicht mehr so sehr auf dessen Umgebung“, sagt Prim. Kienbacher. Der Fokus liegt auf der Auffrischung des motorischen Gedächtnisses (z. B. durch Feedback-Training), der Automatisierung und Ökonomisierung der Gangabfolge, dem Training der Aufmerksamkeitsressourcen (z. B. Antizipationsfähigkeiten) und der posturalen Kontrolle oder Reaktions- und Rhythmisierungsfähigkeit.</p> <h2>Sturzprädiktoren ermitteln</h2> <p>Mittels orthopädischer und erweiterter biomechanischer Untersuchungen in speziell ausgestatteten Bewegungsanalyseeinheiten werden Sturzprädiktoren detektiert, wie: Gelenksdeformierung mit Desorientierung der Gelenksdrehachsen, Achsabweichungen, Beinlängendifferenzen, Dehnungszustand und Kraftentwicklung der Muskulatur sowie motorische Ansteuerungsdefizite in den jeweiligen Zeitintervallen und der Koordination. Die Ergebnisse fließen in die weiterführende orthopädische Therapie ein.<br /> Zur Bewertung eines pathologischen Gangbildes können Kennwerte durch instrumentelle Ganganalysen, wie kinematische Bewegungserfassungen (2D-Videoanalyse, 3D-Motion-Capture-Systeme), kinetische Messungen (Kraftmessplatte, z. B. Bodenreaktionskräfte, Drehmomente), Druckmessplatten-Untersuchungen (z. B. Druckverteilung im Abrollverhalten) oder EMG-Untersuchungen (Innervationsmuster der Muskulatur) ermittelt werden. Durch eine funktionelle 2D-biomechanische Bewegungsanalyse können beispielsweise eine Oberkörperseitlage in einer Schwungbeinphase oder eine hohe Schritt-zu-Schritt- Variabilität detektiert werden, die mit bloßen Augen nicht zu sehen wären. Beides sind Sturzprädiktoren, die durch ein gezieltes Training verbessert werden können.<br /> Dreidimensionale Motion-Capture-Systeme können unter anderem aufzeigen, ob und wie weit orthopädische Hilfsmittel oder ein gezieltes Gangtraining zu einer Harmonisierung des Ganges in den unterschiedlichsten Gangphasen beitragen. Dies gelingt mittels standardisierter Messung temporaler Gangparameter, wie der Variabilität der Standphasendauer oder der Schwungphasendauer, der Gehgeschwindigkeit, der Spurbreite, der Variabilität der Schrittlänge oder Messung der Körperschwerpunktkontrolle.</p> <h2>Osteoporose und Sturzgeschehen</h2> <p>Die Osteoporose ist durch die Rarefizierung der Knochenstruktur und der veränderten Haltung ein wesentlicher Faktor im Sturzgeschehen und für einen hüftnahen Bruch. Bei den hüftnahen Frakturen in Form eines medialen (varisch/valgisch) und lateralen Schenkelhalsbruches, eines pertrochantären oder subtrochantären Oberschenkelbruches ist auch die atypische Femurfraktur (AFF) bei Bisphosphonattherapie zu nennen. „Seit dem Jahr 2006 ist dieser Zusammenhang bekannt, wobei die Ursache nach wie vor ungeklärt ist“, sagt Priv.-Doz. Hans Gunther Clement, Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, Medizinische Universität Graz. Mit einer Bisphosphonattherapie werden etwa 1600 Frakturen verhindert, gleichzeitig kommt auf 1600 verhinderte Frakturen eine Bisphosphonat-AFF.<sup>6</sup><br /> Sturzprävention ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer multiprofessionellen Osteoporosetherapie. Sie beinhaltet die orthopädische Detektion von Risikogruppen, das durchgängige Screening von Patienten nach Sturzereignissen hinsichtlich pathologischer Gangparameter, die Objektivierung von Gangpathologien durch orthopädische und biomechanische Assessments sowie die Einleitung einer fachgerechten Therapie unter Einbeziehung individueller Ganginterventionen. „Auch orthopädische Hilfsmittel, richtig eingesetzt, verringern nachweislich das Sturzrisiko“, so Kienbacher.</p> <h2>Versorgung innerhalb 48 Stunden</h2> <p>Die kopferhaltende Therapie beim alten Patienten hat an Bedeutung verloren. Nach den Empfehlungen des BM für Gesundheit zur Behandlung oral antikoagulierter Patienten ist die Kopferhaltung (dynamische Schenkelhalsverschraubung, CHS) ab einem Alter von 75 streng zu indizieren. Betont wird gleichzeitig die Dringlichkeit, eine Versorgung innerhalb von 48 Stunden sicherzustellen.<br /> Beim geriatrischen Patienten ist nach einer Hüftfraktur meist keine Teilbelastung möglich. Minimal invasive Verfahren zur Stabilisierung mit Nagelosteosynthese (auch zementiert) und Prothesen (zementiert/ unzementiert) an einem osteoporotischen Knochen sind zu vermeiden. „Wir brauchen stabile Verhältnisse und kein unsicheres Konstrukt. Das Ziel muss ein möglichst minimal invasiver und ehestmöglicher Eingriff mit Vollbelastung sein“, sagt Clement.<br /> 16 prospektive und retrospektive Untersuchungen fanden Eingang in amerikanische und britische Guidelines,<sup>7</sup> in denen die wichtigsten Sturzprädiktoren aufgelistet werden: Muskelschwäche, vergangene Stürze, Geh- und Gleichgewichtsprobleme, Gebrauch von Gehhilfen, Sehschwäche, Arthritis, Beeinträchtigung des Alltags, Depression, kognitive Defizite oder ein Alter > 80 Jahre. Daneben kann heute jeder Patient selbstständig auf speziellen Screeningseiten im Internet durch die Eingabe seiner Daten das Sturz- und Bruchrisiko berechnen.</p> <h2>Mehr Frakturen und zu wenig Ressourcen</h2> <p>Ob osteoporoseinduziert oder nicht: Weltweit gab es 1990 1,7 Millionen hüftnahe Frakturen, für 2050 werden 8,2 Millionen, das ist fast eine Verfünffachung, prognostiziert. 90 % aller Hüftfrakturen finden in einem Alter über 50 Jahre statt, wie aus einer ukrainischen Studie, die auch Daten aus den Nachbarländern Russland, Polen und Rumänien nutzte, hervorgeht. Die Inzidenz pro 100 000 beträgt bei den Frauen über 50 Jahre 255,5 (mit erheblichem Anstieg ab 65 Jahre) und bei den Männern über 50 Jahre 197,8.<sup>8</sup><br /> Dem zunehmenden Aufkommen dieser Frakturen stehen medizinische Probleme gegenüber, wie zu wenig OP-Kapazität, keine Narkosekapazität, keine Narkosefreigabe (fehlende Befunde und Untersuchungen wie etwa Echokardio) oder keine Einwilligung des Sachwalters. Hinzu kommt, dass die Anzahl der antikoagulierten Patienten kontinuierlich ansteigt. „Die fehlende Gerinnungskompetenz zeigte sich 2018 auch am Klinikum Graz: 72 Prozent der Patienten mit hüftnaher Fraktur, die länger als 48 Stunden ohne Operation liegen blieben, waren Patienten, die mit einer Substanz antikoaguliert waren, die nicht antagonisierbar ist“, erklärt Clement. Nicht antagonisierbar sind etwa die direkten Faktor-Xa-Inhibitoren, Probleme macht aber auch die duale Antiplättchentherapie.<br /> Eine Verzögerung einer Operation von über 48 Stunden ist mit großen Komplikationen verbunden. Pro Tag ohne Mobilisation steigt die Mortalität beim alten Patienten um 4–6 % an.<sup>9</sup> „Eine prospektiv randomisierte Studie am Universitätsklinikum Graz wurde aus diesem Grund vorzeitig beendet“, so Clement. Stattdessen wurden „standard operating procedures“ (SOP) für das Vorgehen bei hüftnaher Fraktur und Antikoagulation im Einklang mit Literatur, Kardiologie, Angiologie, Gefäß- und Herzchirurgie gestaltet.</p> <h2>Fazit</h2> <p>Durch eine gute Osteoporosetherapie sollen möglichst viele Brüche verhindert werden. Kommt es trotzdem zum Bruch, sollte sobald wie möglich mit einer voll belastungsstabilen Osteosynthese oder Prothese operiert werden, wobei Antikoagulanzien zu Komplikationen führen können. „Wenn ein Blutverdünner notwendig ist, wäre der Einsatz eines antagonisierbaren Medikamentes günstiger für Patient und Operateur“, sagt Clement.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 27. Osteoporoseforum, 9.–11. Mai 2019, St. Wolfgang
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Demografischer Wandel und sozio-ökonomische Entwicklung in Österreich – Gesamtbevölkerung und Bevölkerung nach großen Altersgruppen, 2010 bis 2050. Quelle: Statistik Austria <strong>2</strong> Angermann A et al.: Injuries in the European Union. Statistics summary 2003-2005. Kuratorium für Verkehrssicherheit 2007 <strong>3</strong> Brozek W et al.: Calcif Tissue Int 2014; 95(3): 257-66 <strong>4</strong> Prudham D, Evans JG: Age Ageing 1981; 10(3): 141-6 <strong>5</strong> Weerdesteyn V et al.: Gerontology 2006; 52(3): 131-41 <strong>6</strong> Black DM et al.: Endocr Rev 2019; 40(2): 333-68 <strong>7</strong> Guideline for the prevention of falls in older persons. American Geriatrics Society, British Geriatrics Society, and American Academy of Orthopaedic Surgeons Panel on Falls Prevention. J Am Geriatr Soc 2001; 49(5): 664-72 <strong>8</strong> Povoroznyuk VV et al.: J Osteoporos 2018; 7182873 <strong>9</strong> Lefaivre KA et al.: J Bone Joint Surg Br 2009; 91(7): 922-7</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...