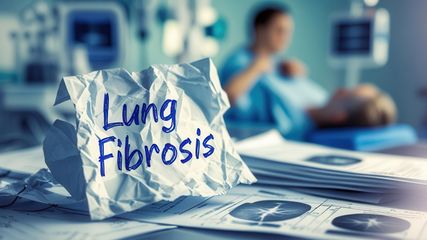Reinigungsmittel im beruflichen Kontext und Asthma bronchiale
Autorinnen:
Univ.-Prof. Dr. Julia Krabbe
Nelly Otte
Dr. Vera van Kampen
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV (IPA)
Ruhr-Universität Bochum
E-Mail: julia.krabbe@dguv.de
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Reinigungsmittel gelten als Risikofaktor für die Entstehung oder Verschlechterung von Asthma bronchiale, insbesondere bei regelmäßig exponierten Berufsgruppen.1Vor allem Frauen sind durch berufliche und häusliche Belastungen potenziell häufiger betroffen. In der Praxis sollten Präventionsmaßnahmen konsequent umgesetzt und interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert werden.
Keypoints
-
Personen mit Asthma bronchiale und entsprechender beruflicher Exposition wie im Reinigungs- oder Pflegebereich sollten gezielt nach Reinigungsmittelkontakt befragt werden.
-
Reinigungs- und Desinfektionsmittel als Sprays sollten gemieden werden, da die Aerosole beim Versprühen leicht eingeatmet werden.
-
Eine arbeitsplatzbezogene Anamnese und differenzierte Diagnostik sind für das frühzeitige Erkennen von Atemwegserkrankungen essenziell.
-
Arbeitsmedizinische Prävention kann eine Verschlechterung vermeiden oder potenzielle Berufskrankheiten verhindern.
Einleitung
Verschiedene Studien deuten auf eine erhöhte Krankheitslast bei bestimmten Berufsgruppen wie Reinigungskräften und Pflegepersonal hin, wobei Frauen tendenziell häufiger betroffen sind. Präventionsmaßnahmen können teilweise dazu beitragen, berufsbedingte Atemwegserkrankungen bereits im Vorfeld zu verhindern. Bestehen bereits Symptome, ermöglichen eine sorgfältige Anamnese und differenzierte Diagnostik, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen und eine Verschlechterung zu verhindern.
Reinigungsmittel in der Praxis
Im klinischen und beruflichen Alltag kommen verschiedene Reinigungsmittel zum Einsatz. Diese setzen sich in der Regel aus zahlreichen Stoffen zusammen und können sowohl irritative als auch sensibilisierende Eigenschaften besitzen. Insbesondere in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen und bei Reinigungstätigkeiten im öffentlichen oder gewerblichen Bereich besteht ein erhöhtes Expositionspotenzial.2 Hierbei sind saure und alkalische Reinigungsmittel sowie Desinfektionsmittel von Bedeutung, die je nach Anwendung inhalativ wirksam sein können, insbesondere, wenn sie versprüht und aerosoliert werden.
Zu den relevanten Substanzen zählen unter anderem Aldehyde, Alkohole oder Chlorverbindungen. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen quartäre Ammoniumverbindungen (QAV) wie Benzalkonium- oder Didecyldimethylammoniumchlorid, da sie sowohl als Irritanzien als auch als Allergene wirken können.3 Auch Formaldehyd, Glutaraldehyd und Peressigsäure zeigen eine starke irritative Potenz. Selbst Stoffe wie Ethanol oder Chlorhexidin können bei wiederholter Inhalation bronchiale Irritationen hervorrufen.4,5 Eine Studie zeigte zudem für den als Kontaktallergen bekannten Duftstoff Limonen, dass höhere Raumluftkonzentrationen mit einem erhöhten Asthmarisiko verbunden waren.6 Eine Übersicht über Reinigungsmittel mit erhöhtem Risiko für Atemwegserkrankungen gibt Tabelle 1.
Tab. 1: Reinigungsmittel, die mit einem erhöhten Risiko für Atemwegserkrankungen assoziiert sein können
Risikogruppen und spezifische Auslöser
Die epidemiologische Datenlage belegt einen konsistenten Zusammenhang zwischen langfristiger Exposition gegenüber Reinigungsmitteln und einer erhöhten Inzidenz von Asthma bronchiale bei bestimmten beruflich exponierten Gruppen.7 Eine norwegische Langzeitstudie zeigte, dass Frauen, die als Reinigungskräfte tätig waren, nach 20 Jahren eine Lungenfunktion aufwiesen, die jener von täglich20 Zigaretten rauchenden Personen entsprach. Dies wurde auch in der Presse aufgegriffen.8 In einer prospektiven Kohortenstudie wurde für Pflegepersonal mit mehr als fünfjähriger Nutzung von Reinigungsmitteln ein signifikant erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Asthma bronchiale festgestellt (adj. HR:1,38; 95%CI: 1,03–1,85).9 Im Vergleich zu Verwaltungsangestellten wiesen Reinigungskräfte ein erhöhtes Risiko für eine asthmatische Neuerkrankung auf (adj. RR:1,50; 95%CI: 1,43–1,57). Eine weitere Analyse zeigte eine deutlich gesteigerte Inzidenz nach sechs Jahren regelmäßiger Reinigungsarbeit (adj. IR:2,53; 95%CI: 1,38–4,64), während kürzere Expositionsdauern nicht mit einer signifikanten Risikoerhöhung assoziiert waren.7
Besonders relevant ist die Beobachtung, dass Frauen überproportional häufig betroffen sind. Gründe hierfür sind unter anderem eine höhere Exposition durch eine Überrepräsentation von Frauen bei beruflichen Tätigkeiten im Pflege- oder Reinigungssektor, eine häufigere Durchführung von Reinigungsarbeiten im privaten Umfeld und eine höhere Prävalenz von atopischen Erkrankungen und Asthma bronchiale bei Frauen.2 So ergab eine Studie eine Odds Ratio von 2,30 (95%CI: 1,40–3,60) für schlecht kontrolliertes Asthma bei erwachsenen Reinigungskräften mit regelmäßiger Exposition, wobei der Effekt bei Frauen noch ausgeprägter war.4,5
Verschiedene Studien konnten zudem zeigen, dass Reinigungskräfte, die häufig Reinigungsmittel als Sprays verwendeten, ein signifikant höheres Risiko für Atemwegserkrankungen aufwiesen.10 Eine große europäische Kohortenstudie ergab ein um 30–50% erhöhtes Risiko für Asthmasymptome, wenn regelmäßig Reinigungssprays verwendet wurden. Besonders betroffen waren Produkte wie Glasreiniger und Lufterfrischer.11
Weiterführende Informationen sowie eine umfassende Literaturübersicht zum Einfluss von Innenraumschadstoffen, einschließlich Reinigungsmitteln, auf das Asthmarisiko und die Krankheitskontrolle finden sich in der aktuellen Leitlinie der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Guidelines on Environmental Science for Allergy and Asthma– Recommendations on the Impact of Indoor Air Pollutants on the Risk of New-Onset Asthma and on Asthma-Related Outcomes.9
Pathophysiologie
Die Entstehung von Asthma bronchiale durch Reinigungsmittel erfolgt über eine immunologisch vermittelte Sensibilisierung oder durch direkte toxisch-irritative Wirkungen auf das Atemwegsepithel.12
Einige Substanzen wie Enzyme, Duftstoffe oder QAV können IgE-vermittelte Reaktionen auslösen, andere – wie Aldehyde oder Säuren – wirken eher irritativ. Neben der Asthmainduktion ist auch eine Verschlechterung der Krankheitskontrolle dokumentiert. QAV, wie z.B. Didecyldimethylammoniumchlorid, sind wahrscheinlich sowohl sensibilisierend als auch irritativ. Sie gehören zu den am häufigsten berichteten Auslösern von arbeitsbedingtem Asthma im französischen National Network for Monitoring and Prevention of Occupational and Environmental Diseases (RNV3PE). Sie sind mit einem Anteil von 5,3% an allen berufsbedingten Asthmaerkrankungen zwischen 2001 und 2018 beteiligt.4
Im European network for the PHenotyping of OCcupational Asthma (E-PHOCAS) wurden QAV ebenfalls als häufige Auslöser für Asthma bronchiale identifiziert. In dieser Studie war die Verwendung von Reinigungsmitteln zudem auch mit einer schlechteren Kontrolle des Krankheitsverlaufs assoziiert.13
Diagnostik
Die Diagnostik bei Verdacht auf ein durch Reinigungsmittel induziertes Asthma folgt etablierten Standards, sollte jedoch im Kontext der beruflichen Exposition differenziert erfolgen. Zunächst steht eine ausführliche Anamnese im Vordergrund, bei der sowohl der zeitliche Verlauf der Beschwerden als auch der Bezug zur beruflichen Tätigkeit im Mittelpunkt stehen. Hier sollte ein expositionsbezogener Beschwerde- und Erkrankungsbeginn sowie -verlauf erfasst werden. Charakteristisch für ein arbeitsbedingtes Asthma bronchiale sind eine Zunahme der Symptome während oder nach der beruflichen Tätigkeit sowie eine Besserung an arbeitsfreien Tagen oder im Urlaub. Diese Expositionsabhängigkeit kann erste Hinweise auf eine berufsbedingte Genese geben.
Wichtig ist auch die apparative Diagnostik wie Spirometrie, Bodyplethysmografie, Messung des fraktionierten exhalierten Stickstoffmonoxids (FeNO) sowie unspezifische Provokationstests. Bei Verdacht auf eine allergische Genese erfolgt eine weiterführende allergologische Diagnostik. Ergänzend können Belastungsuntersuchungen wie die Spiroergometrie oder der Sechs-Minuten-Gehtest zur Beurteilung der funktionellen Einschränkungen herangezogen werden.
Im Rahmen der weiterführenden allergologischen Diagnostik sollten das auslösende Allergen und eine allergenspezifische, klinisch relevante Allergie nachgewiesen werden. Die Abklärung einer Sensibilisierung kann mittels Pricktest und/ oder der Bestimmung spezifischer IgE-Antikörper erfolgen.
Wenn sich, insbesondere bei begründetem Verdacht auf eine Berufskrankheit, der Zusammenhang zwischen einer Asthmaerkrankung und dem vermuteten Auslöser nicht anderweitig belegen lässt, kann ein arbeitsplatzbezogener Inhalationstest (AIT) mit dem als Auslöser vermuteten Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel entsprechend der S2k-Leitlinie „Arbeitsplatzbezogener Inhalationstest (AIT)“14 durchgeführt werden.
Prävention und Arbeitsschutz
Die Prävention basiert auf dem sogenannten STOP-Prinzip, das eine hierarchische Reihenfolge von Schutzmaßnahmen vorgibt. An erster Stelle steht die Substitution, also der Ersatz gefährlicher Reinigungsmittel durch weniger gefährliche Alternativen. Darauf folgen technische, dann organisatorische Maßnahmen. An letzter Stelle steht der Einsatz persönlicher Schutzausrüstung wie Handschuhe oder Atemschutz, um die verbleibenden Risiken möglichst gering zu halten. Insbesondere seit dem Wegfall des Unterlassungszwangs hat die Individualprävention gemäß §3 der Berufskrankheitenverordnung an Bedeutung gewonnen und die Rolle der arbeitsmedizinischen Beratung und Betreuung sowie der Entwicklung sicherer und gesundheitsgerechter Reinigungsverfahren wurde gestärkt.
Eine wesentliche Präventionsmaßnahme bei Tätigkeiten mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, die auch von Fachgesellschaften wie der EAACI empfohlen wird, ist, Sprayanwendungen möglichst zu vermeiden und durch sicherere Applikationsformen wie vorgetränkte Tücher oder flüssige Reinigungsverfahren zu ersetzen.15
Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten in Bereichen, in denen dennoch gesprüht werden muss (z.B. in Operationssälen, Intensivstationen oder Laboratorien, in denen Flächen wie Gerätezwischenräume, Monitorkabel oder enge Spalten nicht abgewischt werden können, aber auch in der Lebensmittelindustrie und Tierhaltung), sind besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, da durch die feine Vernebelung ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen der Atemwege, der Augen und der Haut besteht.
Rechtlicher Rahmen von Berufskrankheiten
Die Anerkennung erfolgt unter den Berufskrankheiten(BK)-Nummern 4301 „Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankung (einschließlich Rhinopathie)“ oder 4302 „Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen“ der BKV. Während bei BK-Nr.4301 in der Regel ein spezifischer Allergienachweis erforderlich ist, genügt bei der BK-Nr.4302 meist der Nachweis eines kausalen Zusammenhangs zwischen Exposition und Erkrankung. Hausärztlich und pneumologisch tätige Fachkräfte spielen eine zentrale Rolle bei der Identifikation, Dokumentation und Meldung berufsbedingter Erkrankungen.
Fazit für die Praxis
Reinigungsmittelassoziiertes Asthma bronchiale ist klinisch relevant. Eine gezielte Anamnese, strukturierte Diagnostik und frühzeitige BK-Anzeige mit nachfolgender Individualprävention sind essenziell. Der Verzicht auf Sprays stellt eine effektive präventive Maßnahme dar, um das Risiko für berufsbedingtes Asthma im Reinigungssektor zu senken.
Literatur:
1 Archangelidi O et al.: Cleaning products and respiratory health outcomes in occupational cleaners: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med 2020; oemed-2020-106776 2 Da Pacheco S et al.: Household use of green and homemade cleaning products, wipe application mode, and asthma among French adults from the CONSTANCES cohort. Indoor Air 2022; 32(7): e13078 3 Lucas D et al.: Main causal agents of occupational asthma in France, reported to the National Network for Occupational Disease Vigilance and Prevention (RNV3P) 2001-2018. Ann Work Expo Health 2023; 67(3): 297-302 4 Mwanga HH et al.: Airway diseases related to the use of cleaning agents in occupational settings. J Allergy Clin Immunol Pract 2024; 12(8): 1974-86 5 Dalbøge A et al.: A systematic review of the relation between ten potential occupational sensitizing exposures and asthma. Scand J Work Environ Health 2025; 51(3): 146-58 6 Dales RE, Cakmak S: Is residential ambient air limonene associated with asthma? Findings from the Canadian Health Measures Survey. Environ Pollut 2019; 244: 966-70 7 Agache I et al.: The impact of indoor pollution on asthma-related outcomes: a systematic review for the EAACI guidelines on environmental science for allergic diseases and asthma. Allergy 2024; 79(7): 1761-88 8 Quarks 2018: Zu viel Putzen schwächt deine Lunge genauso wie Rauchen. www.quarks.de/gesundheit/medizin/zu-viel-putzen-schwaecht-deine-lunge-genauso-wie-rauchen/; zuletzt aufgerufen am 24.6.20259 Agache I et al.: EAACI guidelines on environmental science for allergy and asthma-recommendations on the impact of indoor air pollutants on the risk of new-onset asthma and on asthma-related outcomes. Allergy 2025; 80(3): 651-76 10 Dumas O et al.: Occupational exposure to cleaning products and asthma in hospital workers. Occup Environ Med 2012; 69(12): 883-9 11 Zock JP et al.: The use of household cleaning sprays and adult asthma: an international longitudinal study. Am J Resp Crit Care Med 2007; 176(8): 735-41 12 Ozdemir C et al.: Lifestyle changes and industrialization in the development of allergic diseases. Curr Allergy Asthma Rep 2024; 24(7): 331-45 13 Migueres N et al.: Occupational asthma caused by quaternary ammonium compounds: a multicenter cohort study. J Allergy Clin Immunol Pract 2021; 9(9): 3387-95 14 Preisser AM et al.: S2K-Leitlinie: Arbeitsplatzbezogener Inhalationstest (AIT). Stand 01/2012. https://register.awmf.org/assets/guidelines/002-026l_S2k_Arbeitsplatzbezogener-Inhalationstest-AIT_2021-12.pdf ; zuletzt aufgerufen am 24.6.2025 15 Siracusa A et al.: Asthma and exposure to cleaning products – a European Academy of Allergy and Clinical Immunology task force consensus statement. Allergy 2013; 68(12): 1532-45
Das könnte Sie auch interessieren:
Idiopathische Lungenfibrose: neue Substanzen in der Pipeline
Auf dem DGP-Kongress wurden aktuelle Studiendaten zu den beiden zugelassenen Medikamenten bei idiopathischer pulmonaler Fibrose (IPF) vorgestellt. Neue Erkenntnisse gibt es auch zu ...
Weaning aus ärztlicher Sicht – Status quo und Herausforderungen
Dieser Artikel soll einen Überblick über die aktuellen Leitlinien und Empfehlungen bezüglich des Weanings, also der Entwöhnung von der invasiven Beatmung, geben. Zudem erfolgt eine ...