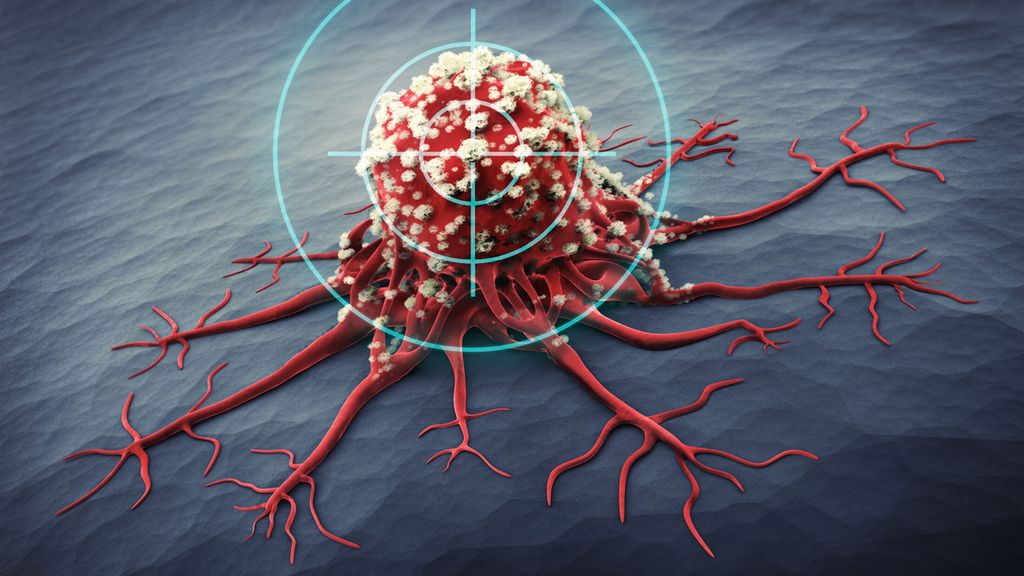
©
Getty Images/iStockphoto
Rezente ASCO-Daten beim Mammakarzinom im adjuvanten und metastasierten Setting
Jatros
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Christian Singer
Univ.-Klinik für Frauenheilkunde<br> Medizinische Universität Wien<br> E-Mail: christian.singer@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
13.09.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Das diesjährige ASCO Annual Meeting bot eine Fülle an neuen Daten zum Mammakarzinom sowohl im adjuvanten als auch im metastasierten Setting, die vielleicht nicht dermaßen bahnbrechend waren, wie man das aus den letzten Jahren gewohnt ist, aber dennoch neue Erkenntnisse für die Klinik bringen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Durch den Einsatz von Oncotype können zusätzliche 70 % von Patientinnen mit frühem Mammakarzinom vor einer Chemotherapie bewahrt werden, ohne dass dadurch das onkologische Langzeitoutcome veschlechtert würde.</li> <li>Es liegt nun ausreichend Evidenz vor, um jeder Patientin, die die Einschlusskriterien von ABCSG-18 heute erfüllt, eine Denosumab-Behandlung zu empfehlen.</li> <li>Eine selektive Hemmung von AKT könnte bei TNBC im Rahmen eines multimodalen Therapiealgorithmus durchaus therapeutisch sinnvoll sein.</li> </ul> </div> <h2>Adjuvantes Setting</h2> <p><strong>TAILORx-Studie</strong><br /> Mit der Präsentation der prospektiven, randomisierten TAILORx-Studie wurden die Ergebnisse jener Studie vorgestellt, die im adjuvanten Setting die Wertigkeit der Chemotherapie bei HR-positiven, HER2- negativen, nodal-negativen Mammakarzinomen relativiert. Lymphknoten-negative Mammakarzinome machen etwa die Hälfte aller Brustkrebsfälle aus. Bislang erschien es so, dass lediglich Patientinnen mit einem niedrigen RS im Oncotype DX<sup>®</sup> Test und damit einer besonders guten Langzeitprognose endokrin behandelt wurden. TAILORx konnte nun erstmals aufzeigen, dass auch Frauen mit einem intermediären Risiko keinen zusätzlichen Benefit durch die Zugabe von Chemotherapie haben würden. Durch den Einsatz von Oncotype können zusätzliche 70 % von Patientinnen mit frühem Mammakarzinom vor einer Chemotherapie bewahrt werden, ohne dass dadurch das onkologische Langzeitoutcome veschlechtert würde.<br /> Allerdings muss auch festgehalten werden, dass gerade in Österreich ohnehin eine eher „endokrine Philosophie“ verfolgt wird und der Test hierzulande wohl nur für ein relativ kleines Patientenkollektiv indiziert ist. Zudem wird der Oncotype Test in Österreich nicht von der Krankenkasse refundiert, was wohl eine größere Verbreitung hierzulande erschweren dürfte.</p> <p><strong>6-Jahres-Daten der ABCSG-18-Studie</strong><br /> Ein Highlight des diesjährigen ASCOKongresses war zweifellos die Präsentation der 6-Jahres-Daten der österreichischen ABCSG-18-Studie, die von Michael Gnant im Rahmen einer Oral Presentation vorgetragen wurden. Er konnte nach einer Nachbeobachtung von durchschnittlich 72,6 Monaten zeigen, dass die Gabe von 60mg Denosumab, im Abstand von 6 Monaten verabreicht, bei postmenopausalen Frauen mit HR-positivem, HER2-negativem frühem Mammakarzinom unter einer Therapie mit einem Aromatasehemmer zu einer Reduktion des Rückfallrisikos um ca. 18 % führt. Diese deutlichen Unterschiede sind schon alleine dadurch bemerkenswert, dass die Heilungs- und Überlebenschancen von Patientinnen mit diesem Tumortyp an sich schon hoch sind. In Kombination mit den bereits bekannten und bereits 2015 publizierten Daten zur – unabhängig von der Knochendichte – Halbierung des Frakturrisikos liegt nun ausreichend Evidenz vor, um jeder Patientin, die die Einschlusskriterien von ABCSG-18 heute erfüllt, eine Denosumab- Behandlung zu empfehlen.</p> <p><strong>D-CARE-Studie</strong><br />Die Studie stand in bemerkenswertem – und auf den ersten Blick nicht ganz verständlichem – Widerspruch zu den Daten der ebenfalls beim ASCO präsentierten D-CARE-Studie, die von Robert Coleman vorgestellt wurde. In der ebenfalls adjuvanten Studie wurde Denosumab deutlich dosisdichter, nämlich in einer Dosierung von 120mg, zunächst monatlich, dann alle 3 Monate verabreicht. Fast alle Patientinnen hatten zuvor eine Anthrazyklinbzw. Taxan-basierte Chemotherapie erhalten, und nur 77 % waren ER-positiv. Das Knochenmetastasen-freie Überleben („bone metastasis free survival“; BMFS) war als primärer Endpunkt gewählt worden, ein Endpunkt, der sich aus heutiger Sicht nicht als sinnvoll erwiesen hat. In der Tat führte die Zugabe von Denosumab zu keiner signifikanten Verbesserung des BMFS, und auch die sekundären Endpunkte DFS und OS waren nicht signifikant. Aufgrund der doch relativ dichten Dosis kam es allerdings mit einer Inzidenz von 5,4 % zu einer signifikanten Häufung von Kieferosteonekrosen (ONJ) und 0,4 % entwickelten eine atypische Femurfraktur.</p> <h2>Fortgeschrittenes Mammakarzinom</h2> <p><strong>MONALEESA-3-Studie</strong><br /> Beim fortgeschrittenen Mammakarzinom gab es einige Neuigkeiten: Dennis Slamon präsentierte die lang erwarteten Ergebnisse der MONALEESA-3-Studie, in die Patientinnen mit fortgeschrittenem, HR-positivem, HER2-negativem Mammakarzinom eingeschlossen worden waren. Im Gegensatz zu den bisher mit CDK4/6-Inhibitoren durchgeführten Studien konnten hier sowohl de novo metastasierte Patientinnen eingeschlossen werden als auch Frauen, die sich im First-Line- bzw. Second-Line-Setting befanden. Die Studie war zweiarmig aufgesetzt und Patientinnen wurden 1:1 randomisiert, um entweder Fulvestrant oder Fulvestrant plus Ribociclib zu erhalten.<br /> Auch in diesem Setting bestätigte sich der überragende Benefit dieser Substanzklasse mit einem PFS von 20,5 Monaten in der Kombinationsgruppe vs. 12,8 Monate in der alleinigen Fulvestrant-Gruppe, was eine 41 % ige Reduktion des Risikos für Krankheitsfortschreiten zum Zeitpunkt der Analyse darstellt. Die Toxizitätsdaten waren mit den bislang berichteten fast deckungsgleich.</p> <p><strong>MONARCH-2-Studie</strong><br />Zu Abemaciclib gab es beim ASCO ebenfalls neue Daten: Die MONARCH- 2-Studie untersuchte in einem ähnlichen Setting wie MONALEESA-3 den Einsatz des CDK4/6-Inhibitors beim HR-positiven, HER2-negativen fortgeschrittenen Mammakarzinom. Im Gegensatz zur zuvor vorgestellten Studie wurden bei MONARCH-2 allerdings auch prä- und perimenopausale Frauen eingeschlossen und die Analyse dieser Subgruppe wurde nun in Chicago präsentiert. Randomisierte Patientinnen erhielten zusätzlich zum endokrinen Backbone Fulvestrant in jedem der Arme ein GnRH-Analogon und, je nach Arm, Abemaciclib oder Placebo.<br /> Während im CDK4/6-Inhibitor-Arm das mediane progressionsfreie Überleben zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht erreicht worden ist, so lag dieses im Placeboarm bei 10,5 Monaten. Auch die Ansprechraten von 60,8 % vs. 28,6 % waren im Abemaciclib- Arm deutlich besser. Wie jedoch zu erwarten war, war die Gabe durch eine relativ hohe Toxizität belastet, insbesondere kam es unter dem CDK4/6-Inhibitor in 87,3 % der Fälle zum Auftreten von Diarrhöen.</p> <p><strong>SANDPIPER-Studie</strong><br />Ein wenig enttäuschend wurden die Daten der Primäranalyse der Phase-IIIStudie SANDPIPER von den Kongressteilnehmern aufgenommen. Zwar kam es unter der Kombination von Fulvestrant und dem mutationsspezifischen Pi3K-alpha- Tyrosinkinaseinhibitor Taselisib zu einer signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens, allerdings war der Unterschied mit 7,4 Monaten vs. 5,4 Monaten im alleinigen Fulvestrant-Arm klinisch nicht so beeindruckend, wie man dies erwarten hätte können. Außerdem war die Gabe von Taselisib mit einer relativ hohen Rate von gastrointestinalen Nebenwirkungen wie Durchfall, Kolitis und Hyperglykämie assoziiert, und es kam bei etwa 17 % der Patientinnen im Taselisib- Arm zu einem Therapieabbruch, während es im alleinigen Fulvestrant-Arm gerade einmal 2 % waren.</p> <h2>TNBC</h2> <p><strong>Phase-II-Studie mit oralem Capivasertib (AZD5356)</strong><br /> Auch beim TNBC gab es eine Reihe von interessanten – wenngleich frühen – klinischen Daten. Gerade Tumoren mit dieser außerordentlich ungünstigen Prognose sind gegenwärtig Ziel intensiver Forschungsbemühungen und AKT als pivotaler Teil der Signaltransduktionskaskade erscheint zunehmend als interessantes therapeutisches Target.<br /> So konnte beispielsweise durch den Einsatz des oralen Capivasertib (AZD5356) sowohl das progressionsfreie Überleben in einer Phase-II-Studie von 4,2 auf 5,9 Monate gesteigert werden als auch das Gesamtüberleben von 4,0 auf 10,2 Monate signifikant verlängert werden. Interessanterweise war die Wirkung von Capivasertib auf Tumoren beschränkt, die Genveränderungen in PIK3CA/AKT1/ PTEN aufwiesen, während die Substanz in nicht mutierten Tumoren keinen therapeutischen Effekt zu haben schien.</p> <p><strong>Reanalyse der LOTUS-Studie</strong><br />Ähnlich hoffnungsvolle Ergebnisse wurden in einer Reanalyse der LOTUSStudie beobachtet, bei der es durch den Einsatz des AKT-Hemmers Ipatasertib nun zu einem grenzwertig signifikanten Überlebensvorteil gekommen ist. In dieser Phase-II-Studie beim fortgeschrittenen Mammakarzinom wurde der klinische Benefit der Zugabe von Ipatasertib zu Paclitaxel mit einer alleinigen Paclitaxel-Gabe verglichen.<br /> Natürlich sind beide Studien klein und preliminär, sie zeigen aber klar auf, dass eine selektive Hemmung von AKT im Rahmen eines multimodalen Therapiealgorithmus durchaus therapeutisch sinnvoll sein könnte.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Adjuvantes Osimertinib reduziert ZNS-Rezidive bei EGFR-mutierter Erkrankung
Etwa 30% der Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) präsentieren sich mit resezierbarer Erkrankung und werden einer kurativen Operation unterzogen. Viele Patienten ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


