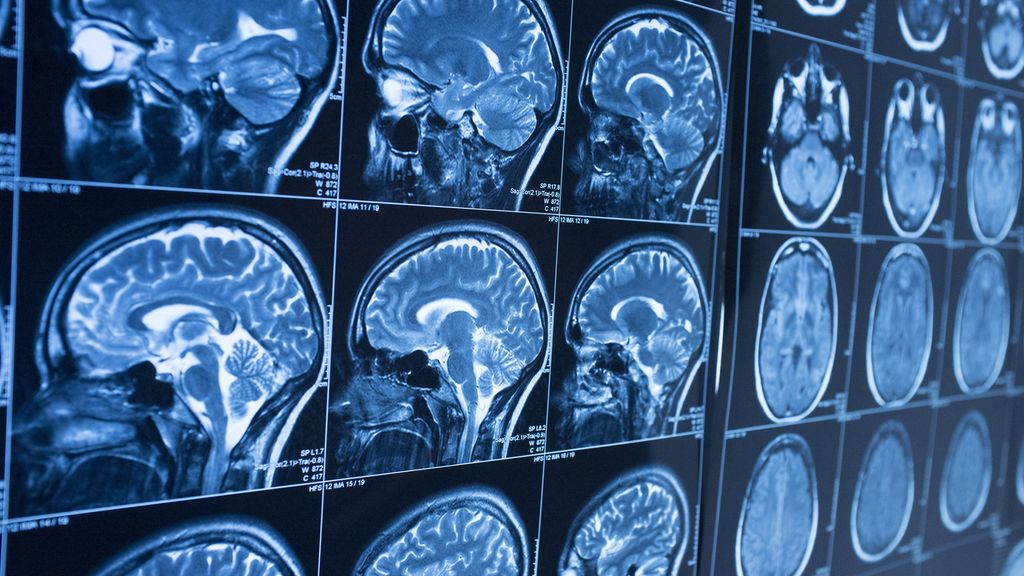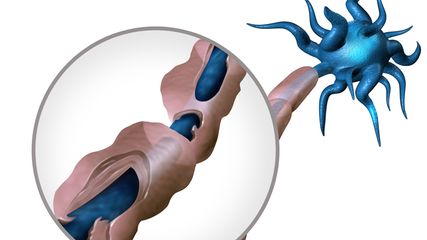<p class="article-intro">Deformitäten der Wirbelsäule treten bei 7 % der Parkinsonpatienten auf. Konservative Therapie kann die Progredienz der Deformitäten nicht wirklich stoppen. Bei entsprechend schweren und eindeutig progredienten Fällen liefert die operative Behandlung trotz hoher Komplikations- und Reoperationsraten zufriedenstellende Ergebnisse, wie eine Untersuchung der eigenen OP-Ergebnisse von 15 Patienten mit kyphotischen/kyphoskoliotischen Parkinsondeformitäten zeigt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Morbus Parkinson (MP) ist der häufigste Grund einer Behinderung beim älteren Patienten. Neben den bekannten neurologischen Symptomen kann diese Behinderung auch durch progrediente Wirbelsäulendeformitäten und pathologische Wirbelkörpereinbrüche verursacht bzw. verstärkt werden.<br /> Die Camptocormia („Bent spine“-Syndrom) wird als abnormale, schwere und nicht freiwillig bedingte Vorbeugung des Körpers definiert, die während des Stehens und Gehens manifest wird und sich zunächst in liegender Stellung bessert.<sup>1</sup> Die Prävalenz beträgt knapp 7 % .<sup>2</sup> Sie wird durch Schwäche der Bauch- und/oder Paravertebralmuskulatur auf Basis einer Myopathie verursacht und nicht als direkte Erkrankung der Wirbelsäule angesehen.<sup>1, 3</sup><br /> Neben der Kyphose kann auch eine Skoliose mit der Konvexität zur Seite der stärkeren Symptomatik auftreten.<sup>4</sup> Typisch ist hier das Fehlen einer Ausgleichskrümmung, sodass die Wirbelsäule deutlich aus dem Lot gerät („Pisa-Syndrom“).<br /> Als dritter Faktor ist eine signifikante Häufung von Osteoporose im Vergleich zu einer gleichaltrigen Kontrollgruppe zu nennen, dadurch kann es auch durch Wirbelfrakturen zur erhöhten Rate an Deformitäten kommen.<sup>5</sup> Die signifikant reduzierte Körperkraft korreliert mit der reduzierten Knochendichte<sup>6</sup> der Parkinsonpatienten.<br /> In Kombination mit den MP-Gangstörungen und den übrigen neurologischen Problemen können diese Deformitäten die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Sie können schwere Rücken- und Kreuzschmerzen sowie radikuläre Ausfälle und schließlich eine vollständige Gehunfähigkeit erzeugen.<br /> Die konservative Behandlung ist praktisch wirkungslos, kann das Auftreten der Verkrümmungen nicht verhindern und auch die Lebensqualität nicht verbessern. Es gibt derzeit keine spezifische pharmakologische Therapie der primären axialen Myopathie.<sup>7</sup> Die „deep brain stimulation“ wird kontroversiell diskutiert. <sup>8, 9</sup> Ein Übungsprogramm wird empfohlen, <sup>10</sup> kann aber die Progredienz der Deformitäten nicht wirklich stoppen. Daher ist bei entsprechend schweren und eindeutig progredienten Fällen nur die operative Korrektur und Versteifung (sowie Dekompression, wenn notwendig) in der Lage, die Lebensqualität deutlich zu verbessern.</p> <h2>Patienten und Technik</h2> <p>Wir berichten über eine retrospektive Untersuchung der operativen Therapie von Deformitäten im Rahmen von MP zwischen 2008 und 2014. 10 weibliche und 5 männliche Patienten im Alter von 73 (63– 81) Jahren wurden wegen Deformitäten bei neurologisch verifiziertem MP operiert. Es handelte sich durchwegs um große Eingriffe.<br /> OP-Indikationen waren bei 5 Patienten Kyphose, bei 5 Kyphoskoliose (Kombination von Camptocormia und Pisa-Syndrom), bei 2 Patienten Skoliose nach einer 2-Etagen- Fusion lumbal und bei 3 Patienten Kyphose nach Wirbelkörperkompressionsfraktur (L1–2, L4 und Th12–L2), Letztere mit Unmöglichkeit des Sitzens oder Stehens wegen Schmerzen und Caudasymptomatik in dieser Stellung.<br /> Vorangehende Operationen bei 10 Patienten waren: 4 Vertebroplastien, 3 Dekompressionen, 2 dynamische Instrumentierungen und 2 bisegmentale Fusionen (Mehrfachoperationen!). 7 Patienten hatten keine vorherige OP.<br /> Die Therapie bestand aus 8 Pedikel- Subtraktionsosteotomien (PSO), in 5 Fällen kombiniert mit langstreckiger dorsaler Spondylodese von 9 Segmenten (6–5), 4 langstreckigen Fusionen von 9 Segmenten (5–15) und 3 anterioren Wirbelkörperresektionen mit vorderer Dekompression, Ersatz durch Titancage und posteriorer Instrumentierung. Die posterioren Instrumentationen wurden dabei mit zementierten Pedikelschrauben durchgeführt. In einem sehr rigiden Fall erfolgte vor der Wirbelresektion ein dorsaler Release mit Facettektomie über zwei Segmente. Alle Eingriffe wurden unter Neuromonitoringkontrolle durchgeführt. Bei eindeutigen Fällen von degenerativer Spondylolisthese, erosiver Osteochondrose, Drehgleiten oder ausgeprägter Foramenstenose erfolgte zusätzlich eine vordere Stabilisierung mittels PLIF („posterior lumbar interbody fusion“) oder TLIF („transforaminal lumbar interbody fusion“).<br /> Die Nachuntersuchungsperiode betrug 36 Monate (24–78). Die Nachuntersuchung umfasste OP-Dauer, Schmerzempfindung nach visueller Analogskala versus präoperativ, subjektive Patientenbeurteilung (sehr gut: ausgezeichnete Korrektur, sehr gute Schmerzreduktion; gut: gute Korrektur, gute Schmerzreduktion; mäßig: länger dauernde Komplikation[en] mit entweder guter Aufrichtung oder guter Schmerzverbesserung; schlecht: keine Verbesserung oder sehr schwerwiegende Komplikation), weiters Korrektur von Kyphose und Skoliose, Komplikationen und Reoperationen.</p> <h2>Ergebnisse</h2> <p>Die OP-Zeit betrug 245 (160–380) Minuten. Die Kyphose konnte bei Camptocormia durchschnittlich um 46° (15–84°) verbessert werden, nach osteoporotischen Wirbelfrakturen um 22° (12–40°), die Skoliosekorrektur betrug 15° (8–23°).<br /> Die subjektiven klinischen Ergebnisse waren bei 5 Patienten sehr gut, bei 5 gut, bei 3 mäßig und bei 1 schlecht; 1 Patient konnte nicht befragt werden. Der Schmerz nach visueller Analogskala betrug präoperativ 8,4 und bei der Nachuntersuchung 3.<br /> Die Rate der Komplikationen lag bei 9/15: 1x sich sehr langsam rückbildende motorische Caudasymptomatik ohne Sensibilitätsverlust und ohne Blasen-/Mastdarmentleerungsstörung, verursacht durch Fraktur des Wirbels kranial der Fusion 2 Wochen postoperativ; 2x reversible Paresen L4, L5; 1x Stablockerung L5/S1; 1 Stabluxation; 1 kraniale Wirbelfraktur; 2 kaudale Wirbelfrakturen; 1 postoperatives schweres Psychosyndrom.<br /> 8/15 Patienten mussten innerhalb des ersten postoperativen Halbjahres reoperiert werden: 2 kraniale Fusionsverlängerungen (1 mit Dekompression); 3 kaudale Fusionsverlängerungen; 1 Dekompression, 1 Schraubenwechsel + AxiaLIF-Stabilisierung L3–S1, 1 Implantatwechsel nach Stabbruch.</p> <h2>Diskussion</h2> <p>Camptocormia bei MP basiert auf neurogenen oder myogenen Veränderungen, aber nicht auf primären Wirbelsäulenveränderungen wie etwa Morbus Bechterew. Das EMG-Muster ist ähnlich den Veränderungen bei einer Myositis.<sup>10, 11</sup> Camptocormia tritt bei schwerer Verlaufsform des MP mit axialer Prädominanz, motorischen Fluktuationszeichen und dysautonomen Symptomen auf, häufig mit spondylarthrotischen Veränderungen und Schmerz.<sup>12</sup> Diese Arbeit unterstützt auch die Hypothese, dass die Rigidität Wirbelsäulenprobleme induzieren kann, die dann via Kompression von Spinalnerven zu neurogenen Symptomen führen können. Nallegowda et al. sehen die quantitative Reduktion der Muskelkraft an der Wirbelsäule und den unteren Extremitäten zusammen mit gestörter Propriozeption und visueller Kapazität als Hauptgründe für die Haltungsinstabilität an.<sup>13</sup> Interessanterweise zeigen MR-Untersuchungen, dass MP mit Camptocormia möglicherweise eine eigene Form dieser Krankheit darstellt, mit einer spezifischen Dysfunktion im Hirnstamm.<sup>14</sup><br /> Neben der Hyperkyphose kommt auch das Pisa-Syndrom mit Lateralflexion nicht so selten vor, unterteilt in chronische und subchronische Form.<sup>15</sup> Die Patienten entwickeln neuromuskuläre Symptome durchschnittlich 2,7 Jahre nach Auftreten des MP.<sup>16</sup> Die in dieser Studie durchgeführten Muskelbiopsien waren alle pathologisch, sie zeigten entweder nekrotisierende Myositis oder Myopathien mit mitochondrialen Abnormitäten.<br /> Zusätzlich führt die kyphotische Haltung zu weiteren Problemen: Die Untersuchungen von You et al. 2002 zeigen, dass ältere Menschen, die in deutlich vorgeneigter Stellung mit begrenzter Beweglichkeit und Schwäche der Stammund Hüftmuskulatur gehen, nicht kontraktile Strukturen wie Bänder und Gelenkkapseln verstärkt belasten.<sup>17</sup> Biomechanische Daten zeigen ein höheres Risiko vertebraler Kompressionsfrakturen bei vorbestehender Kyphose durch den mechanischen Stress.<sup>18</sup> Kamanli et al. finden ein erhöhtes Osteoporoserisiko vor allem bei älteren Frauen, wahrscheinlich eines der orthopädischen Hauptprobleme des MP.<sup>19</sup><br /> Die konservative Behandlung der Camptocormia ist schwierig, da die Deformität nicht auf dopaminerge Medikamente reagiert und die Ergebnisse der stereotaktischen Stimulation im Allgemeinen als schlecht angesehen werden.<sup>20</sup><br /> Die Miederbehandlung einer fortschreitenden Deformierung verursacht einerseits einen deutlichen Verlust an Lebensqualität und kann andererseits die Progredienz auch nicht aufhalten. De Seeze et al. berichten etwas bessere Ergebnisse in Kombination der Mieder mit physiotherapeutischer Behandlung,<sup>21</sup> aber man sollte sich vor Augen halten, dass die Physiotherapie bei einer Erkrankung mit pathologischen Muskelveränderungen schwierig ist.<br /> Daher bleiben als einzige wirkungsvolle Therapie die operative Dekompression, Aufrichtung und Fusion, obwohl die operative Deformitätenbehandlung beim MP in praktisch der gesamten orthopädischen Literatur eine hohe Rate an technischen Komplikationen und Reoperationen aufweist. <sup>22–24</sup> Eines der Probleme neben der Osteoporose dürfte darin bestehen, dass die muskuläre Pathologie bei kurzen Implantatkonstruktionen zu weiterer Kyphosierung im angrenzenden Bereich führen kann. Primär langstreckige Fusionen werden daher diskutiert.<br /> Nakashima et al. berichteten 2009 von 3 Fällen thorakolumbaler Wirbelkörperfrakturen bei MP mit Osteoporose. Sie behandelten durch vordere Wirbelkörperresektion, anteriore Dekompression und Ersatz des Wirbels mittels eines Titankäfigs sowie posteriore Rekonstruktion mit Laminarhaken und Pedikelschrauben zwei Wirbel nach kranial und zwei Wirbel nach kaudal. Sie gaben insgesamt zufriedenstellende Ergebnisse an, stellten aber postoperativ mit einem steifen Mieder ruhig. Dennoch war bei zwei Dritteln der Käfige ein gewisses Einsinken festzustellen.<sup>25</sup> Wir verwenden ebenso diesen Zugang bei Frakturen, nicht nur bei MP, sondern auch bei anderen Ursachen ventraler Instabilität, wenn nötig mit Dekompression von ventral. Unserer Erfahrung nach gibt es keine bessere Dekompression des Rückenmarks oder der Cauda, wenn die Kompression von vorne kommt. Wir sahen auch in keinem einzigen Fall nach ventraler Durafreilegung bei Kompression verschiedenster Genesen postoperativ eine Verschlechterung. Im Regelfall erfolgt die neurologische Erholung deutlich rascher und sicherer als bei dorsaler Freilegung der neurogenen Strukturen. Auf der anderen Seite sprechen die Beobachtungen von Nakashama et al. dafür, zumindest kranial drei Segmente evtl. mit Zement zu verschrauben, schließlich hat in diesem Bereich die Fusion kaum einen negativen Einfluss.<sup>26</sup> Trotz Vermeidung eines postoperativen Mieders sahen wir kein Einsinken der Titancages in Deckoder Grundplatte. Kaudal würden wir bei guten Segmentverhältnissen unterhalb der beiden fixierten Etagen kein zusätzliches Bewegungssegment versteifen. Bei sehr guten Verhältnissen kann man die Instrumentierung kaudal des ersten unteren Segments ohne Versteifung durchführen und nach etwa 9 Monaten das Bewegungssegment durch Implantatverkürzung wieder freigeben. Ein absolutes No-Go bei längeren Spondylodesen ist eine Versteifung bis L5, hier sollte immer die Fusion bis zum Kreuzbein erfolgen, obwohl im lumbosakralen Segment eine hohe Pseudarthrosegefahr besteht, vor allem bei Patienten >55a und mit thorakolumbaler Kyphose.<sup>27</sup> Hier empfiehlt sich einerseits eine vordere Segmentabstützung mit ALIF („anterior lumbar interbody fusion“), PLIF und großem TLIFKäfig („Acron“), andererseits eine spezielle Konstruktion von mehreren Sacrumschrauben oder besser zusätzlichen Beckenschrauben zu den S1-Schrauben. Wir führten in dieser Serie mehrere AxiaLIF-Stabilisierungen L5/S1 mit guter Stabilität durch,<sup>28, 29</sup> mussten aber von diesem Implantat wegen sehr seltener Rektumperforationen beim Einbringen Abstand nehmen.<br /> Bei noch mobilen Hyperkyphosen, die sich im Tagesverlauf verstärken und sich beim passiven Korrekturversuch deutlich verringern, kann eine reine dorsale Spondylodese erfolgreich sein, fast immer notwendig bis zum Kreuzbein/Becken. Bourghli et al. berichten über sehr zufriedenstellende Ergebnisse mittels Th2-Sakrum- Fusionen in solchen Fällen.<sup>26</sup> Bei Patienten mit fixierter Deformität muss die Kyphose korrigiert werden, meist durch PSO, eine allerdings ziemlich komplikationsträchtige OP-Technik,<sup>30</sup> eventuell sogar in Kombination mit längerstreckiger dorsaler Spondylodese. In manchen Segmenten kann dann die Gelenksresektion mit dorsaler Kompression (Smith- Peterson-Osteotomie) zusätzliche Korrektur bringen. Man sollte eine möglichst korrekte Lordosierung anstreben, wir haben niemals eine Überkorrektur durch die PSO gesehen.<br /> Bei sehr massiver Rigidität nach älteren Wirbelkörpereinbrüchen kann ein dreifaches Vorgehen notwendig sein. Wir hatten diese Situation in einem Fall: zunächst dorsale Facettenresektionen der frakturierten Wirbel, dann ventral die Wirbelkörperresektionen und abschließend von dorsal die instrumentierte Spondylodese; der Eingriff wurde an einem Tag durchgeführt und verlief komplikationslos.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Camptocormia und „Bent spine“-Syndrom betreffen Patienten mit MP in 7 % , besonders bei schwerer Verlaufsform und voroperierter Wirbelsäule. Man geht davon aus, dass eine progrediente Schwäche der Rückenstreckmuskeln dafür verantwortlich ist. Die Kyphosierung ist in der Anfangsphase durch Nachtruhe reversibel, kann aber bald fixiert sein. Das Typische an der Skoliosierung ist das Fehlen einer ausgleichenden Gegenkrümmung, sodass die Betroffenen immer mehr nach seitlich aus dem Lot kippen („Pisa-Syndrom“). Zusätzliche Faktoren für eine Deformität sind die statistisch signifikante Häufung einer Osteoporose und dadurch bedingte Wirbelkörpereinbrüche.<br /> Diese Deformitäten sind dopaminresistent, auch andere konservative Behandlungen wie Mieder und Physiotherapie können die fortschreitende Deformierung nicht aufhalten. Bei schweren, sehr schmerzhaften Fällen, die mit einer massiven Einschränkung der Lebensqualität einhergehen, ist daher die operative Korrektur und Stabilisierung angezeigt.<br /> Zusammenfassend empfehlen wir die frühzeitige OP in noch mobilem Zustand der Deformierung als langstreckige Spondylodese mit deutlich geringeren Komplikationsgefahren als bei Aufrichtungseingriffen. Hiermit gelingt es auch deutlich leichter, eine korrekte spino-pelvische Balance mit korrekter lumbaler Lordose und gutem globalem sagittalem Alignment herzustellen, die für ein befriedigendes Ergebnis wesentlich sind.<sup>31</sup> Rigide Kyphosen erfordern eine PSO, anguläre Kyphosen nach Wirbelkörperfrakturen ein kombiniertes ventrodorsales Vorgehen mit Resektion, Wirbelersatz und dorsaler Stabilisierung.<br /> Wir empfehlen bei solchen Eingriffen unbedingt ein Neuromonitoring, das die korrekte Einbringung von Pedikelschrauben sowie die rasche Erkennung von neurologischen Problemen während der Lordosierungsphase einer PSO ermöglicht und ein ständig überprüfbares EMG der Kennmuskeln erlaubt.<sup>32</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Neuro_1805_Weblinks_s20_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1701" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Neuro_1805_Weblinks_s20_abb2.jpg" alt="" width="1417" height="1080" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Neuro_1805_Weblinks_s20_abb3.jpg" alt="" width="2149" height="1080" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Melamed E, Djaldetti R: J Neurol 2006; 253(Suppl 7): VII 14-8 <strong>2</strong> Tiple D et al.: J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80(2): 145-8 <strong>3</strong> Wunderlich S et al.: Mov Disord 2002; 17(3): 598-600 <strong>4</strong> Duvoisin RC, Marsden CD: J Neurol Neurosurg Psychiatry 1975; 38(8): 787-93 <strong>5</strong> Bezza A et al.: Rheumatol Int 2008; 28(12): 1205-9 <strong>6</strong> Pang MY, Mak MK: Mov Disord 2009; 24(8): 1176-82 <strong>7</strong> Lenoir T et al.: Eur Spine J 2010; 19(8): 1229-37 <strong>8</strong> Azher SN, Jankovic J.: Neurology 2006; 65(3): 355-9 <strong>9</strong> Umemura A et al.: J Neurosurg 2010; 112(6): 1283-8 <strong>10</strong> Charpentier P et al.: Rev Neurol 2005; 161(4): 459-63 <strong>11</strong> Kuo SH et al.: Muscle Nerve 2009; 40(6): 1059- 63 <strong>12</strong> Lepoutre AC et al.: J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77(11): 1229-34 <strong>13</strong> Nallegowda M et al.: Am J Phys Med Rehabil 2004; 83(12): 898-908 <strong>14</strong> Bonneville F et al.: Eur Radiol 2008; 18(8): 1710-9 <strong>15</strong> Yokochi F: J Neurol 2006; 255(3): 450-1 <strong>16</strong> Gdynia HJ et al.: Parkinsonism Relat Disord 2009; 15(9): 633-9 <strong>17</strong> You SH et al.: Congress Biomechanics Proceedings 2002; http://www.tulane. edu/~sbc2003/pdfdocs/1017.PDF <strong>18</strong> Bartynski WS et al.: Am J Neurorad 2005; 26: 2077-85 <strong>19</strong> Kamanli A et al.: Aging Clin Exp Res 2008; 20(3): 277-9 <strong>20</strong> Wadia PM et al.: J Neurol Neurusurg Psychiatry 2011; 82: 364-8 <strong>21</strong> de Seze MP et al.: J Rehabil Med 2008; 40(9): 761-5 <strong>22</strong> Babat LB et al.: Spine 2004; 29(18): 2006-12 <strong>23</strong> Upadhyaya CD et al.: Neurosurg Focus 2010; 28(3): E5 <strong>24</strong> Moon SH et al.: J Spinal Disord Tech 2012; 25(7): 351-5 <strong>25</strong> Nakashima H et al.: Orthopedics 2009; 32(10): doi: 10.3928/01477447- 20090818-21 <strong>26</strong> Bourghli A et al.: J Spinal Disord Tech 2012; 25(3): E 53-60 <strong>27</strong> Kim YJ et al.: Spine 2006; 31(20): 2329-36 <strong>28</strong> Lack W et al.: Eur Spine J 2010; 19: 2052-3 <strong>29</strong> Boachi-Adjei O et al.: Eur Spine J 2013; 22(Suppl 2): S225-31 <strong>30</strong> Hyun SJ et al.: J Korean Neurosurg Soc 2010; 47(2): 95-101 <strong>31</strong> Koller H et al..: Eur Spine J 2010; 19(10): 1785-94 <strong>32</strong> Lack W et al.: Eur Spine J 2010; 19(11): 2052</p>
</div>
</p>