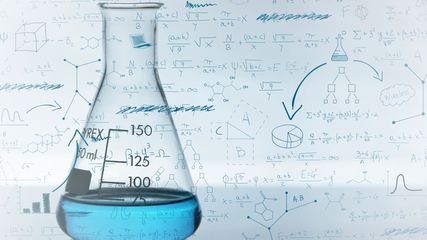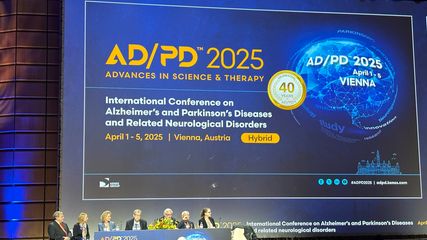Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln
Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, evidenten Therapiekonzepten wie dem Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) sind die Anpassung einer Gaumensegelplatte und die Elektrostimulation effiziente Therapiemaßnahmen.
Keypoints
-
Dysarthrien zeigen sich in verschiedensten Ausprägungen. Eine logopädische Diagnostik ist Grundlage für eine individuell abgestimmte Therapie.
-
Die Anpassung einer Gaumensegelplatte bietet eine rasche Möglichkeit zur Verbesserung der Sprechverständlichkeit.
Sprechen ist für uns selbstverständlich. Dabei produzieren wir unbewusst mit differenzierten Artikulationsorganen rasch abwechselnde Laute, welche stimmhaft oder stimmlos sind, nasal oder oral gelenkt werden. Der respiratorische Anblasedruck ermöglicht den Stimmklang, dynamische und prosodische Variationen. Übergeordnete sprachliche Prozesse werden durch Vigilanz, Kognition und Zugriff auf Wissen beeinflusst.1 Die Verständlichkeit ist von Tonhöhenverlauf, Dauer, Pausen, Dynamik sowie Stimmklang und der Artikulationspräzision abhängig. Das Sprechen wird vom eigenen akustischen und sensomotorischen Feedback beeinflusst. Die Lautbildung ist idiomabhängig, d.h. je nach Dialekt oder Region kann es zu Verschiebungen der Artikulationsbereiche (z.B. tirolerisches „ch“) oder Bildungsweisen (apikales vs. dorsales „r“) kommen.
Begriffe
Dysarthrien sind erworbene zentrale Störungen von sprechmotorischen Abläufen.2 Je nach Ausprägung der Symptomatik wird von einer Dysarthrophonie (hier steht die Stimmstörung im Vordergrund), von einer Dysarthropneumophonie mit zusätzlicher Beeinträchtigung der Atmung oder von Anarthrie, also dem Unvermögen, sich artikulatorisch auszudrücken, gesprochen. Diese Störungen treten meist in Kombination mit zentralen Paresen und Aphasien sowie anderen zentralen Begleiterscheinungen wie Apraxien, Sehstörungen oder Gedächtnisstörungen auf. Diese Kommunikationsstörung bedingt eine erhebliche Einschränkung im sozialen Kontakt sowie bei der Integration in Alltag und Arbeitsleben.3
Prävalenz dysarthrischer Störungsbilder
Dysarthrien sind mit >400 Betroffenen pro 100000 Personen die häufigste Form neurologisch bedingter Kommunikationsstörungen.4 Ca. 40% aller Schlaganfallpatient:innen leiden an einer Dysarthrie,5 wobei 57% der Betroffenen anhaltende Sprechstörungen sechs Monate nach Erstdiagnose aufweisen. Nach Schädel-HirnTraumen in der Akutphase sind 30–50%, bei Morbus Parkinson bis zu 90% und bei Multipler Sklerose 40–50% von einer Dysarthrie betroffen. Besonders schwere Verläufe sind bei Patient:innen mit amyotropher Lateralskelrose (ALS) zu beobachten, sie leiden aufgrund der bulbären Symptomatik unter einer hochgradigen Dysarthrie kombiniert mit einer schweren Dysphagie.2
Symptomatik
Die Symptome können in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen auftreten. Störungen der Respiration und Phonation bedingen eine Koordinationsstörung der Sprechatmung, eine sogenannte Sprechdyspnoe, mit erheblichen Zeichen von Sprechanstrengung. Der Stimmklang zeigt sich rau, gepresst oder behaucht bis hin zur stärksten Ausprägung der Aphonie. Stimmabbrüche oder Stimmzittern als unwillkürliche rhythmische Oszillationen der Stimmlippenmuskulatur sind häufig. Zu leise oder zu laute Stimmgebung sowie Störungen der Prosodie, also ein verlangsamtes, monotones Sprechen, treten als typische Symptome der extrapyramidalen Erscheinungsform auf. Die Hypernasalität, bedingt durch eine Gaumensegelparese, führt zu einem hohen nasalen Luftverlust und zu einem geringen oralen Luftstrom. Dies bewirkt eine insuffiziente Stimulation der ausführenden Artikulationsorgane, eine Verarmung der Artikulationsbewegungen und somit eine schlechtere Verständlichkeit. Bewegungsstörungen beeinflussen die Artikulationsexaktheit und führen zu prosodischen Störungen.4 Dysarthrien treten aufgrund der sensiblen und motorischen Defizite häufig in Kombination mit Schluckstörungen auf. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, selbst ihren Speichel zu schlucken, weshalb es auch dadurch zu Unterbrechungen des Redeflusses kommt.
Klassifikation
Dysarthrien sind selten in isolierter, reiner Form zu finden. Unter den Klassifikationssystemen wird zwischen funktionellen und anatomischen Gesichtspunkten unterschieden. Es werden typische Symptomkombinationen aus motorischen Störungen der Extremitäten und Sprechmuskulatur eingesetzt, wie schlaffe, spastische, ataktische, hypokinetische, hyperkinetische Dysarthrien bzw. bulbäre, suprabulbäre, extrapyramidale, zerebelläre, kortikale Dysarthrie.6 Die Klassifikation von Dysarthrien beruht aus der Beurteilung der motorischen Störung in Kombination mit dem Höreindruck.1
Diagnostik
Die Diagnose erfolgt über die neurophonetische akustische Analyse der Dysarthriemerkmale, wobei auch festgehalten wird, welche Hirnnerven, Muskeln und Sprechfunktionen betroffen sind und wie schwerwiegend der Grad der Verständlichkeitseinschränkung ist. Die Beurteilung der Verständlichkeit dient der Einschätzung des Handicaps. Anhand der Prüfung von Einzelbewegungen werden Hirnnervendefizite bzw. Funktionsstörungen wie die Art der Auslenkung, des Tempos, der Sicherheit, der Symmetrie und Selektivität oder Mitbewegungen untersucht. Diese Bewegungen sind häufig jedoch keinen Lautproduktionen zuzuschreiben und lassen keine Rückschlüsse auf die Sprechfunktion zu. Die Prüfung von Maximalleistungen wie beispielsweise Silbendiadochokinese und Tonhaltedauer sind stark motivationsabhängig und einem Lerneffekt bzw. Ermüdungseffekt unterlegen.
Zusätzlich werden apparative Untersuchungen wie die Dynamometrie zur Messung der Lippen- und Zungenkraft angewandt, wobei festzuhalten ist, dass beim Sprechvorgang eine hohe intraindividuelle Variabilität und Geschlechtsabhängigkeit bestehen, und die Maximalkraft nur zu 20% für den Sprechvorgang relevant ist.2 Sprachsignalanalysen (Stimmfeldmessungen), Elektromyografien und -palatografien, Endoskopie bzw. Stroboskopie sowie die Nasometrie und Messung der Kieferöffnung ergänzen die apparativen Untersuchungen.4
Im deutschsprachigen Raum haben sich unter den logopädischen Testverfahren die Bogenhausener Dysarthrieskalen (BoDys) als auditives Diagnostikmaterial, das ausschließlich die gesprochene Sprache beurteilt, durchgesetzt.7 Anhand von neun Skalen zu Atmung, Stimme, Artikulation, Resonanz, Redefluss und Modulation werden die Merkmale der Sprechstörung beurteilt. Der Schweregrad der Dysarthrie wird in sehr schwer, schwer, mittelschwer und leicht eingeteilt.7 Für Kinder wurde das analoge Testmaterial BoDyS-KiD veröffentlicht.8 Um die Verständlichkeit der Betroffenen noch genauer und objektiv einzuschätzen, besteht die Möglichkeit, mithilfe eines telediagnostischen, crowdbasierten Verfahrens, des Kommunikationsparameters für Sprechstörungen (KommPaS), eine Untersuchung durch sprachtherapeutische Laien mit der Muttersprache Deutsch durchzuführen. Die Aufnahmen werden verschlüsselt an eine deutsche Crowdsourcing-Plattform weitergeleitet, wo sie online strukturiert beurteilt werden.9 Durch den stetigen Fortschritt in der automatischen Spracherkennung werden die Erkennung und Klassifizierung des Schweregrads von Sprechstörungen mithilfe von digitalen Assessments möglich werden. Schwierigkeiten bereiten die Differenzierung von Dialekten, prosodischen Merkmalen und prämorbiden Individualitäten der Sprecher:innen.
Differenzialdiagnostik
Differenzialdiagnostisch sind Dysarthrien von den Dysglossien abzugrenzen, welche durch Schädigungen der Muskulatur oder anderer peripherer Strukturen bedingt sind. Kindliche Dysarthrien, hervorgerufen durch genetische Syndrome oder Zerebralparesen, sind von Sprachentwicklungsstörungen zu unterscheiden. Hier sind die Artikulationsprozesse durch Paresen beeinträchtigt und bedingen eine intensive logopädische Betreuung während des Sprach- und Lauterwerbs, um eine verständliche Kommunikation zu schaffen.
Schwierig ist die Abgrenzung zu zentralen Sprachstörungen den Aphasien, da diese häufig kombiniert auftreten bzw. die Differenzierung von phonematischen Paraphasien nicht einfach gelingt. Hier ist die Diagnostik der Logopädie wesentlich, um die Sprachstörung mit evtl. bestehenden Verständnisstörungen, Wortabrufstörungen und grammatikalischen Entgleisungen festzuhalten. Noch komplexer ist die Abgrenzung zur Sprechapraxie, welche ebenfalls eine zentrale Sprechstörung darstellt. Die Läsionsorte liegen hier auf der sprechdominanten Hemisphäre, während Dysarthrien davon unabhängig in Erscheinung treten. Dysarthrische Fehlermuster sind konstanter und konsistenter, wobei Tagesschwankungen zu berücksichtigen sind. Bei der Sprechapraxie bestehen meist keine stimmlichen oder respiratorischen Störungen, und es kommt zu Inseln störungsfreier Produktion. Hier bleiben besonders Sprechautomatismen wie Reihensprechen und Begrüßungsfloskeln erhalten, während es in der Spontansprache zu einem Such- und Korrekturverhalten kommt.10
Therapie
In der logopädischen Therapie wird auf die Restitution der beeinträchtigten Funktionen, die Kompensation durch vorhandene Fähigkeiten, die bewusste Durchführung von automatisierten Sprechbewegungen und bewusste Selbstkontrolle des Sprechens geachtet.4 Zudem sind der frühe Therapiebeginn und die Motivation der Betroffenen für einen Therapieerfolg wesentlich. Die Ziele der logopädischen Therapie sind eine sprechadäquate Atemführung, die Förderung der Motilität der Artikulationsorgane, die Verbesserung der oralen sensorischen Fähigkeiten und der auditiven Diskriminationsfähigkeit sowie die Lautanbahnung und -festigung. Bei den Therapiekonzepten zeigt das LSVT insbesondere in der Behandlung von Dysarthrien bei Morbus Parkinson fundierte Evidenz. Der Stimme wird ein besonderer Einfluss auf die Verständlichkeit zugewiesen. Durch die Erhöhung der Lautstärke werden Verbesserungen des Atemvolumens und ein suffizienter Glottisschluss fazilitiert. Dadurch werden die weitere Öffnung des Vokaltraktes sowie größere Artikulationsbewegungen erreicht. Durch den hohen Krafteinsatz („high effort“) wird die Hypokinese überwunden. Das Konzept beinhaltet ein intensives Training von vier Wochen und gibt strukturierte Übungen vor.11Zudem werden Kommunikationsstrategien wie die Sprechtempokontrolle anhand von Silbenbrettern oder Pacing Boards (Abb. 1), bewusstes Überartikulieren, Buchstabieren und die Betonung von Schlüsselworten trainiert. Singen beeinflusst die Stimmlippenbeweglichkeit, steigert die Aktivität der Atemmuskulatur sowie die artikulatorische Exaktheit und kann motivationsfördernd sein. Bei Kieferdystonien sowie ataktischen bzw. zentralparetischen sprechmotorischen Störungen bieten Beißblöcke und Korken einfache mechanische Hilfen für den Sprechvorgang. Der Einsatz von digitalen Kommunikationshilfen kann frühzeitig erfolgen. Eine elektronische Sprachausgabe kann mittels Tasten-, Mund- oder Augensteuerung bedient werden und findet besonders bei sehr schweren Formen, wie sie bei ALS auftreten, Anwendung.
Die computergesteuerten Systeme werden speziell bei Kindern mit Dysarthrien eingesetzt. In der Akutphase können Symboltafeln mit Piktogrammen, Buchstaben- oder Worttafeln verwendet werden, anhand deren die Betroffenen den Kommunikationspartnern mittels Mimik oder Gestik die gewünschten Symbole zeigen.
Gaumensegelprothese bzw. -platte
Der adäquate velopharyngeale Verschluss ist wesentlich für die Verständlichkeit, daher sind Gaumensegelprothesen bzw. -platten, welche die orale Umlenkung des Luftstroms bei Hypernasalität ermöglichen, hilfreich. Da der Anpassungsvorgang zeit- und personalintensiv ist, gibt es bisher nur wenige Therapeut:innen oder Institutionen, die eine Versorgung anbieten.
Tipps im Umgang Patient:innen
Sprechen Sie in Ruhe mit den Betroffenen. Meist sind die kognitiven Fähigkeiten nicht beeinträchtigt, jedoch ist ihre Sprechweise unnatürlich. Nutzen Sie Kommunikationshilfen und konzentrieren Sie sich auf die Inhalte. Wiederholen Sie Abschnitte, bei denen Sie sich inhaltlich unsicher waren, und beobachten Sie dabei die Mimik und Gestik der Betroffenen.Die individuell angepasste Silikonplatte bewirkt einerseits einen Stützeffekt für das Velum, andererseits entsteht ein Stimulationseffekt auf die nervalen und muskulären Funktionen, der als Memory-Effekt auch nach Entfernung der Platte wirksam ist (Abb. 2). Vor der Anpassung ist eine logopädische und endoskopische Diagnostik notwendig, um dem möglichen Würgen mit einer Desensibilisierungsbehandlung bzw. dem übersteigerten Speichelfluss durch das entstehende Fremdkörpergefühl mit pharmakologischen Maßnahmen (z.B. Scopolamin, Robinul©, Botulinumtoxin) entgegenzuwirken. Zudem muss die Platte so angepasst werden, dass die Nasenatmung erhalten bleibt bzw. eine Hyponasalität vermieden wird. Anfängliche Schluckprobleme werden meist rasch kompensiert.
Elektrostimulation
Mithilfe der funktionellen und der neuromuskulären Elektrostimulation wird die dauerhafte Restitution der motorischen Fähigkeiten angebahnt. Insbesondere die mimische Muskulatur, die Stimmlippen, die Zunge, das Gaumensegel, die Kaumuskulatur und der Pharynx können speziell stimuliert werden. Forschungstrends sind die transkranielle Magnetstimulation (TMS) und die transkraniale Gleichstromstimulation (TDCS), wobei positive Effekte auf die Sprachverständlichkeit und -flüssigkeit bei Patient:innen mit Morbus Parkinson nachgewiesen werden konnten.12
Pharmakologische Maßnahmen
Die Behandlung mit Botulinumtoxin bei spasmodischer Dysphonie und Dystonien im Artikulationsbereich ist etabliert,4 die Augmentation der Rachenhinterwand mittels Hyaluronfillern verringert den nasalen Luftverlust und führt zu einer Verständlichkeitsverbesserung.
Literatur:
1 Kroker C et al.: Dysarthrie als Störung des Zeittaktes. Grundlagen für eine innovative Therapie. 1. Auflage. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 2018 2 Ziegler W, Vogel M: Dysarthrie. Verstehen – untersuchen – behandeln. [1. Aufl.]. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag (Forum Logopädie). Online verfügbar unter https://swbplus.bsz-bw.de/bsz307964590idx.htm 2010 3 Brady MC: The impact of stroke-related dysarthria on social participation and implications for rehabilitation. Disab Rehabil 2011; 33(3): 178-86 4 Baumgärtner A, Staiger A: The impact of stroke-related dysarthria on social participation and implications for rehabilitation. 2022; 61(1): 52-70 5 Mitchell C et al.: Interventions for dysarthria due to stroke and other adult-acquired, non-progressive brain injury. Cochrane Database Syst Rev 2017; 1(1): CD002088 6 Darley F et al.: Motor speech disorders. Philadelphia: Saunders, 1975 7 Ziegler W et al.: Die Bogenhausener Dysarthrieskalen (BoDyS): Ein standardisierter Test für die Dysarthriediagnostik bei Erwachsenen. Sprache Stimme Gehör 2015; 39 (04): 171-5; doi: 10.1055/s-0041-102792 8 Haas E et al.: Dysarthriediagnostik mit Kindern – das Testmaterial der BoDyS-KiD. Sprache Stimme Gehör 2020; 44(04): 189-93; doi: 10.1055/a-1207-3491 9 Lehner K et al.: Clinical measures of communication limitations in dysarthria assessed through crowdsourcing: specificity, sensitivity, and retest-reliability. Clin Linguist Phon 2022; 36(11): 988-1009 10 Ziegler W et al.: Sprechapraxie. Grundlagen – Diagnostik – Therapie. Berlin, Heidelberg: Springer (Lehrbuch) 2020 11 Bryans LA et al.: The impact of Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD®) on voice, communication, and participation: Findings from a prospective, longitudinal study. J Commun Disord 2021; 89: 106031 12 Chen K et al.: A systematic review of the efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in treating dysarthria in patients with Parkinson‘s disease. Front Aging Neurosci 2025; 17: 1501640
Das könnte Sie auch interessieren:
Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?
Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...