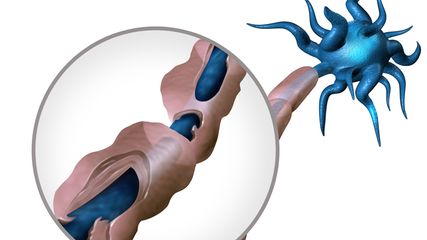Neue Empfehlungen zu ALS, Blasen-und Sexualdysfunktion, HyperCKämie
Bericht:
Dr. Lydia Unger-Hunt
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die neuen, überarbeiteten Leitlinien wollen nicht nur die neuesten Erkenntnisse bezüglich dieser Störungen berücksichtigen, sondern auch eine möglichst praxisnahe Unterstützung für den niedergelassenen Bereich bieten, sagen die vorstellenden Experten am diesjährigen EAN-Kongress in Budapest.
„Nicht so selten wie vielleicht gedacht“ ist die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) mit einem kumulativen Lebensrisiko von 1/40, erinnert Univ.-Prof. Dr. Philip Van Damme von den Universitätskrankenhäusern Löwen in Belgien. Die Ätiologie ist heterogen – mehr als 30 Gene sind bereits impliziert worden –, hingegen ist die Neuropathologie sehr homogen: 97% der Betroffenen weisen eine Pathologie im TDP-43 auf, dem „Schlüsselprotein“ der ALS.
ALS: breit gefächerte Problematik ansprechen
Die neuen Guidelines sollen noch 2023 veröffentlicht werden. Sie zielen darauf ab, nicht „nur“ die wichtigen Bereiche wie die krankheitsmodifizierenden Therapien (DMT) oder die multidisziplinäre Betreuung abzuhandeln, sondern vor allem auch „die breit gefächerte Problematik der Krankheit darzustellen“, so Prof. Van Damme: Dazu zählen etwa Mangelernährung, Muskelkrämpfe, Sialorrhö oder Depression; auch die Betreuung am Lebensende ist Thema. Ein weiteres Problem bei ALS ist die frontotemporale Degeneration (FTD): 10% weisen diese Störung auf, 50% sind kognitiv nicht beeinträchtigt, und bei den restlichen 40% liegt eine „gewisse kognitive oder verhaltensbezogene Störung vor, die das Management beeinträchtigen kann“. Die neuen Leitlinien empfehlen daher, nach Möglichkeit einzuschätzen, ob die Person die Behandlung wahrscheinlich akzeptieren und damit umgehen kann.
Auszug aus den Empfehlungen
Die multidisziplinäre Behandlung ist ein wesentlicher Grundpfeiler des Managements, sie verbessert laut Evidenz aus (zumeist) Beobachtungsstudien die Outcomes.
DMT: Die Wirksamkeit des Glutamat-Antagonisten Riluzol wurde in mehreren randomisiert-kontrollierten Studien (RCT) nachgewiesen, der Wirkstoff ist daher allen ALS-Patient:innen lebenslang anzubieten. Bei Auftreten unerwünschter Ereignisse (AE) ist die Dosis zu reduzieren und der Fall neu zu evaluieren; bei anhaltenden AE ist der Therapieabbruch zu erwägen. Allerdings: „Die Frage nach dem optimalen Zeitpunkt dieser Therapieeinleitung ist nach wie vor offen“, kommentiert Van Damme. Für zwei vielversprechende neue Wirkstoffe mit FDA-Zulassung, Edaravon und AMX0035, gibt es eine temporäre Empfehlung; in die finale Empfehlung sollen noch die Ergebnisse der entsprechenden Phase-III-Studien einfließen.
Die Gene-silencing-Therapie Tofersen zum Silencing des Superoxid-Dismutase-1- (SOD1)-Gens hat aufgrund des „klaren Nutzens der langfristigen Therapie“ eine Empfehlung als Erstlinientherapie bei progressiver ALS aufgrund pathogener SOD1-Mutationen. Cave: In rund 5% treten schwere AE auf, eine entsprechende Aufklärung ist hier erforderlich. In den meisten EU-Ländern ist Tofersen übrigens über ein Early-Access-Programm verfügbar, die EMA-Entscheidung wird für den Herbst erwartet. Und: Laut Prof. Van Damme sind viele Betroffene auch an Stammzell-basierten Therapien interessiert. Diese können jedoch derzeit – bis zum Vorliegen positiver Phase-III-Trial-Daten – „nur im Rahmen klinischer Studien empfohlen werden“.
Gastrostomie nur nach nichtinvasiver Ventilation
Für einen Nutzen der Gastrostomie ist empirische Evidenz vorhanden. Diese Option ist bereits frühzeitig und auch wiederholt im Krankheitsverlauf zu besprechen, betont der belgische Experte: Da manche den Eingriff ablehnen oder zumindest verzögern möchten, ist eine zeitnahe Aufklärung über den Nutzen einer frühen Intervention, aber auch über das Risiko des späten Eingreifens (kritisch niedriges Körpergewicht, respiratorische Komplikationen, Dehydrierungsrisiko) von großer Bedeutung. Bei respiratorischer Insuffizienz wird die Gastrostomie erst nach Etablierung einer nichtinvasiven Ventilation (NIV) empfohlen. NIV ist außerdem allen ALS-Patient:innen mit Symptomen oder Zeichen der respiratorischen Insuffizienz anzubieten, unabhängig von der Bulbärfunktion.
Bei Muskelkrämpfen kommen Natriumblocker, Gabapentin, Pregabalin oder Baclofen zum Einsatz; Quininsulfat sollte „nur in niedriger Dosierung und unter kardialer Überwachung“ eingesetzt werden. Bei Spastizität liegen RCT für Cannabinoide vor, bei fokaler Spastizität ist Botulinumtoxin eine Option. Bezüglich der für Betroffene „sehr wichtigen“ Sialorrhö ist die Aufklärung über speicheltreibende Getränke wie Milch ein wichtiges Thema; therapeutisch eingesetzt werden Anticholinergika und Botulinumtoxin, bei Versagen Strahlentherapie. Abschließend ein Ausblick: „In den nächsten zwölf Monaten soll die EMA drei neue Wirkstoffe für ALS evaluieren; wir hoffen, möglichst bald wieder aktualisieren zu können“, so Prof. Van Damme.
Blasendysfunktion und sexuelle Störungen
Beide Störungen treten häufig im Rahmen neurologischer Erkrankungen auf und sind mit einer „signifikanten Beeinflussung der Lebensqualität“ verbunden, erklärt Univ.-Prof. Dr. Jalesh N. Panicker von der Urologisch-Neurologischen Klinik am University College London. Hochqualitative Guidelines verschiedener Fachgesellschaften seien zwar vorhanden, aber „nicht immer für den praxisnahen niedergelassenen Bereich geeignet“. Die hier vorgestellten evidenzbasierten Leitlinien wurden von der European Academy of Neurology, der European Federation of Autonomic Societies und der International Neuro-Urology Society (NEAN-EFAS-INUS) zusammen mit einer Patientengruppe erstellt.
Blasensymptomatik: wann überweisen?
Blasensymptome sind aktiv zu erfragen, eine Harnkultur ist nur bei Verdacht auf Harnwegsinfekt (HWI) erforderlich; der Restharn ist sowohl beim Erstgespräch als auch bei klinischer Indikation zu erfassen. Bei Männern ab dem 50. Lebensjahr ist der PSA-Wert zu erheben (nach Besprechung mit dem Patienten). Hingegen wird die Urodynamik nicht bei der Erstevaluierung empfohlen, sondern nur bei Risiko für eine Pathologie der oberen Harnwege, ungewöhnlicher Symptomatik oder bei Versagen konservativer Behandlungsoptionen. „Red flags“ für die Überweisung an die Urologie sind das Risiko für eine Pathologie der oberen Harnwege, der Verdacht auf eine primäre urologische Pathologie, schlechtes Ansprechen oder signifikante Nebenwirkungen der Erstlinientherapie.
Konservativ steht die Beratung bezüglich der Flüssigkeitsaufnahme an erster Stelle; bei Drang- und/oder Stressinkontinenz ist Beckenbodentraining zu empfehlen; auch Vorrichtungen wie Einlagen oder Kondomkatheter können angeboten werden. Eine „relativ neue“ Empfehlung aufgrund ausreichender Evidenz bei überaktiver Blase ist die perkutane tibiale Nervenstimulation zur Hemmung der Detrusoraktivität. Antibiotika sind nicht routinemäßig einzusetzen; bei symptomatischen HWI von Katheterbenutzern sollte die Antibiotikagabe der Harnkultur folgen. Für die asymptomatische Bakteriurie werden Antibiotika nicht empfohlen (außer in spezifischen Umständen).
Medikamentös haben Anticholinergika bei überaktiver Blase eine starke Evidenz; Beta-3-Rezeptoragonisten verfügen über ausreichende Evidenz. Bei unzureichender Detrusoraktivität hingegen ist die Evidenz für Anticholinergika zwecks Blasenentleerung unzureichend. Desmopressin kann bei Nykturie empfohlen werden (cave Serumnatrium); bei Entleerungsstörungen können Alphablocker bei ausgewählten Personen zum Einsatz kommen.
„Red flags“ bei sexueller Dysfunktion
Ebenfalls aktiv zu erfragen sind sexuelle Probleme. Bei Vorhandensein sollten vaskuläre Labortests erfolgen (Nüchternblutzucker, HbA1c, Lipide); Testosteron nur bei Verdacht auf Hypogonadismus. Die weitere Diagnostik mittels MRI oder Neurophysiologie des Beckens ist nicht routinemäßig zu erheben. Zu den „red flags“ für die Überweisung zählen Schmerzen/Blutung während sexueller Aktivität, Anejakulation, Priapismus oder schlechtes Ansprechen auf die Standardbehandlung.
In der Behandlung steht die Aufklärung über beeinflussende Faktoren im Mittelpunkt. Bei Dyspareunie von Frauen können vaginale Gleitmittel erwogen werden, für Vibratoren gibt es keine Empfehlung. Bei Männern mit erektiler Dysfunktion gelten PDE-5-Hemmer als Erstlinienbehandlung. Für alle Empfehlungen gilt es, vorher mit der Patientin beziehungsweise dem Patienten umfassend die damit assoziierten Nutzen und Risiken zu besprechen, schließt Prof. Panicker.
Diagnostisches Vorgehen bei erhöhter Kreatinkinase
Rund 1,3% der Bevölkerung sind laut Schätzungen von einer persistenten Erhöhung der Kreatinkinase (HyperCKämie) betroffen, berichtet Univ.-Prof. Dr. Theodoros Kyriakides von der Universität Nikosia, Zypern. Die von ihm vorgestellten neuen EAN-Leitlinien zielen darauf ab, den möglichst raschen Nachweis einer zugrunde liegenden Myopathie zu erlauben, mit entsprechend zeitnaher Einleitung von Behandlung und Prognoseerstellung sowie Möglichkeit der genetischen Beratung für betroffene Familien.
An der Zeit wäre es, betont der Experte: Die letzten Leitlinien der EFNS (European Federation of Neurological Societies) stammen aus dem Jahr 2010. Was hat sich im Wesentlichen geändert? „Damals war der diagnostische Goldstandard die Muskelbiopsie – zu bedenken sind hier aber die Invasivität und das Risiko für Stichprobenfehler“, so Prof. Kyriakides. „Heute ist mit der Next-Generation-Sequenzierung die genetische Diagnose leichter zu erstellen, dieses Vorgehen ist erstrebenswert.“
Vorgehen in der Praxis
Eine Verdachtsdiagnose liegt laut Konsensus vor ab 1,5-fach erhöhter Kreatinkinase (CK); der Normwert für Frauen wird mit 210U/l angegeben, bei Männern 400U/l (Kaukasier). Konsensus herrschte auch bezüglich des zeitlichen Vorgehens: Zur Diagnose ist die CK-Messung nach frühestens 72 Stunden – vorzugsweise eine Woche später – zu wiederholen, wobei in diesem Zeitraum körperliche/muskelschädigende Aktivitäten und die Einnahme von Alkohol oder CK-erhöhenden Medikamenten zu vermeiden sind. Zur Bestätigung sollte die CK zweimal nach der Indexmessung wiederholt werden, mit mindestens einmonatigem Abstand. Zur Identifizierung eines möglichen myopathischen Hintergrunds wird die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit (NCS) beziehungsweise die Durchführung einer Elektromyografie (EMG) empfohlen. Bei Feststellung einer myopathisch bedingten HyperCKämie wird zur Identifizierung der zugrunde liegenden Ursache die Next-Generation-Sequenzierung empfohlen (NGS, auch als Hochdurchsatzsequenzierung bekannt). Bei Verdacht auf metabolische Myopathie werden Untersuchungen von Trockenblut, Nüchtern-Acyl-Carnitin und Milchsäure empfohlen. Bei Familien mit bekannter Mutation oder Patienten mit charakteristischem klinischem Phänotyp kann die gezielte Einzelgenanalyse erwogen werden.
Veränderungen im MRI können bereits vor einer klinischen Schwäche auftreten, erinnert Prof. Kyriakides. MRI-Untersuchungen des Muskels können zur Einstufung von Anomalien eingesetzt werden sowie zur Lenkung genetischer Texts, je nach beobachtetem Muster. Muskelbiopsien können in manchen Fällen erforderlich sein, um eine umfassende Phänotypisierung durchzuführen, sowie für die Untersuchung des Transkriptoms, um ein „besseres Verständnis der Folgen und Mechanismen der in NGS-Tests festgestellten Varianten zu erhalten“.
Quelle:
9. Kongress der European Academy of Neurology (EAN), 2. Juli 2023, Budapest
Literatur:
bei den Sprechern
Das könnte Sie auch interessieren:
Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS
Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...
Interdisziplinäre Therapie der intrazerebralen Blutung
Aktuelle Studienergebnisse brachten erstmals einen positiven Effekt operativer Therapieverfahren auf das funktionelle Outcome bei Patient:innen mit intrazerebraler Blutung. Für die ...
Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln
Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...