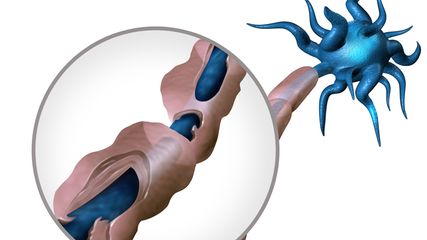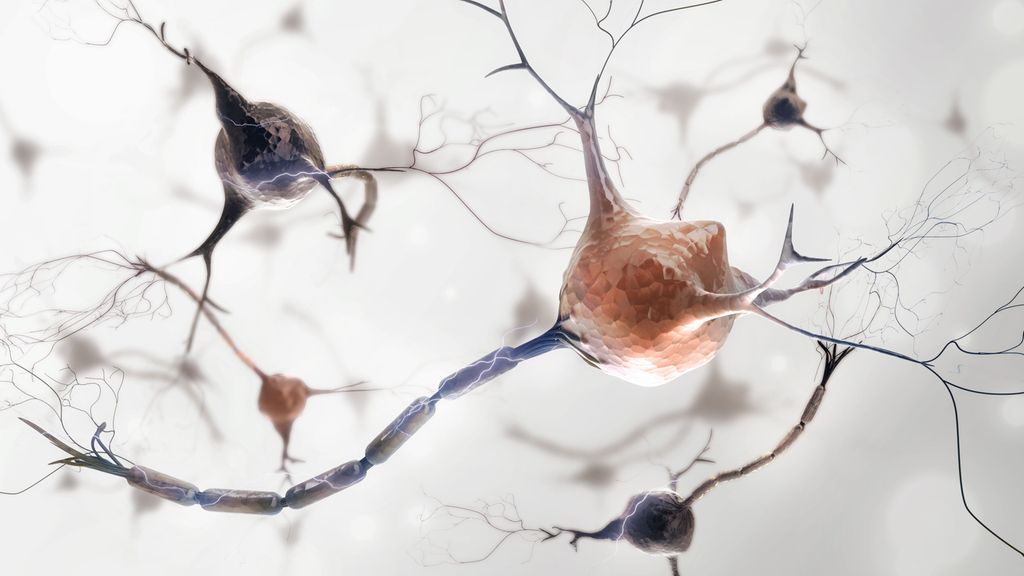
©
Getty Images/iStockphoto
Komplott der Nachbarin
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
29.06.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Viele Menschen mit Demenz leiden unter psychotischen Symptomen, vor allem unter optischen Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder dem Gefühl, die Mitmenschen seien durch Doppelgänger ausgetauscht. Das kann grosse Angst auslösen und belastet Angehörige und Pfleger. Zu einer Demenzabklärung gehört immer auch die Suche nach psychotischen Symptomen, erklärt Psychiater Prof. Gregor Hasler von der Universität Bern. Medikamente können den Betroffenen helfen, doch ebenso wichtig ist es, Stressfaktoren zu minimieren.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die alte Dame erzählt ihren Kindern, die Zimmernachbarin im Pflegeheim würde sie ständig beobachten. Sie würde nur auf den richtigen Moment warten, um ihren Schmuck zu klauen, da ist sich die Dame ganz sicher! Sie müsse ständig wachsam sein, am besten sollten die Kinder ihr einen Safe für den Schmuck mitbringen. Doch die Zimmernachbarin hat nicht vor, die Dame zu beklauen. Die Dame hat eine Demenz, und die Vorstellung, bestohlen zu werden, ist ein Zeichen ihrer Krankheit. Mediziner sagen dazu «psychotisches Symptom»: Die Betroffenen glauben etwas zu sehen oder zu hören oder sie spüren etwas, was nicht mit der Realität übereinstimmt. «Viele Demenzkranke leiden unter solchen Symptomen», sagt Prof. Gregor Hasler, Chefarzt und Extraordinarius der Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) der Universität Bern. «Wichtig ist, dass man solche Symptome erkennt und den Betroffenen hilft – nicht nur mit Medikamenten, sondern auch mit einfachen allgemeinen Massnahmen.»</p> <p>Schon 1907 beschrieb Alois Alzheimer psychotische Symptome bei Patienten mit Alzheimerdemenz<sup>1</sup> und erkannte bald, dass das mit Problemen verbunden ist: Die Demenz entwickelt sich bei den Demenzpatienten mit psychotischen Symptomen besonders schnell. «Demenzkranke mit psychotischen Symptomen sind öfter unruhig, aggressiv oder gar körperlich handgreiflich», sagt Hasler. «Das setzt Pflegende und Angehörige unter Druck.» Die Betroffenen würden oft sehr früh in ein Pflegeheim gebracht, erzählt der Psychiater, und einige Kollegen würden rasch Antipsychotika verschreiben. «Damit muss man aber vorsichtig sein», sagt Hasler. «Die Präparate können bei Demenzkranken schwerwiegende unerwünschte Wirkungen haben – wir sind da in einem ziemlichen Dilemma.» Menschen, die Demenzkranke mit psychotischen Symptomen pflegen, leiden häufiger unter der Pflegesituation, als wenn die Betroffenen diese Beschwerden nicht hätten.<sup>2</sup></p> <p>Lange Zeit seien sich Ärzte des Problems nicht richtig bewusst gewesen, erzählt Hasler. «Heute wissen wir aber, dass psychotische Symptome bei Menschen mit Demenz häufig vorkommen.» So zeigten Dr. Susan Ropacki und Dr. Dilip Jeste von der Abteilung für Psychiatrie der Universität Kalifornien und vom Veterans Affairs Healthcare System in San Diego in einer Übersichtsarbeit von 55 Studien, dass 4 von 10 Alzheimerpatienten unter solchen Symptomen leiden. Von diesen hat jeder Dritte Wahnvorstellungen und jeder Fünfte Halluzinationen. Andere Autoren fanden ähnliche Prävalenzen.<sup>1–3</sup></p> <p>Die Art der psychotischen Symptome unterscheidet sich bei den verschiedenen Demenzformen. Für die Lewy-Körperchen-Demenz seien zum Beispiel optische Halluzinationen typisch, erklärt Hasler. «Die Patienten sehen oft Menschen oder grosse Tiere und beschreiben das sehr eindrücklich – das ist auch ein wichtiges Zeichen bei der Diagnose dieser Demenzform.» Seltener sind die Patienten von akustischen Halluzinationen betroffen. «Das ist eher typisch für Schizophrenie», so Hasler. Bei Menschen mit Alzheimerdemenz machen sich psychotische Symptome öfter als Wahnvorstellungen bemerkbar, wie bei der alten Dame: «Die Betroffenen glauben, sie würden bestohlen, jemand habe sich gegen sie verschworen, oder sie sind krankhaft eifersüchtig.» Der Wahn kann sich auch so äussern, dass die Betroffenen glauben, eine nahestehende Person sei mit einer identischen Person, einem Doppelgänger, ausgetauscht worden. «Das ist auch als Capgras-Syndrom bekannt», erklärt Hasler. «Der französische Psychiater Jean Marie Joseph Capgras hat das 1923 zum ersten Mal beschrieben.»</p> <p>Dass es zu psychotischen Symptomen kommt, hat mehrere Ursachen. Zum einen liegt es an den neurodegenerativen Prozessen, die die Demenz im Hirn verursacht. Hirnaufnahmen zeigten bei Alzheimerpatienten mit psychotischen Symptomen ausgeprägtere Schäden in den kortikalen Synapsen als bei Patienten ohne diese Symptome, sie hatten weniger Hirnvolumen in der grauen Substanz, einen reduzierten regionalen Blutfluss und einen verringerten Glukosemetabolismus.<sup>4</sup> Eine weitere Rolle spielt die Genetik: Das Risiko für die psychotischen Symptome bei Demenz wird teilweise vererbt. Die spezifischen genetischen Risikofaktoren, welche die Vererbung erklären würden, wurden bislang aber noch nicht identifiziert.<sup>5</sup></p> <p>Hinzu kommt, dass bei Demenzkranken der Bezug zur Realität und das Gedächtnis nachlassen, was das wahnhafte Erleben fördert. Ein dritter Punkt ist, dass bei älteren Menschen die Sinneswahrnehmungen schwinden, vor allem hören sie schlechter. «So könnte der Betroffene ein Geräusch, welches wir als Blätterrauschen wahrnehmen, für Flüstern der Nachbarn halten, und weil sein Hirn den Sinneseindruck nicht richtig verarbeiten kann, hat er die Wahnvorstellung, die Nachbarn wollten sich gegen ihn verschwören», erklärt Hasler. «Hört ein Demenzkranker nicht mehr gut, können Hörgeräte verhindern, dass solche Vorstellungen entstehen.» Eine weitere Rolle scheint die Genetik zu spielen: Die psychotischen Symptome deuten auf einen schlechten Verlauf hin, so die Übersicht von Ropacki und Jeste: Alzheimerpatienten mit psychotischen Symptomen haben häufiger eine eingeschränkte kognitive Funktion, und sie lässt rascher nach als bei Patienten ohne psychotische Beschwerden.<sup>1</sup></p> <p>Essenziell sei, bei jedem Patienten mit Demenz nach psychotischen Symptomen zu suchen. «Man muss den Patienten explizit nach seinen Ängsten, Befürchtungen und Sinneserfahrungen fragen», sagt Hasler. «Auch Angehörige und Betreuer können wertvolle Informationen liefern, zum Beispiel wenn sie über ein chaotisches, unverständliches und aggressives Verhalten berichten.» Angehörige und Pflegende seien oft erleichtert, wenn er die Diagnose stelle. «Endlich haben sie eine Erklärung für das merkwürdige Verhalten. Und sie erfahren, dass wir solche Symptome kennen und Therapievorschläge machen können. Das gibt Sicherheit und eine Perspektive.»</p> <p>Atypische Antipsychotika sind die Therapie der Wahl. «Man muss aber berücksichtigen, dass diese Präparate bei Demenzbetroffenen das Risiko für Schlaganfälle, Bewegungsstörungen, Stürze, Diabetes und Herzrhythmusstörungen erhöhen», gibt Hasler zu bedenken. «Hier müssen wir jeweils individuell überlegen, ob das Medikament sinnvoll ist.» Bei der Wahl des Antipsychotikums sei das Nebenwirkungsprofil der Substanz oft entscheidend. So sollte man beispielsweise Medikamente mit ausgeprägten metabolischen Nebenwirkungen bei Vorliegen eines metabolischen Syndroms vermeiden. Verlängert ein Antipsychotikum die QT-Zeit stark, was zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen führen kann, wechselt man auf ein anderes, bei dem diese Nebenwirkung geringer ist.</p> <p>Regelmässig solle man prüfen, ob das Antipsychotikum noch notwendig sei, etwa indem man die Dosis reduziere. «Psychotische Symptome wie Wahn und Halluzinationen lassen bei vielen nämlich mit der Zeit nach», erklärt Hasler. So bilden sich solche «positiven» Symptome eher zurück als negative wie Apathie oder Depressionen.<sup>6</sup> Bei aggressiven Symptomen verschreibt Hasler manchmal Valproinsäure, SSRI oder Benzodiazepine. Hier muss man aber noch sorgfältiger überlegen, ob das notwendig ist. «Zum einen haben wir hier nicht so gute Wirksamkeitsbelege wie bei Antipsychotika», sagt er, «zum anderen können natürlich auch diese Präparate unerwünschte Wirkungen auslösen.» Mindestens ebenso wichtig wie Medikamente seien psychosoziale Interventionen. «Alles, was den Betroffenen stressen könnte, sollte man vermeiden – das wirkt erstaunlich gut», sagt Hasler. Zum Beispiel den Betroffenen vom Zimmer an einer lauten Strasse in ein ruhigeres bringen oder den Fernseher nicht ständig laufen lassen. «Man muss mit dem Betroffenen schauen, was ihm am besten hilft», sagt Hasler. Bei manchen Patienten verringern sich die psychotischen Symptome nicht so sehr durch mehr Ruhe, sondern wenn man sie mehr stimuliert, etwa mit Ergotherapie oder einem Therapiehund. «So ein vierbeiniger Freund kann manchmal die imaginären bösen Nachbarn besser vertreiben als Antipsychotika.»</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Ropacki SA, Jeste DV: Am J Psychiatry 2005; 162: 2022-2030 <strong>2</strong> Hessler JB et al: Epidemiol Psychiatr Sci 2017; 9: 1-10 <strong>3</strong> Paulsen JS et al: Neurology 2000; 54: 1965-1971 <strong>4</strong> Wilkosz PA et al: Am J Geriatr Psychiatry 2006; 14: 352-360 <strong>5</strong> Murray PS et al: Biol Psychiatry 2014; 75: 542-552 <strong>6</strong> Van der Linde RM et al: Br J Psychiatr 2016; 366-377</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS
Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...
Interdisziplinäre Therapie der intrazerebralen Blutung
Aktuelle Studienergebnisse brachten erstmals einen positiven Effekt operativer Therapieverfahren auf das funktionelle Outcome bei Patient:innen mit intrazerebraler Blutung. Für die ...
Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln
Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...