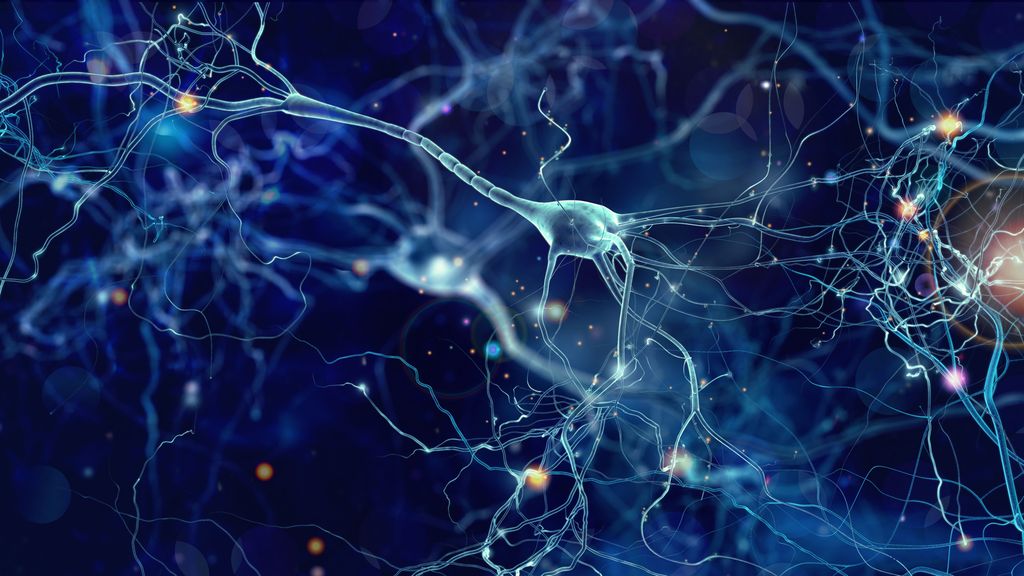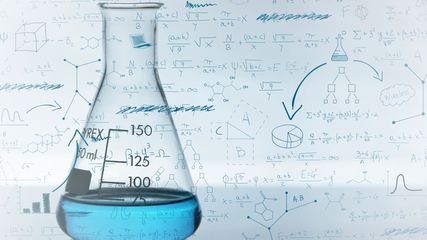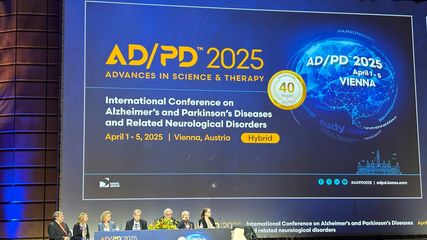<p class="article-intro">Ziel der Bevölkerungsbefragung war es, Einstellungen zu Menschen mit Epilepsie sowie Wissen über die Krankheit in der heutigen Schweiz zu erfahren. Analysiert wurden die Daten von Corinna Nüesch Kurath im Rahmen ihrer Diplomarbeit.<sup>1</sup> Lesen Sie hier einen Auszug aus den Ergebnissen. Den vollständigen Bericht finden sie auf www.epileptologie.ch. </p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsbefragung mit 1060 Teilnehmenden in der Schweiz, die 2018 erstmals internetbasiert stattfand, zeigen keinen einheitlichen Trend.</li> <li>Das Wissen über Epilepsie hat sich seit 2011 eher verschlechtert, Verunsicherung und Ängste haben zugenommen.</li> <li>Dafür sprechen sich mehr Schweizer für eine Eingliederung von Menschen mit Epilepsie in den Arbeitsprozess aus.</li> <li>Wie in der letzten Befragung zeigten jüngere Befragte mehr Vorurteile und soziale Distanz sowie negative Gefühle als andere Altersgruppen</li> </ul> </div> <p>Um einen Zeit- und Ländervergleich möglich zu machen, wurde grösstenteils der gleiche Fragebogen verwendet, der bereits 2003 (in verkürzter Form) und 2011 in der Schweiz sowie 2008 und 2018 in Deutschland und ebenfalls 2018 in Österreich zum Einsatz kam. Trotz der unterschiedlichen Erhebungsmethoden (2003 und 2011 telefonisch, 2018 online) lassen die gleichartigen Fragen Vergleiche über diesen Zeitraum zu.<br /> Insgesamt haben 1060 Personen den Fragebogen ausgefüllt; in die weitere Auswertung eingeschlossen wurden nur Personen, die von Epilepsie gehört oder gelesen hatten. Die Daten wurden anschliessend gemäss offiziellen Statistiken gewichtet; so konnte der Nachteil, dass weniger ältere Teilnehmer an der Online-Befragung teilnehmen, ausgeglichen werden.<sup>2</sup> Es ging insbesondere um folgende Themenbereiche:</p>
<p class="article-intro">Ziel der Bevölkerungsbefragung war es, Einstellungen zu Menschen mit Epilepsie sowie Wissen über die Krankheit in der heutigen Schweiz zu erfahren. Analysiert wurden die Daten von Corinna Nüesch Kurath im Rahmen ihrer Diplomarbeit.<sup>1</sup> Lesen Sie hier einen Auszug aus den Ergebnissen. Den vollständigen Bericht finden sie auf www.epileptologie.ch. </p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsbefragung mit 1060 Teilnehmenden in der Schweiz, die 2018 erstmals internetbasiert stattfand, zeigen keinen einheitlichen Trend.</li> <li>Das Wissen über Epilepsie hat sich seit 2011 eher verschlechtert, Verunsicherung und Ängste haben zugenommen.</li> <li>Dafür sprechen sich mehr Schweizer für eine Eingliederung von Menschen mit Epilepsie in den Arbeitsprozess aus.</li> <li>Wie in der letzten Befragung zeigten jüngere Befragte mehr Vorurteile und soziale Distanz sowie negative Gefühle als andere Altersgruppen</li> </ul> </div> <p>Um einen Zeit- und Ländervergleich möglich zu machen, wurde grösstenteils der gleiche Fragebogen verwendet, der bereits 2003 (in verkürzter Form) und 2011 in der Schweiz sowie 2008 und 2018 in Deutschland und ebenfalls 2018 in Österreich zum Einsatz kam. Trotz der unterschiedlichen Erhebungsmethoden (2003 und 2011 telefonisch, 2018 online) lassen die gleichartigen Fragen Vergleiche über diesen Zeitraum zu.<br /> Insgesamt haben 1060 Personen den Fragebogen ausgefüllt; in die weitere Auswertung eingeschlossen wurden nur Personen, die von Epilepsie gehört oder gelesen hatten. Die Daten wurden anschliessend gemäss offiziellen Statistiken gewichtet; so konnte der Nachteil, dass weniger ältere Teilnehmer an der Online-Befragung teilnehmen, ausgeglichen werden.<sup>2</sup> Es ging insbesondere um folgende Themenbereiche:</p> <ul> <li>Bekanntheit von Epilepsie</li> <li>Soziale Distanz und negative Stereotype</li> <li>Ängste bei Begegnungen mit epilepsiekranken Personen</li> <li>Emotionale Reaktionen bei der Begegnung mit epilepsiekranken Personen</li> <li>Epilepsiespezifisches Wissen zu Ursachen, Symptomen, Behandlung</li> <li>Eignung von Berufen für Menschen mit Epilepsie</li> <li>Eignung von Freizeitaktivitäten für Menschen mit Epilepsie</li> </ul> <h2>Bekanntheit und soziale Distanz</h2> <p>Die Bekanntheit von Epilepsie hat leicht zugenommen: 96 % haben von der Krankheit gehört und gelesen, mehr als bei den vergangenen beiden Befragungen. Die Wahrscheinlichkeit des persönlichen Kontakts ist auf einem ähnlichen Niveau wie zur ersten Befragung 2003. Gleichzeitig haben weniger Personen als 2003, aber mehr als 2011 persönlich einen epileptischen Anfall erlebt. Im Gegensatz zur letzten Befragung von 2011, als die Deutschschweizer häufiger Kontakt mit Betroffenen oder einen Anfall erlebt hatten, sind die Unterschiede zwischen den Sprachregionen nun minim. Wenig überraschend haben Jüngere (16–24 Jahre) am wenigsten persönlichen Kontakt (47 % ) und seltener einen Anfall erlebt (31 % ).<br /> Eine ähnliche Entwicklung gab es beim Thema «Eingliederung in den Arbeitsprozess»: Wie schon 2003 befürwortet eine grosse Mehrheit (93 % ) die Integration von Menschen mit Epilepsie; in der Befragung von 2011 waren es 84 % . Die Unterschiede zwischen den Sprachregionen haben sich seit der letzten Befragung verringert: 2011 waren 80 % der Westschweizer und 85 % der Deutschschweizer für eine berufliche Eingliederung, heute sind es 91 % bzw. 94 % . Geschlecht, Alter, Bildung und persönlicher Kontakt korrelieren nur unwesentlich mit dieser Frage.<br /> Gleich hoch wie beim Thema Arbeit ist die Zustimmung zur Heirat von Sohn oder Tochter mit einem oder einer Epilepsiebetroffenen (93 % , im Vergleich zu 87 % 2003 und 83 % 2011). Generell sind Frauen mit 96 % «Ja» hier etwas offener als Männer.<br /> Auffällig ist allerdings, dass deutlich mehr Menschen als zuvor den Kontakt jüngerer Kinder mit Epilepsiebetroffenen ablehnen. 15 % sprechen sich explizit gegen eine entsprechende Begegnung ihres Kindes in der Schule oder beim Spielen aus, 2011 waren es nur 4 % (plus 2 % unentschieden), 2003 sogar nur 2 % mit 10 % «Weiss nicht». Eine mögliche Erklärung dafür könnte der Trend zu überfürsorglichen «Helikopter-Eltern» sein, die ihre Kinder vor einem möglichen Trauma durch einen epileptischen Anfall bewahren wollen.<br /> Passend dazu haben auch die Ängste der Befragten seit 2011 deutlich zugenommen (Abb. 1) – insbesondere das Gefühl von Unsicherheit und die Befürchtung, dass sich die Person verletzt (2003 wurden diese Fragen nicht gestellt). Nicht wenig überraschend reduzieren Vertrautheit und besseres Symptomwissen die Ausprägung von Ängstlichkeit und Unsicherheit deutlich; das persönliche Erleben eines Anfalls führt hingegen zu mehr Befürchtungen. Personen mit geringer Bildung, nicht Erwerbstätige und solche in Ausbildung haben mehr Befürchtungen als andere.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Neuro_1905_Weblinks_lo_neuro_1905_s22_abb1_franke.jpg" alt="" width="550" height="351" /></p> <p><br /> Für die Messung der sogenannten sozialen Distanz hat sich die Skala nach Angermeyer<sup>3</sup> (Abb. 2) als erheblich verlässlicher erwiesen als die bei früheren Befragungen berücksichtigte «Caveness-Skala».<sup>4</sup> Mehr als drei Viertel der Befragten (77 % ) zeigten in keiner Frage soziale Distanz (alle Fragen mit «ganz bestimmt» oder «eher ja» beantwortet). Am stärksten ist der Wunsch nach Distanz bei den Fragen nach einem Epilepsiebetroffenen als Untermieter oder nach der Empfehlung für eine Arbeitsstelle (je insgesamt 13 % haben eher oder sicher Bedenken).<br /> Vergleichsweise geringer ist die soziale Distanz bei Frauen, Personen mit persönlichem Kontakt zu Betroffenen sowie mit Kenntnis, was bei einem Anfall zu tun ist. Am grössten ist das Distanzbedürfnis bei den jüngeren Befragten (16–24 Jahre). Die Unterschiede zwischen West- und Deutschschweiz sind eher gering: Einerseits drücken mehr Westschweizer in keinem Punkt soziale Distanz aus (79 % , Deutschschweiz 76 % ), andererseits stimmt ein leicht höherer Anteil mehreren entsprechenden Aussagen zu (z. B. 5 % im Vergleich zu 3 % bei mindestens 5 Aussagen).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Neuro_1905_Weblinks_lo_neuro_1905_s23_abb2_franke.jpg" alt="" width="550" height="334" /></p> <p><br /> 24 % der Befragten stimmten mindestens einem von drei relevanten negativen Vorurteilen zu (Menschen mit Epilepsie sind weniger intelligent, leisten weniger oder können nicht selbständig leben wie andere). 7 % stimmten zwei oder drei Stereotypen zu. Der Anteil derer, die Epilepsie für eine Form von Geisteskrankheit halten, hat leicht zugenommen (6 % , 2011: 4 % ) und ist in der Westschweiz unverändert etwas höher (8 % , 2011: 6 % ) als im Gesamtschnitt. Männer neigen eher zu negativen Stereotypen als Frauen; geringe Bildung und junges Alter erhöht die Tendenz zu Vorurteilen. Auffällig ist, dass mehr als dreimal so viele jüngere Menschen die Erkrankung als Geisteskrankheit einstufen (19 % , 2011: 3 % ) als der Durchschnitt. Wer solchen Stereotypen zustimmt, neigt eher zu negativen Emotionen wie Verärgerung und Unverständnis.</p> <h2>Wissen über Epilepsie</h2> <p>Die Kenntnisse über Symptome, Ursachen und Behandlung von Epilepsie haben sich in der Schweiz seit der letzten Befragung 2011 überwiegend verschlechtert (Abb. 3). Schon die Grundaussagen «Epilepsie ist erfolgreich behandelbar» und «Medikamente helfen» kennen heute deutlich weniger Schweizer als in der letzten Befragung; ähnlich bestellt ist es um das Wissen, was bei einem Anfall zu tun ist. Konsequenterweise ist das Gefühl von Hilflosigkeit bei einem möglichen Anfall gestiegen. Nur die Option einer Operation kennen heute etwas mehr Menschen als vor sieben Jahren.<br /> Wie bei der letzten Befragung wissen Ältere, Menschen mit persönlichem Kontakt, Erwerbstätige und Personen mit hoher Bildung tendenziell besser Bescheid. Die Betrachtung nach Sprachregionen zeigt generell einen leichten Wissensvorsprung in der Deutschschweiz.<br /> Die Fragen zu Ursachen, Symptomen und Behandlung enthalten jeweils auch Antwortmöglichkeiten, deren korrekte Beantwortung epilepsiespezifisches Wissen erfordert (z. B. Stress oder Alkohol als Ursache, Luftnot als Symptom, Diät und Psychotherapie als Behandlung). Für die vertiefte Auswertung nach Skalen wurde auf diese Items verzichtet; die «falschen» und die «Weiss-nicht»-Antworten wurden als «nicht gewusst» zusammengefasst. Das gleiche Vorgehen für frühere Befragungen wäre aber zu aufwendig geworden.<br /> Demnach beantworteten immerhin 44 % vier oder alle fünf der eindeutigen Fragen nach möglichen Ursachen korrekt, weitere 43 % gaben zwei oder drei korrekte Antworten, 13 % keine oder eine. Ähnlich sieht es bei den Symptomen aus: 41 % beantworteten mindestens sieben von neun gewerteten Fragen korrekt, nur 7 % zwei oder weniger. Am schwersten fiel die Einschätzung der Behandlungsmethoden: Hier konnten nur 21 % die meisten Punkte richtig beurteilen (mindestens fünf von sieben), während 15 % höchstens eine Methode korrekt bewerteten.<br /> Im Gegensatz zum persönlichen Kontakt wirkt sich das Wissen um die Behandlung von Epilepsie nicht signifikant auf die Einstellungen und Vorurteile aus. Bessere Ursachenkenntnis verstärkt eher die ängstlichen Reaktionen, während Wissen über Symptome die Vorurteile abschwächt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Neuro_1905_Weblinks_lo_neuro_1905_s23_abb3_franke.jpg" alt="" width="550" height="358" /></p> <h2>Eignung von Berufen</h2> <p>Die allgemeine Zustimmung, Epilepsiebetroffene in den Arbeitsprozess einzugliedern, hat in der Schweiz im Vergleich zur letzten Befragung eher zugenommen. Das bestätigt die Einschätzung einzelner Berufsgruppen.<br /> Betrachtet man nur die kategorischen Ablehnungen – es gab auch die Option «hängt von der Häufigkeit und Art der Anfälle ab» – so blieb die Einschätzung «unproblematischer» Berufe wie Verwaltungsangestellter, Gärtnerin oder Verkäufer seit 2011 nahezu unverändert. Das gleiche gilt auch für den Lehrberuf und die Krankenpflege, trotz der gewachsenen Sorge um die eigenen Kinder. Deutlich gesunken ist die Ablehnung für Berufe, in denen ein Anfall neben der betroffenen Person auch andere gefährden könnte, wie Lastwagenfahrer oder Polizistin. Die einzige Berufsgruppe, die vor allem sich selbst verletzen könnte, ist der Metallarbeiter; auch hier hat die Zahl derer abgenommen, die diese Möglichkeit für Epilepsiebetroffene völlig ausschliessen. Erstmals wurde nach der Eignung als Babysitter gefragt.<br /> 18 % der Befragten schliessen keine einzige Berufstätigkeit kategorisch aus, weitere 25 % nur eine oder zwei. Nur 2 % halten acht oder mehr der zehn Berufsgruppen mit Epilepsie für unmöglich. In der soziodemografischen Analyse fällt auf, dass Männer verstärkt «Männerberufe» ausschliessen – für Polizist, Lastwagenfahrer, Feuerwehrmann liegt ihre Ablehnungshäufigkeit je rund zehn Prozentpunkte über der von Frauen. Junge Menschen (16–24 Jahre) können sich am wenigsten vorstellen, dass eine Lehrperson trotz Epilepsie unterrichten kann – 30 % schliessen diesen Beruf grundsätzlich aus. Generell ist die Vorsicht in der Deutschschweiz grösser als in der Westschweiz: Dort schliessen 23 % keinen Beruf völlig aus (Deutschschweiz 15 % ). Beispielsweise lehnen 8 % der Deutschschweizer einen Verkäufer mit Epilepsie kategorisch ab, aber nur 3 % der Westschweizer. Ein persönlicher Kontakt mit Epilepsiebetroffenen wirkt sich kaum auf die Einschätzungen aus.<br /> Ein neuer Arbeitskollege oder eine neue Kollegin mit Epilepsie und einem oder zwei Anfällen pro Jahr würde 19 % der Befragten «etwas» bis «sehr stark» verunsichern – bei der Befragung 2011 waren es nur 7 % .</p> <h2>Diskussion</h2> <p>Generell zeigt nur eine Minderheit der Schweizerinnen und Schweizer soziale Dis- tanz und Vorurteile gegenüber Menschen mit Epilepsie. Eine deutliche Mehrheit befürwortet die Eingliederung von Epilepsiebetroffenen in den Arbeitsprozess, kann sich die Heirat von Sohn oder Tochter mit einem Betroffenen vorstellen und verneint negative Stereotypen. Aktuelle Befragungen aus anderen westeuropäischen Ländern liefern ähnliche Ergebnisse,<sup>5</sup> während mehr als die Hälfte der Befragten in Moskau es 2017 beispielsweise ablehnten, Betroffene als Schwiegersohn oder -tochter zu akzeptieren.<sup>6</sup><br /> Weniger erfreulich aus Sicht der Epilepsie-Liga sieht es um das Wissen über Epilepsie aus: Zwar hat eine grosse Mehrheit von Epilepsie gelesen oder gehört, doch darüber hinaus hat der Kenntnisstand seit der letzten Befragung eher abgenommen. Nur etwa die Hälfte der Befragten weiss, dass Epilepsie erfolgreich behandelbar ist oder was bei einem Anfall zu tun wäre. Das betrifft nach wie vor besonders die jüngeren Befragten, trotz der Jugendkampagne der Epilepsie-Liga von 2016. Hier besteht weiterhin viel Potenzial für Aufklärung und Information.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Die Publikation von Corinna Nüesch Kurath und Julia Franke erschien erstmals in «Epileptologie» (Epileptologie 2019: S. 4–14 ) und ist ebendort sowie auf www.epileptologie.ch vollständig nachzulesen.
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Nüesch Kurath C.: Die Angst vor dem Anfall – dem Stigma begegnen. Einstellungen gegenüber Personen mit Epilepsie und der Wunsch nach sozialer Distanz. Eine repräsentative Umfrage in der Schweizer Bevölkerung. Masterarbeit Angewandte Psychologie (Vertiefungsrichtung Klinische Psychologie) an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. 2019<strong> 2</strong> May TW et al.: Vergleich von face-to-face und internet-basierten Befragungen zu Einstellungen zu Epilepsien – methodische Aspekte. Publikation in Vorbereitung, 2019 <strong>3</strong> Angermeyer M C et al.: The relationship between biogenetic attributions and desire for social distance from persons with schizophrenia and major depression revisited. Epidemiology and Psychiatric Sciences 2015; 24(4): 335-41 <strong>4</strong> Caveness WF, Gallup G H.: A survey of public attitudes toward epilepsy in 1979 with an indication of trends over the past thirty years. Epilepsia 1980; 21(5): 509-18 <strong>5</strong> Holmes E et al.: Attitudes towards epilepsy in the UK population: Results from a 2018 national survey. Seizure 2019; 65: 12-9 <strong>6</strong> Guekht A et al.: Attitudes towards people with epilepsy in Moscow. Epilepsy Behav 2017; 70: 182-6</p>
</div>
</p>