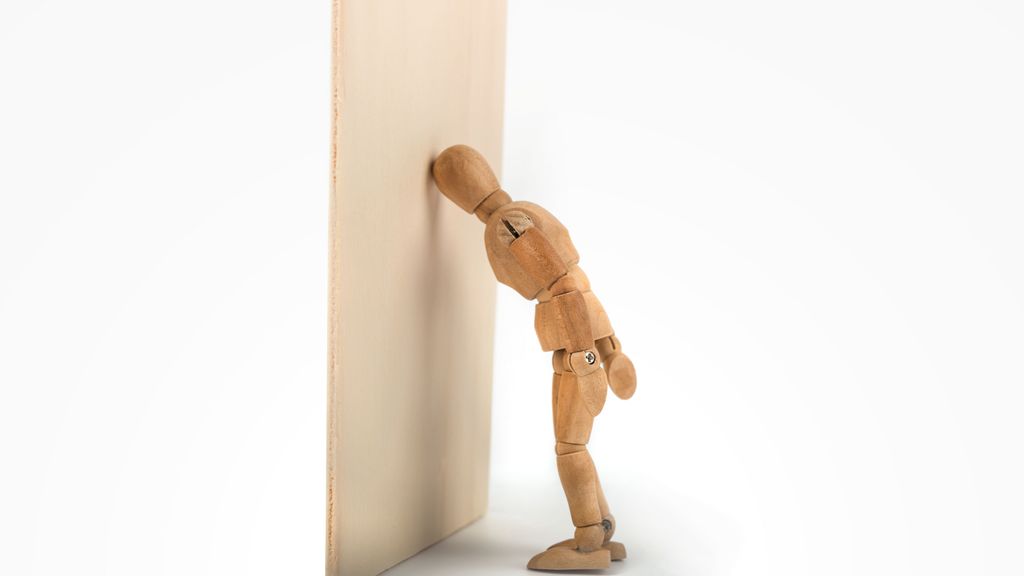
©
Getty Images/iStockphoto
Von Aortitis bis ZNS
Jatros
30
Min. Lesezeit
13.02.2020
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Mehr als 600 Teilnehmer besuchten die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation 2019 und bekundeten reges Interesse an 43 wissenschaftlichen Sitzungen und 52 Posterpräsentationen. Wir stellen Ihnen hier einige ausgewählte Poster und interessante Fälle vor.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Lungensono bei axSpA</h2> <p>Die Medizinische Universität Graz präsentierte eine Studie zur Prävalenz von Lungenveränderungen bei axSpA im transthorakalen Ultraschall (Haidmayer A et al., ÖGR 2019, Poster 20). Sie konnte zeigen, dass nur 5 von 21 Patienten einen normalen Lungensonografie-Befund hatten. Bei mehr als der Hälfte fanden sich sonografische Hinweise auf interstitielle Lungenveränderungen. Die Mehrzahl dieser Veränderungen lagen medial und basal, was im Widerspruch zur bisherigen Literatur steht, wo sie meist apikal gefunden wurden.</p> <h2>G-RZA-Diagnose mit Ultraschall</h2> <p>Eine Arbeit zur Ultraschalldiagnose der chronischen Großgefäß-Riesenzellarteriitis (G-RZA) stellte Dr. Philipp Bosch von der Medizinischen Universität Graz vor (ÖGR 2019, Poster 22). Mithilfe des in dieser Analyse festgestellten Cut-off-Wertes für die Intima-Media- Dicke (IMD) der Axillararterie ist es möglich, unter RZA-Patienten jene mit G-RZA zu identifizieren. Ein Ultraschall-IMD-Cut-off- Wert von 0,87 mm erwies sich als hochspezifisch zur Unterscheidung von G-RZA-Patienten und Patienten ohne Befall der großen Gefäße. Das Forschungsteam erhielt für diese Arbeit einen der 3 Posterpreise der ÖGR.</p> <h2>CED bei JIA früh erkennen</h2> <p>Ebenfalls aus Graz, aber aus der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde kam ein Poster zum Thema „Fäkales Calprotectin zur Detektion chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen bei juveniler idiopathischer Arthritis“ (Skrabl-Baumgartner A et al., ÖGR 2019, Poster 34). Ziel der Arbeit war es, den Wert der FCP-Untersuchung als Screeningtool zur Frühdiagnose von CED bei JIA-Patienten zu erheben. Das Ergebnis: Initiale FCP-Werte über 489 μg/g, ansteigende konsekutive FCP-Werte und ein EAA-Subtyp waren mit einer CED assoziiert. Die Daten zeigen also, dass die Bestimmung des FCP-Werts bei JIA-Patienten als Screening zur Detektion einer CED geeignet wäre.</p> <h2>Infektiöse Aortitis nach Katzenbiss</h2> <p>Einen interessanten Patientenfall präsentierte das Team der Rheumatologischen Ambulanz im Krankenhaus Barmherzige Brüder Graz-Eggenberg (Wipfler-Freißmuth E et al., ÖGR 2019, Poster 47). Eine 74-jährige Frau wurde mit generalisierten schulterbetonten Gelenksschmerzen und rezidivierenden abendlichen Fieberschüben zugewiesen. Das Labor zeigte geringgradige Anämie, eine BSG von 105 mm/h und ein CRP von 10 mg/dl – Tendenz steigend. Die Leukozytenzahl war normal, Procalcitonin negativ. Anamnestisch wurde ein überstandener Pasteurella-multocida-Infekt nach Katzenbiss erhoben. Zum Ausschluss einer Riesenzellarteriitis wurde ein PET-CT gemacht, das überraschenderweise einen länglichen bis saumförmigen gesteigerten Uptake an der thorakalen Aorta zeigte. Daraufhin wurde eine CT-Angiografie veranlasst, in der ein penetrierendes, gedeckt perforiertes Aortenulkus mit begleitender Aortitis entdeckt wurde. Die Blutkultur bestätigte eine infektiöse Aortitis mit Pasteurella multocida. Die Patientin erhielt auf der Gefäßchirurgie einen Aortenstent und antibiotische Behandlung. Fazit: Nicht immer ist eine Aortitis autoimmun bedingt.</p> <h2>ZNS-Befall bei Morbus Behcet</h2> <p>Das SMZ Süd Wien stellte den schwierigen Fall eines Patienten mit langjährigem Morbus Behcet, therapierefraktärer Augenbeteiligung und neurologisch-psychiatrischen Symptomen vor (Polster B et al., ÖGR 2019, Poster 45). Der junge Mann wurde nacheinander mit Adalimumab, Infliximab, Adalimumab + MTX und Cyclosporin + MTX behandelt. Die Panuveitis blieb dennoch aktiv und es kam zusätzlich zu einer zerebralen Mitbeteiligung in Form von Kopfschmerzen, Schwindel und Apathie. Erst eine Hochdosis-Kortisontherapie brachte kurzfristig Besserung. Sobald die Kortisondosis aber reduziert wurde, verschlechterten sich die Neuro-Behcet-Symptome wiederum dramatisch bis hin zu einem soporösen Delir. Aufgrund des schlechten klinischen Zustandes des Patienten und des hohen Kortisonbedarfs wurde nun eine Kombinationstherapie aus Rituximab und Cyclophosphamid begonnen. Auf diese Behandlung sprach der 21-Jährige sehr gut an: Die neurologischen Symptome sistierten und auch die Panuveitis besserte sich zunehmend. Mittlerweile konnte auch schon die Kortisondosis reduziert werden.</p> <h2>Myalgie muss nicht Myositis sein</h2> <p>Gleich 3 Fälle umfasste ein weiteres Poster aus dem SMZ Süd Wien. Deren Gemeinsamkeit: Myopathie und erhöhte CK-Werte, weshalb die Betroffenen zur rheumatologischen Abklärung kamen. Trotz Hinweisen auf Myositis im MRT und EMG stellten sich bei diesen Patienten letztendlich ein Plasmozytom, eine statininduzierte toxische Myopathie bzw. eine Dysferlinopathie als Ursache für die Beschwerden heraus. Diese Fälle würden zeigen, so die Autoren, dass eine Muskelbiopsie zur endgültigen Diagnosesicherung bei Myopathie unumgänglich sei (Bresan K et al., ÖGR 2019, Poster 52).</p> <h2>Der Fall des Jahres: PAN</h2> <p>Den ÖGR-Preis „Fall des Jahres“ erhielt Dr. Stefan Wiltschnigg vom LKH Mürzzuschlag für seine Präsentation „Polyarteriitis nodosa – ein Fallbericht“ (ÖGR 2019, Poster 50). Eine 53-jährige Patientin wurde mit seit 2 Wochen andauerndem Fieber, heftigen Bauchschmerzen und Diarrhö vorstellig. Es bestand eine Pankolitis mit multiplen Dickdarmperforationen und Peritonitis. Im histologischen Befund der Kolektomie fanden sich ischämische Schleimhautnekrosen und granulomatös-vaskulitische Veränderungen der Blutgefäße. Die Hepatitisserologie war negativ, ebenso Kryoglobuline, ANA, ANCA und Komplementfaktoren. In der digitalen Subtraktionsangiografie der Viszeralgefäße fanden sich multiple Aneurysmen. Es wurde eine Polyarteriitis nodosa (PAN) diagnostiziert und zunächst mit Azathioprin und Aprednislon behandelt. Aufgrund eines Leberfermentanstiegs wurde die immunmodulatorische Therapie auf Mycophenolatmofetil (MMF) umgestellt. Daraufhin kam es wieder zu abdominellen Beschwerden und Durchfällen. Eine postoperative Komplikation wurde mittels CT ausgeschlossen. Die Koloskopie zeigte aphtöse Schleimhautläsionen, eine ödematöse Schwellung und Vulnerabilität im Bereich des Rektumrests und der Anastomose. Es wurde eine Diversionskolitis suspiziert und diätologisch und medikamentös (Metronidazol und Mesalazin) behandelt. Nach initialer Besserung traten wieder abdominelle Beschwerden auf. Nun wurde eine koloskopische Biopsie durchgeführt; der histologische Befund entsprach einer MMF-Colitis. Diese Diagnose bestätigte sich durch prompte Besserung der Beschwerden nach Absetzen von MMF. <br />Bei gastrointestinalen Beschwerden nach kompliziert verlaufender PAN müsse an einen Relaps der Grunderkrankung, an postoperative Komplikationen, lokalinfektiöse Probleme und – so wie in diesem Fall – auch an Nebenwirkungen der Therapie gedacht werden, so das Fazit der Autoren.</p> <h2>Effiziente Nachwuchsförderung</h2> <p>Mit der Initiative „Summer School“ möchte die ÖGR die „rheumatologische Lücke“ im aktuellen Medizincurriculum schließen und gegen die bestehende Nachwuchsproblematik vorgehen. Seit 2017 können Jungmediziner im Sommer in Saalfelden theoretische und praktische Einblicke in die Rheumatologie und Rehabilitation gewinnen. Eine Evaluierung zeigte nun, dass die teilnehmenden Studenten die „Summer School“ als sehr informativ bewerteten. 100 % gaben an, sie anderen Studenten empfehlen zu wollen. Das Interesse am Fachgebiet wurde bei vielen geweckt, und einige konnten sogar schon erfolgreich für die Ausbildung zum Rheumatologen gewonnen werden (Sautner J et al., ÖGR 2019, Poster 41).</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: ÖGR-Jahrestagung 2019, 28.–30. November 2019, Wien
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Klinische Bedeutung von Kristallen bei Arthrose
Dass Verkalkung gleich Verkalkung ist, stimmt so nicht. Tatsächlich erlauben zwei unterschiedliche Arten von Kaliumkristallen und die Orte ihrer Ablagerung offenbar Rückschlüsse auf die ...
Was zur Bedeutung von HLA-B27 nach 50 Jahren bekannt ist
Das humane Leukozytenantigen (HLA) B27 ist eine von über 200 identifizierten genetischen Varianten des HLA-B, das zur HLA-Klasse-I-Genfamilie des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC ...
Betroffene effektiv behandeln und in hausärztliche Betreuung entlassen
Bei bestimmten Patientinnen und Patienten mit Gicht ist eine rheumatologisch-fachärztliche Betreuung sinnvoll. Eine im August 2024 veröffentlichte S3-Leitlinie zur Gicht macht deutlich, ...


