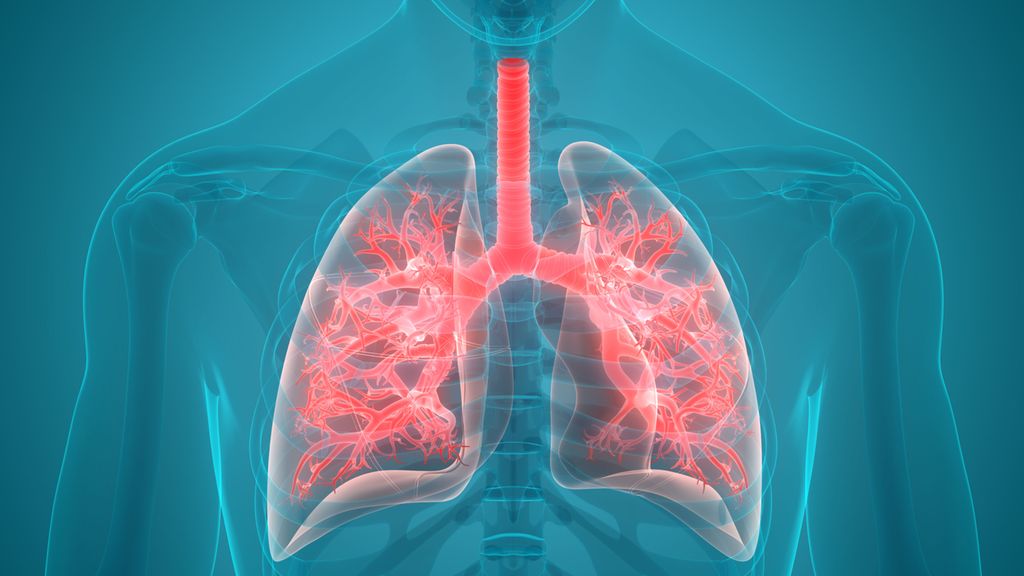
©
Getty Images/iStockphoto
Lungenkarzinom-Screening
Jatros
Autor:
Assoc.-Prof. PD Dr. Helmut Prosch
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Medizinische Universität Wien, AKH Wien<br/> E-Mail: helmut.prosch@meduniwien.ac.at<br/> Quelle: Central European Lung Cancer Congress (CELCC) 2014, 29. November bis 1. Dezember 2014, Wien
30
Min. Lesezeit
05.03.2015
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Das Lungenkarzinom zählt nach wie vor zu den häufigsten tumorbedingten Todesursachen in Europa. Eine der Ursachen für die schlechte Prognose dieser Tumorentität ist, dass sie meist erst spät im Verlauf zu Symptomen führt und der Tumor daher bei den meisten Patienten in einem weit fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird. </p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Durch ein Screening mittels LDCT kann die Lungenkarzinom-bedingte Mortalität bei starken Rauchern um bis zu 20 % reduziert werden.</li> <li>Voraussetzung für den Erfolg eines LDCT-Screeningprogramms ist die Beschränkung des Screenings auf Personen mit einem hohen Lungenkarzinomrisiko.</li> <li>Die meisten der beim Screening nachgewiesenen Rundherde sind benigne. Eine evidenzbasierte Abklärung der Rundherde ist daher obligat.</li> </ul> </div> <p>Da nur jene Patienten eine gute Prognose haben, bei denen der Tumor in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert wird, kommt der Früherkennung eine besondere Bedeutung zu. In einer groß angelegten prospektiven, randomisierten Studie, der in den USA durchgeführten NLST (National Lung Screening Trial), konnte vor wenigen Jahren nachgewiesen werden, dass sich durch ein Screening auf Lungenkarzinom mit einer Niedrigdosis-CT („low dose CT“; LDCT) die Bronchuskarzinom-bedingte Mortalität um 20 % senken lässt.<sup>1</sup> Seit der Publikation dieser Daten konnte in weiteren Studien gezeigt werden, dass sich durch striktere Einschlusskriterien und optimierte Untersuchungsprotokolle die Effizienz eines LDCT-Screenings weiter verbessern lässt.<br /> Bereits in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde in einer Reihe von Studien versucht, durch ein Screening mit jährlich durchgeführtem Lungenröntgen mit oder ohne Sputumzytologie die Lungenkarzinom-bedingte Mortalität zu senken. Obwohl gezeigt werden konnte, dass sich durch ein Screening mit Thoraxröntgen häufig Bronchuskarzinome in einem frühen Stadium diagnostizieren lassen, wurde in keiner Studie eine Verringerung der Lungenkarzinom-Mortalität nachgewiesen.</p> <h2>LDCT für das Lungenkarzinom-Screening</h2> <p>Mit der Einführung von LDCT-Geräten Ende der 1990er-Jahre steht nun ein diagnostisches Verfahren zur Verfügung, mit dem sich sehr kleine Lungenrundherde mit geringer Strahlendosis nachweisen lassen. Mit der Studie NLST konnte nun gezeigt werden, dass durch ein LDCT-Screening eine Reduktion der Lungenkarzinom-bedingten Mortalität (20 % ) und auch der Gesamtmortalität (6,9 % ) erzielbar ist.<sup>1</sup> In Europa laufen derzeit eine Reihe vergleichbarer, wenn auch deutlich kleinerer Screeningstudien, um weitere Evidenz für den Nutzen dieser Früherkennungsstrategie zu schaffen.<br /> Die NLST konnte neben dem positiven Effekt des Screenings auf die Lungenkarzinom-bedingte Mortalität auch einige Herausforderungen aufzeigen, mit denen wir im Screening konfrontiert werden.<br /> Eine der größten Herausforderungen im LDCT-Screening ist die hohe Zahl an falsch positiven Screeningresultaten. In der NLST wurden im ersten Screeningdurchgang 24 % der Untersuchungen als positiv gewertet, wobei jeder Rundherd mit einem Durchmesser >4mm als positiv gewertet wurde.<sup>1</sup> Von den positiven Rundherden erwiesen sich schlussendlich jedoch nur 3,6 % tatsächlich als Lungenkarzinome. Insgesamt fanden sich in allen drei Screeningdurchgängen bei 39,1 % der Patienten ein oder mehrere Rundherde mit einem Durchmesser >4mm. Die hohe Zahl an pulmonalen Rundherden verbunden mit dem äußerst geringen Anteil an Lungenkarzinomen unterstreicht die Relevanz einer gezielten Abklärung (Abb. 1). In der NLST wurden die meisten der detektierten Rundherde durch Verlaufsuntersuchungen weiter abgeklärt, nur ein geringer Anteil wurde invasiv abgeklärt. Der hohe Anteil an falsch positiven Screeningresultaten hat einen direkten negativen Einfluss auf die Gesamtkosten des Screenings sowie – aufgrund des Risikos in Zusammenhang mit der kumulativen Strahlendosis – auf die Gesundheit. Aus diesem Grund sind die Definition positiver Screeningresultate sowie die Strategie der Abklärung von festgestellten Rundherden von zentraler Bedeutung. So könnte beispielsweise die Anhebung des Grenzwerts für die Definition eines positiven Resultats von 4 auf 7mm die Zahl früher Verlaufsuntersuchungen um 70 % senken, ohne die Effizienz des Screenings wesentlich zu verringern.<sup>2</sup> Durch die Anwendung standardisierter Protokolle kann die Abklärung von Rundherden an das Malignomrisiko der einzelnen Rundherde angepasst werden. Basierend auf den Daten der NLST und den Erfahrungen aus anderen Studien wurde dazu vom American College of Radiology ein Algorithmus zur Abklärung von im Screening detektierten Rundherden vorgeschlagen, der neben der Größe auch deren Dichte in die Risikoabschätzung mit einbezieht.<sup>3</sup></p> <h2>Effizienz von Screeningprogrammen</h2> <p>Von wesentlicher Bedeutung für die Effizienz eines Screeningprogramms ist eine exakte Definition der Screeningpopulation. Dazu zählt die Identifikation jener Einschlusskriterien, die zur Teilnahme von Personen führen würden, die aufgrund eines nur sehr geringen Tumorrisikos nicht vom Screening profitieren würden. Durch den Einschluss solcher Personen würde einerseits die Effizienz des Screenings sinken, andererseits würden diesem Kollektiv dadurch Risiken aufgrund einer invasiven Abklärung von nachgewiesenen Rundherden entstehen sowie möglicherweise Folgen aufgrund der kumulativen Strahlendosis drohen.<br /> In die NLST wurden nur Personen eingeschlossen, die zwischen 54 und 74 Jahre alt waren und bereits >30 Packungsjahre in der Anamnese aufwiesen, wobei auch ehemalige Raucher eingeschlossen wurden, die innerhalb der letzten 15 Jahre vor Studieneinschluss das Rauchen beendet hatten. Dadurch wurde das Screening auf eine Personengruppe beschränkt, die ein Risiko von 2–20 % aufwies, in den nächsten zehn Jahren an Lungenkrebs zu erkranken.<sup>4</sup> Durch den Miteinbezug weiterer Risikofaktoren wie Geschlecht, Body-Mass-Index und anamnestische Informationen kann die Population jener Personen, die vom Screening profitieren würden, besser definiert und so auch die Zahl an Teilnehmern an einem Screeningprogramm eingeschränkt werden.<sup>5, 6</sup><br /> Zur Kosteneffizienz eines LDCT-gestützten Lungenkrebs-Screenings liegen erst wenige gesicherte Daten vor. Eine amerikanische Studie geht jedoch davon aus, dass unter Berücksichtigung der Anzahl an gewonnenen Lebensjahren das Screening von Bevölkerungsgruppen mit erhöhtem Lungenkrebsrisiko für die Krankenversicherungsträger kosteneffektiver ist als Screenings auf Darm-, Brust- oder Gebärmutterhalskrebs.<br /> Die positiven Daten der NLST haben in den USA dazu geführt, dass große wissenschaftliche Gesellschaften ein LDCT-Screening empfehlen und auch Versicherungen die Kosten dafür übernehmen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2015_Jatros_Onko_1501_Weblinks_Seite63.jpg" alt="" width="308" height="305" /></p> <h2>Lungenkrebs-Screening: Situation in Österreich</h2> <p>In Österreich übernehmen die Krankenkassen derzeit die Kosten für ein LDCT-Screening nicht, dieses kann daher nur bei Kostenübernahme seitens der Patienten durchgeführt werden. Für die Durchführung eines Screenings in Österreich gibt es einen Konsens zwischen der Österreichischen Röntgengesellschaft (ÖRG) und der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP):</p> <ul> <li>Es sollten nur Personen mit einem deutlich erhöhten Lungenkarzinomrisiko untersucht werden. Das betrifft Raucher und Exraucher, die erst innerhalb der letzten 15 Jahre mit dem Rauchen aufgehört haben, über 55 Jahre alt sind und eine Rauchanamnese von 30 Packungsjahren aufweisen.</li> <li>Die zu screenenden Personen sollten von Medizinern betreut und beraten werden, die über ausreichende Erfahrung in der Abklärung von pulmonalen Rundherden verfügen.</li> <li>Die Betroffenen müssen über die Möglichkeit von falsch positiven Screeningergebnissen und die weiteren zur Abklärung erforderlichen Folgeuntersuchungen sowie möglicherweise notwendige invasive Eingriffe informiert werden.</li> <li>Den Untersuchten muss klargemacht werden, dass sie auch die Durchführung eines LDCT-Screenings nicht sicher vor dem Auftreten eines inoperablen Lungenkarzinoms schützt.</li> <li>Die CT-Untersuchungen sollten in LDCT-Technik und über mindestens drei Jahre hindurch in jährlichen Intervallen durchgeführt werden.</li> <li>Die Abklärung gefundener Rundherde muss in standardisierter Weise erfolgen.</li> </ul></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin,
Medizinische Universität Wien, AKH Wien<br/>
E-Mail: helmut.prosch@meduniwien.ac.at<br/>
Quelle: Central European Lung Cancer
Congress (CELCC) 2014,
29. November bis 1. Dezember 2014, Wien
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Aberle DR et al: N Engl J Med 2011; 365: 395-409<br /><strong>2</strong> Henschke CI et al: Ann Intern Med 2013; 158: 246-252<br /><strong>3</strong> McKee BJ et al: J Am Coll Radiol 2014; doi: 10.1016/j.jacr.2014.08.004<br /><strong>4</strong> Bach PB et al: JAMA 2012; 307: 2418-2429<br /><strong>5</strong> Cassidy A et al: Br J Cancer 2008; 98: 270-276<br /><strong>6</strong> Kovalchik SA et al: N Engl J Med 2013; 369: 245-254</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Ausgewählte Mitteilungen und Poster
Am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie vom 15. bis 16. Mai 2025 in Genf gaben Schweizer Pneumologinnen und Pneumologen einen Einblick in ihre vielfältige ...
Biologika in der Asthmatherapie
Was ist zu beachten bei der Biologikatherapie für Menschen mit Asthma? Wann sollte sie sinnvollerweise begonnen werden und wie lange sollte sie fortgesetzt werden? Prof. Dr. med. ...


