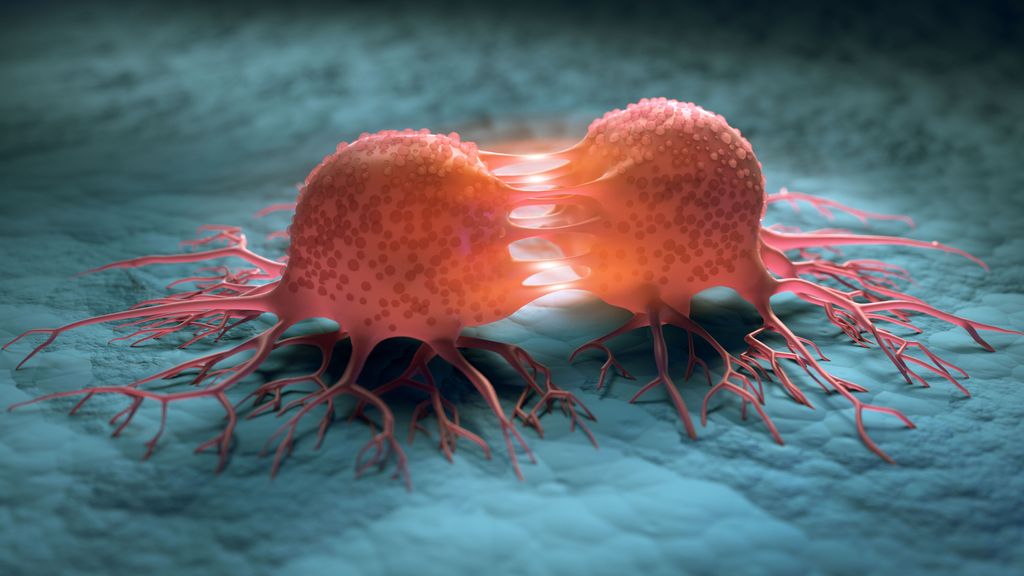
©
Getty Images/iStockphoto
Wichtige neue Erkenntnisse und Fortschritte in der Therapie gastrointestinaler Karzinome 2018
Jatros
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Werner Scheithauer
Univ.-Klinik für Innere Medizin I & CCC<br> MedUniWien – AKH Wien<br> E-Mail: werner@scheithauer@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
27.12.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der Fortschritt in der Onkologie ist rasant und dies galt 2018 auch in besonderem Maß für die Gruppe der gastroenterologischen Tumoren. Der folgende Beitrag bietet eine Zusammenfassung rezenter Studien, Innovationen und Novitäten in der Therapie gastrointestinaler Tumoren von diesem Jahr. Sowohl Fortschritte in der Behandlung von Pankreaskarzinomen und Kolonkarzinomen im Stadium II, III und IV als auch von Gallenwegstumoren, Analkarzinomen, hepatozellulären Tumoren und Magenkarzinomen konnten verzeichnet werden und sind auf den folgenden Seiten zusammengefasst.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Pankreaskarzinom</h2> <p>Nach R0-Resektion eines Pankreaskarzinoms ist eine adjuvante medikamentöse Tumortherapie indiziert. Sie verringert die Rezidivrate und verlängert das krankheitsfreie sowie das Gesamtüberleben. Die adjuvante medikamentöse Tumortherapie sollte idealerweise innerhalb von 6 Wochen nach der Operation begonnen und über 6 Monate durchgeführt werden. In Einzelfällen kann der Therapiebeginn bis zu 12 Wochen nach der Operation verzögert werden, ohne dass diese Vorgehensweise zu einer Verschlechterung der Langzeitergebnisse führt.<br /> Bei der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2018 wurden die ersten Ergebnisse der PRODIGE- 24/CCTG-PA.6-Studie vorgestellt, die zu einer weiteren praxisrelevanten Veränderung in der adjuvanten Therapie von Patienten mit Pankreaskarzinom führen wird. In diese multizentrische randomisierte Phase-III-Studie wurden 493 Patienten aus 77 Zentren in Frankreich und Kanada eingeschlossen. Es ergab sich ein Überlebensvorteil von 19,4 Monaten (54,4 Monate vs. 35,0 Monate; p=0,003) für das mFOLFIRINOX-Schema gegenüber einer konventionellen Monotherapie mit Gemcitabin. Die 3-Jahres-Überlebensraten betrugen 63,4 % (im Kombinationsarm) vs. 48,6 % .<br /> Schwerwiegende Nebenwirkungen traten unter mFOLFIRINOX häufiger auf (Durchfälle, Polyneuropathie, Müdigkeit, Erbrechen und Mundschleimhautirritation), konnten aber durch Dosismodifikationen minimiert werden bzw. nahmen nach 2 Therapiezyklen deutlich ab. 60 % der Patienten unter mFOLFIRINOX erhielten eine G-CSF-Prophylaxe.</p> <h2>Kolonkarzinom Stadium III</h2> <p>Der Benefit einer adjuvanten Chemotherapie beim Kolonkarzinom im Stadium III (Lymphknoten vom Tumor infiltriert) steht seit Jahren außer Zweifel. Neu ist allerdings die Erkenntnis, dass bei einigen dieser Patienten (mit Stadium pT3N1 – nur wenige in unmittelbarer Tumornähe betroffene Lymphknoten) eine 3-monatige Chemotherapie (anstelle von den bisher üblichen 6 Monaten) ausreichend ist. Dies ist nicht nur patientenfreundlicher, sondern impliziert auch den Vorteil einer deutlich geringeren Oxaliplatin-bedingten Polyneuropathie. Weiterhin über 6 Monate sollte die Nachbehandlung jedoch erfolgen, wenn der Tumor in die Tiefe infiltriert hat (pT4) bzw. wenn auch weiter vom Tumor entfernte Lymphknoten betroffen waren (pN2).</p> <h2>Kolonkarzinom Stadium II</h2> <p>Beim Kolonkarzinom im Stadium II haben Patienten nach der Operation bereits eine recht gute Prognose, das FünfjahresÜberleben liegt bei über 80 % . Es stellt sich deshalb die Frage, ob und bei wem eine adjuvante Chemotherapie noch Sinn macht. Momentan richtet sich die Entscheidung für oder gegen eine adjuvante Chemotherapie vorwiegend nach den bekannten klinischen Risikofaktoren, etwa einer Darmperforation vor oder während der Operation, der Infiltrationstiefe des Tumors (pT4) oder einer unzureichenden Anzahl untersuchter Lymphknoten (<12); ferner gelten die Infiltration von Blut- oder Lymphgefäßen sowie von Nervenscheiden, der Reifegrad des Tumors (Grading 3) und postoperativ erhöhte Tumormarkerwerte (CEA) als konkrete Risikofaktoren. Bei etwa 20 % der Patienten mit Kolonkarzinom im Stadium II ist eine sporadische Mikrosatelliteninstabilität (MSI) im Tumorgewebe nachweisbar. Dieser genetische Marker korreliert mit einer etwas besseren Prognose. Bei Patienten im Stadium II ohne Risikofaktoren kann das Fehlen einer MSI als Argument für, im Umkehrschluss der Nachweis einer MSI als Argument gegen eine adjuvante Chemotherapie herangezogen werden.<br /> Ergebnisse prospektiv randomisierter Studien auf der Basis der Mikrosatelliteninstabilität liegen nicht vor. Kürzlich wurden molekulare Markerproteine beschrieben, die eine Vorhersage der Prognose nach kurativ intendierter Resektion eines Kolonkarzinoms ermöglichen könnten – und mit denen sich darüber hinaus möglicherweise Patienten im UICC-Stadium II identifizieren lassen, die von einer adjuvanten Chemotherapie profitieren (z.B. Transkriptionsfaktor CDX2, für den bereits ein diagnostischer Labortest zur Verfügung steht). Angesichts des exploratorischen und retrospektiven Designs dieser Markerstudien bedürfen diese jedoch der weiteren Validierung und Bestätigung in randomisierten klinischen Studien.</p> <h2>Kolonkarzinom Stadium IV</h2> <p>Bezüglich Kolonkarzinompatienten im Stadium IV mit Peritonealkarzinomatose wurden beim ASCO 2018 die Ergebnisse der französischen PRODIGE-7-Studie präsentiert. In dieser 265 Patienten umfassenden randomisierten Phase-III-Studie wurde untersucht, ob eine hyperthermische intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) die Ergebnisse nach alleiniger zytoreduktiver Chirurgie zu verbessern vermag. Die Studie zeigte für Patienten, die perioperativ 6 Monate eine systemische Therapie erhalten hatten, keinen Benefit im krankheitsfreien und Gesamtüberleben (41,2 vs. 41,7 Monate) zugunsten einer HIPEC mit Oxaliplatin. Die perioperative Mortalitätsrate war mit 1,5 % ident mit der Kontrollgruppe, ebenso wie die Nebenwirkungsrate binnen 30 Tagen nach OP. Nach 60 Tagen war die Komplikationsrate in der HIPEC-Gruppe jedoch fast doppelt so hoch (24,1 % vs.13,6 % ). Daher kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt die alleinige zytoreduktive Chirurgie bei einer durch ein kolorektales Karzinom bedingten Peritonealkarzinose als Standard angesehen werden. Grundvoraussetzungen bleiben ein guter Allgemeinzustand des Patienten, lokalisierte und ausschließlich peritoneale Metastasierung ohne Aszites sowie potenzielle R0-Resektabilität.</p> <h2>Mismatch-Repair-defiziente (dMMR) kolorektale Karzinome</h2> <p>Bei metastasierten mikrosatelliteninstabilen (MSI) bzw. Mismatch-Repair-defizienten (dMMR) kolorektalen Karzinomen haben die Immuncheckpoint-Inhibitoren Nivolumab und Pembrolizumab vielversprechende therapeutische Wirksamkeit gezeigt. Optimale Ergebnisse bei konventionell therapierefraktären Patienten wurden kürzlich für die Kombination von Nivolumab und Ipilimumab beschrieben: Innerhalb der Checkmate-142-Studienpopulation (n=119, 76 % hatten =2 Vorbehandlungen) fand sich nach einer mittleren Nachbeobachtungsdauer von 13,4 Monaten bei 55 % aller Patienten eine objektive Krankheitsremission. Die „disease control rate“ (Abwendung einer Progression >3 Monate) betrug 80 % . Positiv war v.a. auch die Dauerhaftigkeit des therapeutischen Benefits: Die PFS-Rate betrug nach 12 Monaten beachtliche 71 % , die Überlebensrate 85 % . Auch zeichnete sich bei der Mehrzahl der Patienten ein signifikanter und klinisch relevanter Benefit hinsichtlich Krankheitssymptomen und Lebensqualität ab. Relevante, jedoch durchwegs managebare Nebenwirkungen fanden sich bei 32 % .</p> <h2>Lokalisierte Gallenwegstumoren</h2> <p>Trotz potenziell kurativer Resektion lokalisierter Gallenwegstumoren ist die Rezidivrate hoch, was das Erfordernis einer optimalen adjuvanten Therapiestrategie unterstreicht. Der Stellenwert der adjuvanten Therapie bei dieser Tumorentität war über viele Jahre unklar.<br /> Erst kürzlich wurden zwei randomisierte Studien, die den Stellenwert der adjuvanten Chemotherapie prospektiv explorierten, publiziert. Die wichtigste Studie war der BILCAP-Trial, hier wurde bei Patienten mit potenziell kurativ reseziertem Gallenwegskarzinom untersucht, wie sich die oral applizierbare 5-FU-Prodrug Capecitabin (n=223) im Vergleich zu einer reinen Nachbeobachtung (n=224) auf den Endpunkt Gesamtüberleben auswirkt. Im Therapiearm erhielten die Patienten eine konventionelle Capecitabin-Dosis von 1250mg/m<sup>2</sup> 2x täglich von Tag 1–14 eines 21-tägigen Zyklus über insgesamt 8 Zyklen. Diese Studie ergab einen Benefit zugunsten von Capecitabin beim Gesamtüberleben; dieses betrug 51 Monate vs. 36 Monate im postoperativen Observationsarm (HR: 0,71; p<0,01). Auch zeigte sich für Capecitabin ein Vorteil hinsichtlich des rezidivfreien Überlebens: median 25 Monate vs. 18 Monate im Kontrollarm. Häufigste Grad-3/4-Nebenwirkung war bei 20,7 % der mit Capecitabin behandelten Patienten ein Hand-Fuß-Syndrom, gefolgt von Fatigue und Diarrhö (jeweils 7,5 % ). Es wurde kein durch die Chemotherapie bedingter Todesfall beobachtet.<br /> Aufgrund dieser Ergebnisse sollte nach internationaler Expertenansicht Capecitabin der Therapiestandard für Patienten nach kurativer Resektion eines Gallenwegskarzinoms sein.</p> <h2>Fortgeschrittenes Analkarzinom</h2> <p>Eine pragmatische, randomisierte „Wer ist besser“-Studie der Phase II beim fortgeschrittenen Analkarzinom wurde bei der ESMO-Jahrestagung 2018 seitens der International Rare Cancers Initiative (IRCI) vorgestellt: Patienten mit metastasiertem oder inoperablem, lokal fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom des Anus, die vorweg noch keine systemische Behandlung für ihre fortgeschrittene Erkrankung erhalten hatten, wurden 1:1 randomisiert und erhielten entweder Cisplatin plus 5-Fluorouracil (5-FU; n=46) oder Carboplatin plus wöchentlich Paclitaxel (CP; n=45). Die Ansprechrate war in beiden Gruppen vergleichbar (59 % unter CP bzw. 57 % unter Cisplatin/5-FU), auch im progressionsfreien Überleben gab es keine signifikanten Unterschiede. Allerdings war das mediane Gesamtüberleben im CPArm signifikant länger (20 Monate versus 12,3 Monate unter Cisplatin/5-FU; HR 2,0; p=0,014). Auch wies CP ein günstigeres Verträglichkeitsprofil auf: Bei signifikant weniger Patienten wurden schwerwiegende unerwünschte Ereignisse beobachtet (36 % vs. 62 % ; p=0,016).<br /> Carboplatin + Paclitaxel sollte daher nach Ansicht der Autoren (trotz der Einschränkung einer geringen Studienpatientenanzahl) ab jetzt als neuer Versorgungsstandard für die Erstlinientherapie des fortgeschrittenen Analkarzinoms angesehen werden.</p> <h2>Fortgeschrittenes hepatozelluläres Karzinom</h2> <p>Im August 2018 hat die Europäische Kommission dem oralen Rezeptor-Tyrosinkinase- Inhibitor Lenvatinib-Mesylat als Einzelwirkstoff für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder inoperablem hepatozellulärem Karzinom (HCC) die Zulassung erteilt. Diese Entscheidung basierte auf den Ergebnissen der 954 HCC-Patienten umfassenden REFLECT-Studie 304. Die Patienten erhielten im Verhältnis 1:1 entweder Lenvatinib (8mg bzw. 12mg/Tag abhängig vom Körpergewicht <60kg bzw. >60kg) oder Sorafenib (2x 400mg/Tag). Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt, die statistische Nichtunterlegenheit beim Gesamtüberleben (OS) im Vergleich zu Sorafenib, der einzigen bisherigen systemischen Behandlungsoption bei dieser Malignomerkrankung: 13,6 vs. 12,3 Monate (HR: 0,92). Klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Verbesserungen wurden bei den sekundären Wirksamkeitsendpunkten wie progressionsfreiem Überleben (7,4 vs. 3,7 Monate; HR: 0,66), Zeit bis zur Progression (8,9 vs. 3,7 Monate; HR: 0,63) und objektiver Ansprechrate (24 % vs. 9 % ; p<0,00001) erreicht. Die häufigsten Nebenwirkungen im Lenvatinib-Arm umfassten Hypertonie, Diarrhö, verminderten Appetit, Gewichtsverlust und Müdigkeit, was mit dem bekannten Nebenwirkungsprofil des Medikaments übereinstimmt. Ein vorzeitiger Therapieabbruch aufgrund gravierender Toxizitäten erfolgte dennoch nur bei 13 % vs. 9 % im Sorafenib-Arm.</p> <h2>Metastasiertes Magenkarzinom</h2> <p>Drittlinientherapieoptionen beim metastasierten Magenkarzinom sind de facto inexistent. Trifluridin/Tipiracil, ein oral applizierbares Zytostatikum, das bereits vor einiger Zeit für Patienten mit konventionell therapierefraktärem Kolorektalkarzinom zugelassen wurde, hat in einer japanischen Phase-II-Prüfung eine vielversprechende Wirksamkeit bei therapieresistenten Magenkarzinomen gezeigt. Daher wurde kürzlich eine globale randomisierte Phase-III-Studie (TAGS Trial) initiiert, in die 507 Patienten mit metastasiertem Magenkarzinom bzw. gastroösophagealen Tumoren nach Versagen von zumindest zwei Therapielinien (inklusive Fluoropyrimidinen, Platinen und Taxan- und/oder Irinotecan-hältiger Regime) eingeschlossen wurden. Die Patienten erhielten im Verhältnis 2:1 entweder Lonsurf® (35mg/m<sup>2</sup> 2x/Tag an den Tagen 1–5 und 8–12 alle 4 Wochen) plus „best supportive care“ (BSC) oder Placebo + BSC. Das mediane Überleben betrug im Lonsurf-Arm 5,7 Monate vs. 3,6 Monate im Placeboarm (HR: 0,65; p=0,0003), die 12-Monats-Überlebensrate 21,2 % vs. 13,9 % . Die Verträglichkeit von Lonsurf schien erwartungsgemäß akzeptabel, am häufigsten fanden sich hämatologische Nebenwirkungen; Grad-3/4-Neutropenien traten bei 38,1 % auf, die Rate an febrilen Neutropenien betrug jedoch nur 1,8 % . Der in der Studie beobachtete Überlebensvorteil (31 % ige Reduktion des Mortalitätsrisikos, Verbesserung des Medianwertes um 2,1 Monate) weisen Lonsurf als wirksame neue Therapieoption bei massiv vorbehandelten Patienten mit metastasiertem Magenkarzinom aus.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>• Conroy T et al.: Unicancer GI PRODIGE 24/CCTG PA.6 trial: a multicenter international randomized phase III trial of adjuvant mFOLFIRINOX versus gemcitabine (gem) in patients with resected pancreatic ductal adenocarcinomas. J Clin Oncol 2018; 36: LBA4001 • Grothey A et al.: Duration of adjuvant chemotherapy for stage III colon cancer. N Engl J Med 2018; 378: 1177-88 • Hofheinz RD et al.: ONKOPEDIA-Leitlinien Kolonkarzinom, Oktober 2018 • Kudo M et al.: Lenvatinib vs. sorafenib in first-line treatment of patients with unresectable hepatocellular carcinoma. A randomized phase 3 non-inferiority trial. Lancet 2018; 391: 1121-236 • Liotta L, Quante M: Adjuvant chemotherapy with capecitabine as new standard for resected cholangiocarcinomas – a look at the BILCAP trial. Z Gastroenterol 2018; 56(7): 839-40 • Lonardi S et al.: Durable clinical benefit with nivolumab and ipilimumab in DNA mismatch repair-deficient/microsatellite instability-high metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2018; 36(8): 773-9 • Quenet F et al.: A UNICANCER phase III trial of hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy (HIPEC) for colorectal peritoneal carcinomatosis (PC): PRODIGE 7. Proc ASCO 2018 • Rao S: InterAACT: a multicentre open-label randomised phase II advanced anal cancer trial of cisplatin (CDDP) plus 5-fluorouracil (5-FU) vs carboplatin (C) plus weekly paclitaxel (P) in patients (pts) with inoperable locally recurrent (ILR) or metastatic treatment naïve disease – an International Rare Cancers Initiative (IRCI) trial. ESMO 2018, Abstract LBA21 • Tabernero J et al.: Overall survival results from a phase III trial of trifluridine/tipiracil versus placebo in patients with metastatic gastric cancer refractory to standard therapies (TAGS). Ann Oncol 2018; 29(Suppl 5): LBA 2</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


