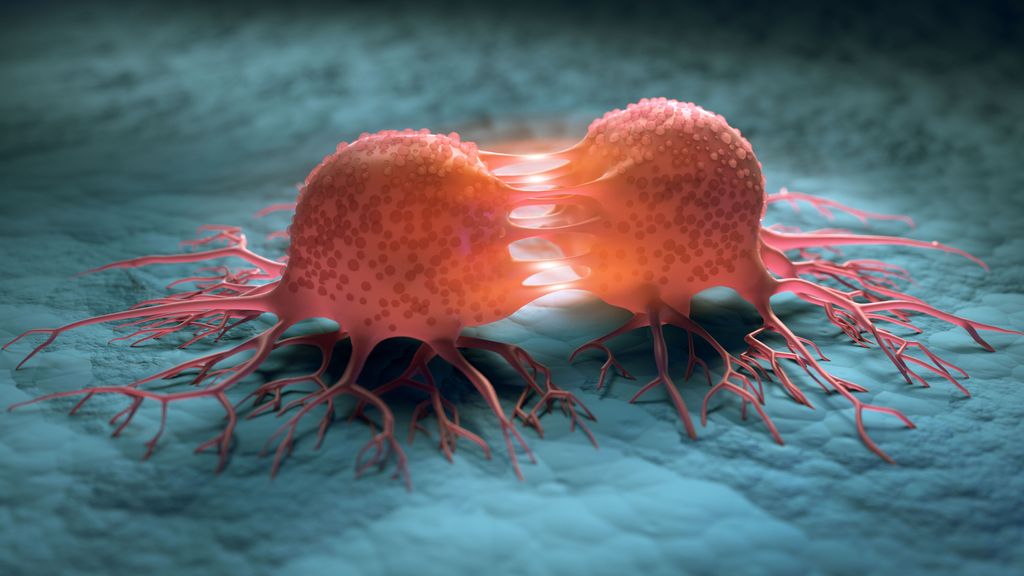
©
Getty Images/iStockphoto
Therapie nach Versagen von Kinase-Inhibitoren
Jatros
Autor:
Dr. Michael Gregor
Facharzt Innere Medizin FMH<br> Facharzt Hämatologie FMH und FAMH<br> Leitender Arzt Hämatologie<br> Luzerner Kantonsspital<br> E-Mail: michael.gregor@luks.ch
30
Min. Lesezeit
05.03.2020
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Aufgrund des häufigeren und früheren Einsatzes von Kinase-Inhibitoren wie Ibrutinib und Idelalisib beobachtet man im klinischen Alltag immer wieder ein Therapieversagen, meist aufgrund von Intoleranz, aber auch infolge Krankheitsprogression. Die heutigen therapeutischen Möglichkeiten bei Versagen von Kinase-Inhibitoren richten sich nach der Art des Versagens, biologischen Charakteristika der Erkrankung, Patientenfaktoren und Verfügbarkeit von neuen Substanzen oder deren Kombinationen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Im Gegensatz zur zeitlich begrenzten Chemoimmuntherapie werden Kinase-Inhibitoren langfristig und kontinuierlich verabreicht.</li> <li>Moderate Nebenwirkungen sind mit symptomatischer Therapie, Therapiepausen oder Dosisreduktion zu managen.</li> <li>Bei einer Krankheitsprogression unter Kinase-Inhibitoren in Form einer CLL wird in den meisten Situationen Venetoclax als Monotherapie oder in Kombination mit Rituximab empfohlen.</li> </ul> </div> <p>Die Entdeckung der Bedeutung des B-Zell- Rezeptor-Signalwegs für die CLL-Zellen ermöglichte die Entwicklung von peroral wirksamen zielgerichteten Medikamenten, welche die Therapie der CLL in den letzten Jahren wesentlich verändert haben. Heute stehen in Europa Ibrutinib, ein Hemmer der Bruton’schen Tyrosinkinase (BTK), und Idelalisib, ein Hemmer der Phosphatidyl-Inositol-3-Kinase (PI3K), im klinischen Alltag zur Verfügung.<br /> Zunächst kamen beide Substanzen vorwiegend bei Hochrisikosituationen zum Einsatz, nämlich bei Frührezidiven nach Chemoimmuntherapie (CIT) oder beim Nachweis einer Deletion 17p und/oder TP53-Mutation. Im Verlauf der letzten Monate wurden mehrere Phase-III-Studien zur Erstlinientherapie der CLL publiziert, welche Ibrutinib (teils kombiniert mit monoklonalen Anti-CD20-Antikörpern) mit unterschiedlichen für die entsprechenden Patienten als Standard geltenden CIT verglichen.<sup>1–3</sup> Diese zeigten einen deutlichen Vorteil für Ibrutinib bezüglich des progressionsfreien Überlebens (PFS) bei Patienten mit unmutierten Immunglobulinschwerkettengenen (IGHV) bei etwa gleichem PFS bei mutierten IGHV. Die neue Onkopedia-Leitlinie empfiehlt dementsprechend Ibrutinib als bevorzugte Erstlinientherapie von CLL-Patienten mit unmutierten IGHV.<sup>4</sup><br /> Im Gegensatz zur üblicherweise während 6 Monaten durchgeführten CIT werden Kinase-Inhibitoren als langfristige kontinuierliche Therapie verabreicht. Nebenwirkungen sind ein häufiger Grund für deren Absetzen. Im klinischen Alltag wird eine Therapie mit Ibrutinib oder Idelalisib deutlich öfter wegen Nebenwirkungen abgesetzt als infolge einer Krankheitsprogression.<sup>5, 6</sup> Trotz der initial sehr hohen Wirksamkeit von Kinase-Inhibitoren kann im Verlauf eine erneute Krankheitsaktivität auftreten, entweder als Progression der CLL oder als Transformation in ein aggressives Lymphom (Richter-Syndrom).<br /> Die Bezeichnung „Versagen von Kinase- Inhibitoren“ umfasst sowohl eine Progression der CLL wie auch das langfristige Absetzen einer eingesetzten Substanz wegen Nebenwirkungen. Die therapeutischen Möglichkeiten richten sich nach der Art des Versagens, den Charakteristika der Erkrankung, Patientenfaktoren und der Verfügbarkeit von möglichen Therapien.<br /> Frühe Arbeiten berichteten über eine sehr ungünstige Prognose bei Patienten, welche Ibrutinib absetzen mussten, mit einem medianen Überleben von nur 3 Monaten.<sup>7</sup> Viele dieser Patienten hatten eine stark vorbehandelte aggressive CLL ohne weitere verbleibende, damals verfügbare Therapieoptionen. Heute stehen für Patienten mit Versagen von Kinase-Inhibitoren wirksame Medikamente zur Verfügung, in erster Linie der BCL2-Inhibitor Venetoclax. Die Prognose nach Versagen von Kinase- Inhibitoren ist heute abhängig von der Art des Therapieversagens, von der Verfügbarkeit wirksamer Therapien und dem Ansprechen auf diese.<sup>8</sup><br /> Phase-III-Studien zum therapeutischen Vorgehen bei Versagen von Kinase-Inhibitoren liegen nicht vor. Die Empfehlungen bei Versagen von Kinase-Inhibitoren beruhen daher teils auf Expertenempfehlungen, Daten aus Phase-II-Studien (teils nur Subgruppen davon), Registerstudien (hauptsächlich einer einzigen größeren aus den USA) oder auf Extrapolation von Resultaten von Phase-III-Studien in einem etwas anderen Kontext.</p> <h2>Therapiemöglichkeiten bei Intoleranz von Kinase-Inhibitoren</h2> <p>Die Bezeichnung Intoleranz reicht von schweren Nebenwirkungen, bei welchen ein Wiedereinsetzen der gleichen Therapie den Patienten gefährden würde (z.B. protrahierte schwere Pneumonitis), über mildere, aber für den Patienten lästige Nebenwirkungen (z.B. mäßige Gliederschmerzen), welche nicht akzeptiert werden. Es gibt auch Patienten, welche eine weitere Medikamenteneinnahme trotz guten Ansprechens nach einigen Monaten bis Jahren Therapie ablehnen (z.B. Wunsch nach Therapiefreiheit).<br /> Medikamentöse Nebenwirkungen von Kinase-Inhibitoren, welche zum Absetzen der Therapie führen, lassen sich teils mildern oder vermeiden, wenn sie früh erkannt und angegangen werden. Mittels symptomatischer Therapie, Therapiepausen oder Dosisreduktion lässt sich eine Behandlung mit Kinase-Inhibitoren bei vielen Patienten trotz Nebenwirkungen längerfristig fortführen. Hinsichtlich des Managements der möglichen Nebenwirkungen verweise ich auf die im Literaturverzeichnis erwähnten Empfehlungen.<sup>9, 10</sup><br /> Patienten mit gutem Therapieansprechen auf Kinase-Inhibitoren benötigen unmittelbar nach Absetzen der Therapie oft zunächst keine medikamentöse Therapie („watch and wait“). Ein Teil der Patienten zeigt eine Progredienz innerhalb weniger Wochen, während andere Patienten Monate (in Einzelfällen über 1 Jahr) therapiefrei bleiben können.<br /> Bei vorgängig gutem Therapieansprechen und milderen Nebenwirkungen (besonders auch nach gewünschter Therapiepause) kann teils dieselbe Substanz wieder eingesetzt werden, ggf. in einer reduzierten Dosierung. Neuere, bisher in Europa aber nicht verfügbare Substanzen aus derselben Klasse (z.B. der BTK-Inhibitor Acalabrutinib oder der PI3K-Inhibitor Duvelisib) zeigten in Phase-II-Studien bei CLL-Patienten mit Absetzen wegen Intoleranz ein gutes und oft anhaltendes Therapieansprechen mit einer Ansprechrate von 76 % und einem PFS von 75 % nach 2 Jahren.<sup>11</sup> Ein Wechsel von Ibrutinib auf Idelalisib oder umgekehrt ist ebenfalls eine Therapieoption. <sup>12</sup> Eine CIT kann nach Versagen von Kinase-Inhibitoren bei prognostisch günstiger früher CLL eingesetzt werden (z.B. Versagen von Ibrutinib als Erstlinientherapie bei mutiertem IGHV ohne del17p/TP53mut). Nach Zulassung der Kombination von Venetoclax mit Rituximab bei CLL als Rezidivtherapie aufgrund der MURANO- Studie ist dies eine attraktive Option auch für Patienten mit Intoleranz gegenüber Kinase-Inhibitoren.<sup>13</sup></p> <h2>Diagnostik und Therapie bei Resistenz auf Kinase-Inhibitoren</h2> <p>Bei früher Progression unter Kinase- Inhibitoren oder anderen Hinweisen für eine Transformation (z.B. B-Symptome, schnelle und besonders asymmetrische Größenzunahme von Lymphknoten, erhöhte LDH) wird eine diagnostische Biopsie empfohlen. Eine PET/CT-Untersuchung wird zur Wahl der optimalen Lokalisation für die Biopsie (Lymphknoten mit hoher Aktivität) empfohlen, wobei die Sensitivität und Spezifität bei Progression unter Kinase-Inhibitoren (Sensitivität 71 % , Spezifität 50 % ) niedriger sind als bei Progression unter CIT (Sensitivität 91 % , Spezifität 80 % ).<sup>14, 15</sup> Eine Transformation erweist sich histologisch am häufigsten als diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL), bei etwa 5 bis 10 % der Patienten jedoch als Hodgkin-Lymphom.<br /> Bei Hodgkin-Lymphom erfolgt eine dem Stadium und Gesundheitszustand des Patienten angepasste Therapie (meist ABVD) mit ähnlichen Ergebnissen wie bei primärem Hodgkin-Lymphom. Bei Nachweis eines DLBCL muss unterschieden werden, ob es sich um eine klonal mit der CLL verwandte Erkrankung oder eine Zweitneoplasie handelt. Letztere wird wie ein de novo DLBCL behandelt mit ähnlichen Therapieergebnissen. Klonal mit der CLL verwandte DLBCL haben dagegen eine äußerst ungünstige Prognose. Auf eine Standardtherapie wie R-CHOP sprechen diese Patienten oft nur teilweise (Ansprechrate um 50 % ), meist unvollständig (komplette Remissionen um 15 % ) und kurz an (medianes PFS um 6 Monate, medianes OS knapp 1 Jahr).<sup>16</sup> Deswegen empfehle ich den Einschluss in Therapieoptimierungsstudien mit Kombinationen von neuen Substanzen, z.B. auch Immuntherapien.<br /> Eine CLL-Progression unter Ibrutinib tritt am häufigsten wegen einer BTK-Mutation auf, welche zu einer Resistenz auf alle kovalent bindenden BTK-Inhibitoren führt.<sup>17</sup> Ein kleinerer Teil der Patienten weist eine Mutation der Phospholipase Cγ2 (PLCγ2) auf, welche zu einer Resistenz auf alle Inhibitoren des B-Zell-Rezeptor-Signalwegs führt.<sup>17</sup> Die Diagnostik des Resistenzmechanismus steht im Alltag meistens nicht zur Verfügung. Deswegen wird bei allen Patienten mit einer Krankheitsprogression unter Kinase-Inhibitoren in Form einer CLL kein Wechsel des Kinase-Inhibitors empfohlen (weder gleiche Substanzklasse noch Klassenwechel!), sondern eine Therapie mit Venetoclax, entweder als Monotherapie oder gemäß neuer Zulassung bevorzugt in Kombination mit Rituximab (analog zur MURANO-Studie, obwohl nur wenige eingeschlossene Patienten mit Kinase- Inhibitoren vorbehandelt waren). Eine Beobachtungsstudie aus den USA zeigte mit Venetoclax-basierten Therapien ein häufigeres und länger andauerndes Ansprechen als mit anderen Behandlungen.<sup>18</sup><br /> Für Patienten mit Resistenz auf Kinase- Inhibitoren und del17p/TP53mut ist eine Monotherapie mit Venetoclax bereits seit längerer Zeit zugelassen. Die Resultate einer Venetoclax-Therapie sind mit Ansprechen bei etwa zwei Dritteln der Patienten und einem medianen PFS von etwa 2 Jahren aber längerfristig nur mäßig befriedigend.<sup>19, 20</sup><br />Bei Patienten mit Versagen einer CIT und Resistenz auf einen Kinase-Inhibitor, insbesondere mit einer Deletion 17p/TP53- Mutation, soll die Möglichkeit einer allogenen Stammzelltransplantation abgeklärt werden. Bei Richter-Transformation im Sinne eines klonal verwandten DLBCL wird eine konsolidierende allogene Stammzelltransplantation empfohlen, sofern der Gesundheitszustand des Patienten dies erlaubt.<sup>21</sup> Eine CAR-T-Zell-Therapie ist bisher zur Behandlung der CLL nicht zugelassen, bei Verfügbarkeit z.B. im Rahmen einer klinischen Studie gilt sie als eine alternative Option, sofern eine allogene Stammzelltransplantation zu riskant oder nicht möglich ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Jatros_Onko_2001_Weblinks_jat_onko_2001_s82_grafik_gregor.jpg" alt="" width="600" height="360" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Woyach JA et al.: Ibrutinib regimens versus chemoimmunotherapy in older patients with untreated CLL. N Engl J Med 2018; 379: 2517-28 <strong>2</strong> Moreno C et al.: Ibrutinib plus obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab in first-line treatment of chronic lymphocytic leukaemia (iLLUMINATE): a multicentre, randomised, open-label, phase <strong>3</strong> trial. Lancet Oncol 2019; 20: 43-56 3 Shanafelt TD et al.: Ibrutinib–rituximab or chemoimmunotherapy for chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2019; 381: 432-43 <strong>4</strong> Wendtner CM et al.: Onkopedia Leitlinie: Chronische lymphatische Leukämie (CLL). Stand April 2019 (www.onkopedia. com/de/onkopedia/guidelines/chronische lymphatische- leukaemie-cll/@@guideline/html/index.html) <strong>5</strong> Mato AR et al.: Outcomes of front-line ibrutinib treated CLL patients excluded from landmark clinical trial. Am J Hematol 2018; 93: 1394-401 <strong>6</strong> Mato AR et al.: Toxicities and outcomes of 616 ibrutinib-treated patients in the United States: a real-world analysis. Haematologica 2018; 103: 874-9 <strong>7</strong> Jain P et al.: Outcomes of patients with chronic lymphocytic leukemia after discontinuing ibrutinib. Blood 2015; 125: 2062-7 <strong>8</strong> Jain P et al.: Long-term outcomes for patients with chronic lymphocytic leukemia who discontinue ibrutinib. Cancer 2017; 123: 2268-73 <strong>9</strong> Gribben JG et al.: Optimising outcomes for patients with chronic lymphocytic leukaemia on ibrutinib therapy: european recommendations for clinical practice. Brit J Hematol 2018; 180: 666-79 <strong>10</strong> Coutré SE et al.: Management of adverse events associated with idelalisib treatment: expert panel opinion. Leukemia & Lymphoma 2015; 56: 2779-86 <strong>11</strong> Awan FT et al.: Acalabrutinib monotherapy in patients with chronic lymphocytic leukemia who are intolerant to ibrutinib. Blood Advances 2019; 3: 1553-62 <strong>12</strong> Mato AR et al.: Optimal sequencing of ibrutinib, idelalisib, and venetoclax in chronic lymphocytic leukemia: results from a multicenter study of 683 patients. Annals of Oncology 2017; 28: 1050-6 <strong>13</strong> Seymour JF et al.: Venetoclax–rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2018; 378: 1107-20 <strong>14</strong> Mato AR et al.: Utility of positron emission tomography-computed tomography in patients with chronic lymphocytic leukemia following B-cell receptor pathway inhibitor therapy. Haematologica 2019; 104: 2258-64 <strong>15</strong> Bruzzi JF et al.: Detection of Richter’s transformation of chronic lymphocytic leukemia by PET/CT. J Nucl Med 2006; 47: 1267-73<strong> 16</strong> Allan JN, Furman RR: Current trends in the management of Richter’s syndrome. Int J Hematol Oncol 2019; 7: IJH09<strong> 17</strong> Woyach JA et al.: Resistance mechanisms for the Bruton’s tyrosine kinase inhibitor ibrutinib. N Engl J Med 2014; 370: 2286-94 <strong>18</strong> Mato AR et al.: Optimal sequencing of ibrutinib, idelalisib, and venetoclax in chronic lymphocytic leukemia: results from a multicenter study of 683 patients. Annals of Oncology 2017; 28: 1050-6 <strong>19</strong> Jones JA et al.: Venetoclax for chronic lymphocytic leukaemia progressing after ibrutinib: an interim analysis of a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol 2018; 19: 65-75 <strong>20</strong> Coutre S et al.: Venetoclax for patients with chronic lymphocytic leukemia who progressed during or after idelalisib therapy. Blood 2018; 131: 1704-11<strong> 21</strong> Dreger P et al.: High-risk chronic lymphocytic leukemia in the era of pathway inhibitors: integrating molecular and cellular therapies. Blood 2018; 132: 892-902</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


