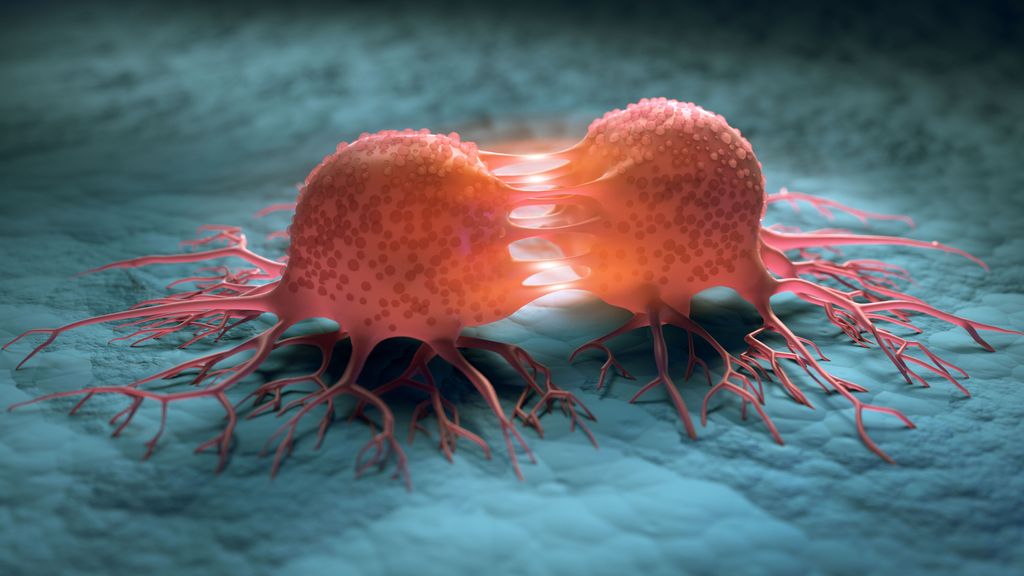
©
Getty Images/iStockphoto
PSA-basiertes Screening 2018
Jatros
Autor:
Prim. Univ.-Prof. Dr. Stephan Madersbacher
Urologische Abteilung<br> Kaiser-Franz-Josef-Spital<br> Sigmund Freud Privatuniversität<br> E-Mail: stephan.madersbacher@wienkav.at
30
Min. Lesezeit
22.11.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Mit einer Inzidenz von etwa 5000 Neuerkrankungen pro Jahr in Österreich, einer karzinomspezifischen Mortalität von 1300 Männern pro Jahr und einer Prävalenz von 60 000 Männern ist das Prostatakarzinom das bei Weitem häufigste Malignom des Mannes, was die klinische Relevanz dieser Erkrankung unterstreicht. Seit der Einführung des prostataspezifischen Antigens (PSA) zur Frühdiagnostik des Prostatakarzinoms (PKa) vor ca. 25 Jahren wird die Rolle des PSA-basierten Prostatakarzinom-Screenings kontroversiell diskutiert.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Keine Empfehlung für ein PSAbasiertes Massenscreening</li> <li>PSA-Test bei Männern nach ausführlicher Aufklärung über Vor- und Nachteile</li> <li>Individualisierte Screeningintervalle, mpMRT und aktives Beobachten einsetzen</li> </ul> </div> <p>In den letzten 20 Jahren wurden zwei große prospektiv randomisierte Screeningstudien (ERSPC, PLCO) mit circa 240 000 inkludierten Patienten durchgeführt und mehrfach publiziert. Der Konsens aus beiden Studien (vor allem der methodisch aussagekräftigeren europäischen ERSPC) ist, dass ein PSA-basiertes Screening die Prostatakarzinom-spezifische Mortalität relativ um 20 % , absolut jedoch nur um 0,1 % reduziert. Der wesentliche Kritikpunkt an einem PSA-basierten PKa-Massenscreening ist die hohe Rate an Überdiagnose und Übertherapie. Darüber hinaus weist der PSA-Test (z.B. bei einem Cut-off von 3,0ng/ml) einen hohen falsch positiven prädiktiven Wert von 70–80 % und einen falsch negativen prädiktiven Wert von 20–30 % auf. Keine medizinische Fachgesellschaft empfiehlt deshalb derzeit ein PSA-basiertes Massenscreening.</p> <h2>Individualisierte PSA-Bestimmung</h2> <p>Trotz der diversen o.a. Kritikpunkte an einem PSA-basierten PKa-Massenscreening ist der hohe prädiktive Wert von PSA hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung eines Prostatakarzinoms unbestritten. Dies triff vor allem für jüngere Männer (um das 45. bis 50. Lebensjahr) zu, da zu diesem Zeitpunkt der PSA-Wert noch nicht so stark durch die BPH-Komponente verfälscht ist. Liegt der PSA-Wert unter 0,5ng/ml (dies trifft etwa auf die Hälfte der Männer in dieser Altersgruppe zu), so ist das Risiko, an einem PKa in den nächsten 20 Jahren zu sterben, äußerst gering. Mit steigendem PSA-Wert steigt dieses Risiko nahezu linear an. Dieses Wissen setzt man hinsichtlich der entsprechenden Screeningintervalle um. Diese risikoadaptierten Screeningintervalle reduzieren signifikant die erforderlichen Screeningintervalle für einen Großteil der Männer und reduzieren damit Kosten.</p> <h2>Überdiagnose</h2> <p>Die Prävalenz eines PKa steigt mit dem Alter nahezu linear: Im 80. Lebensjahr ist beinahe bei jedem Patienten ein PKa histologisch nachweisbar. Aufgrund dieser Tatsache birgt das PSA-Screening die Gefahr der Diagnose von Karzinomen, die den Patienten nie vital gefährdet hätten. In den Screeningstudien konnte eine Inzidenzsteigerung von etwa 60 % gezeigt werden. Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, sollte nicht jeder erhöhte PSA-Wert (vor allem im Graubereich zwischen 4 und 10ng/ml) unmittelbar zu einer Prostatabiopsie führen, sondern zunächst in einem Abstand von 6–8 Wochen wiederholt werden („ein erhöhter PSA-Wert ist kein erhöhter PSA-Wert“). Behandelbare Ursachen für eine PSA-Erhöhung (z.B. Harnwegsinfekt, akute/ chronische Prostatitis, physikalische Ursachen) müssen ebenfalls vorab ausgeschlossen werden.<br /> Zunehmend wird heute eine multiparametrische MRT (mpMRT) vor geplanter Erstbiopsie der Prostata durchgeführt. Die Basis für diese Empfehlung liefert u.a. eine aussagekräftige Phase-III-Studie (PRECISION- trial), welche Mitte 2018 im „New England Journal of Medicine“ publiziert wurde. In dieser Studie wurde die konventionelle Ultraschall-gezielte 12-fach-Biopsie mit dem Konzept eines mpMRT und – sofern im mpMRT suspekte Areale nachgewiesen werden konnten – einer sogenannten Fusionsbiopsie verglichen. Im Zuge der Fusionsbiopsie werden die mpMRTBilder mit den konventionellen transrektalen US-Bildern fusioniert, damit können die im mpMRT identifizierten suspekten Areale gezielt biopsiert werden. In der o.a. randomisierten Studie konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz des mpMRT etwa 30 % der Biopsien vermieden werden können, da im mpMRT kein suspektes Areal nachweisbar war. Jene Patienten, die mittels der Fusionstechnik biopsiert wurden, zeigten eine höhere Rate an klinisch relevanten (Gleason Score >6) PKa und weniger klinisch insignifkanten PKa (Gleason Score 6). Zusammenfassend bedeuten diese Daten, dass mittels mpMRT und Fusionsbiopsie etwa jede 3. Biopsie vermieden werden kann (dies führt zu einer signifikanten Kostenreduktion und vermindert die Biopsie-assoziierte Morbidität). Darüber hinaus sind die Fusionsbiopsien viel treffsicherer, vor allem da weniger insignifikante Tumoren detektiert werden und damit ein wesentlicher Kritikpunkt des PSA-basierten Screenings (Überdiagnose) abgeschwächt wird.</p> <h2>Übertherapie</h2> <p>Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt des PSA-basierten Screenings ist die Übertherapie, da in den meisten industrialisierten Ländern die Prostatakarzinomdiagnose nahezu zwingend eine aktive Therapie (radikale Prostatektomie, Strahlentherapie) mit entsprechender Morbidität nach sich zieht. In diesem Zusammenhang muss das Konzept der aktiven Überwachung („active surveillance“, AS) diskutiert werden. Dieses Therapiekonzept sieht vor, Patienten mit einem Niedrig-Risiko-PKa (PSA 10,0ng/ml; Gleason Score 6 in der Prostatabiopsie; die Anzahl der positiven Biopsiezylinder wird kontroversiell diskutiert) primär nur zu beobachten und regelmäßig mittels Serum-PSA und Prostatabiopsie nachzukontrollieren. Zunehmend wird auch bei der AS der mpMRT eingesetzt, vor allem um die Anzahl der Kontrollbiopsien zu reduzieren. In der PROTECT- Studie (New Engl J Med, 2016) wurden >1500 Patienten in drei Studienarme (AS, radikale Prostatektomie, perkutane Strahlentherapie) randomisiert und für 10 Jahre nachverfolgt. Nach 10 Jahren war das Karzinom-spezifische Überleben >99 % in allen drei Studienarmen ident. Innerhalb von 10 Jahren brach etwa die Hälfte der Patienten die AS ab und erhielt in der Regel eine radikale Prostatektomie oder Strahlentherapie. Die PROTECT-Studie belegt Sicherheit und Effizienz der AS auf der Basis einer randomisierten Studie. In den skandinavischen Ländern beträgt die Akzeptanz der AS bei Niedrig-Risiko-PKa-Patienten >90 % . Aus Österreich liegen diesbezüglich keine verlässlichen Daten vor, Schätzungen zufolge jedoch unter 20 % . Die PROTECT-Studie konnte Sicherheit und Effizienz der AS nachweisen und die AS ist derzeit die einzige Möglichkeit, das Risiko einer Übertherapie zu minimieren.</p> <h2>Empfehlungen zur PSA-Bestimmung</h2> <p>Auch nach über 20 Jahren wird die Rolle der PKa-Früherkennung mittels PSA und digitorektaler Untersuchung nach wie vor kontroversiell diskutiert. Alle relevanten Leitlinien schlagen einen individualisierten Zugang vor: Männer ab dem 45. Lebensjahr und einer projizierten Lebenserwartung von >10 Jahren sollten im Detail über die Vor- und Nachteile einer PSABestimmung aufgeklärt werden. Auch die US-Preventive Services Task Force empfiehlt dieses Vorgehen und bietet auf ihrer Internetseite eine für Patienten anschauliche Illustration der positiven und negativen Effekte einer PSA-basierten PKa- Vorsorge: Von 1000 gescreenten Patienten haben 240 einen positiven Effekt und bei 100 Patienten wird ein PKa diagnostiziert. Von diesen 100 Patienten erhalten 80 % eine aktive Therapie mit der Gefahr von Therapie-assoziierten Nebenwirkungen (Harninkontinenz, erektile Dysfunktion); bei insgesamt 3 Patienten kann die Metastasenbildung durch das Screening verhindert werden und bei einem kann der Tod aufgrund eines PKa verhindert werden.<br /> Bei Männern mit einer projizierten Lebenserwartung von <10 Jahren bzw. bei einem Alter >70–75 Jahre ist die PSABestimmung im Sinne einer PKa-Früherkennung nicht angezeigt. Die Screeningintervalle richten sich nach der Höhe des PSA-Wertes. Die S3-Leitlinie der deutschen Urologen schlägt folgende Intervalle vor: PSA <1,0ng/ml: 4 Jahre, PSA 1–2ng/ml: 2 Jahre und PSA >2ng/ml: jährlich. MpMRT und aktive Überwachung reduzieren das Risiko von Überdiagnose und Übertherapie. Trotz aller – zum Teil berechtigten – Kritik an einer PSA-basierten PKa-Vorsorge muss zum Abschluss betont werden, dass ein PKa in einem Früh- – und damit kurablen klinischen – Stadium nur mittels einer PSAbasierten Vorsorgeuntersuchung diagnostiziert werden kann.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


