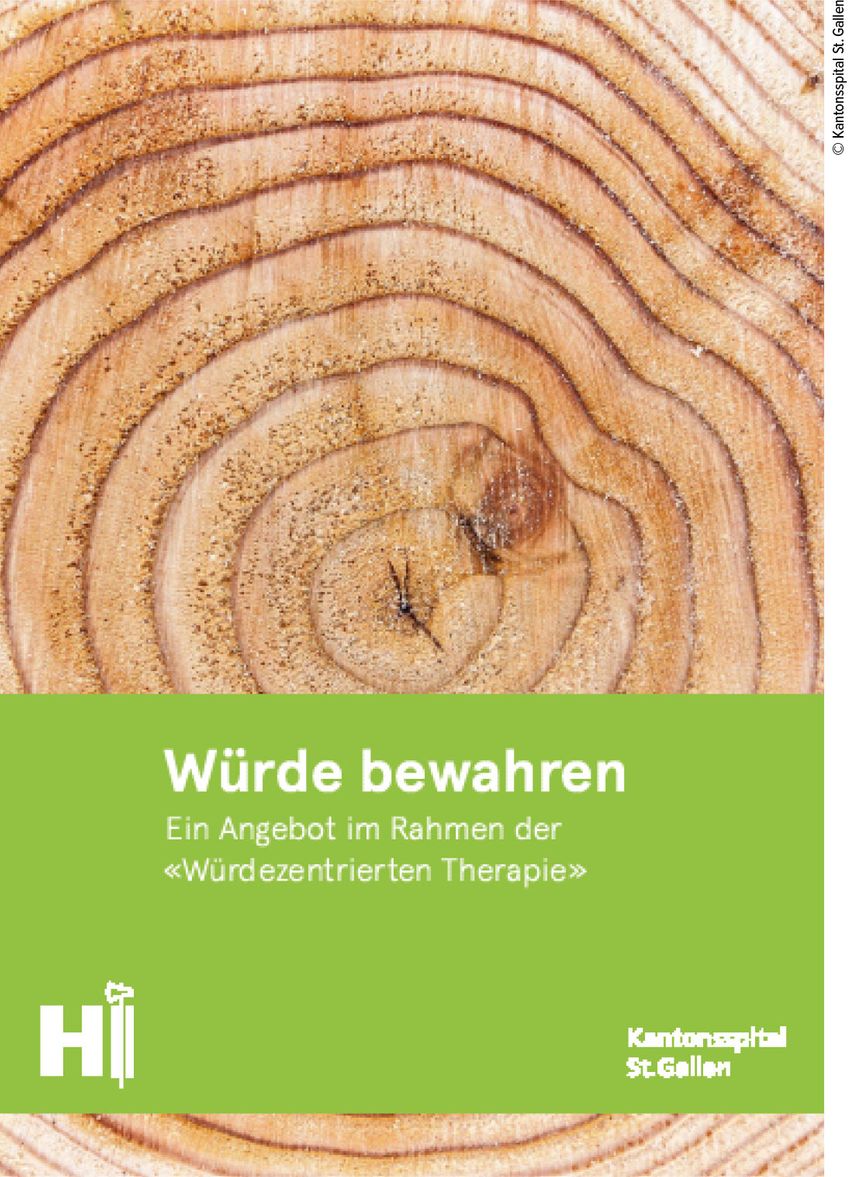„Nach dem Vorlesen herrscht oft eine Atmosphäre stiller Freude“
Das Interview führte Ingeborg Morawetz, MA
Palliativpflege umfasst mehr als Medizin: Würdezentrierte Therapie verbessert nicht nur die Lebensqualität von Patient:innen, sondern kann noch viel mehr leisten – auch für Angehörige und Pflegende. Dr.Mirjam Buschor und Dipl. psych, Gabriela Mallaun vom Kantonsspital St.Gallen haben mit JATROS über diese Therapieform zwischen „autobiografischem Dokument und Kurzpsychotherapie“ gesprochen.
Wie funktioniert die Würdezentrierte Therapie? Was ist ihre Geschichte?
Gabriela Mallaun: Die Würdezentrierte Therapie (WzT) ist eine Würdigung der schwerkranken erzählenden Person und ihres Lebens. Der Begründer, H. M. Chochinov, hat durch Befragung von Patient:innen festgestellt, dass neben den krankheitsbedingten Leiden ein Verlust von Würde schwerkranke Menschen am meisten plagt. Daher haben sich Chochinov und sein Team damit auseinandergesetzt, was die Würde von Menschen ausmacht und wie sie in der Situation Schwerkranker bestärkt werden kann.
Die WzT, zwischen autobiografischem Dokument und Kurzpsychotherapie anzusiedeln, ist die Antwort darauf. Es ist eine Lebensrückschau, die wichtige und lebendige Erinnerungen umfasst, und das Leben in der gemeinsamen Rückschau von erzählender und fragender/zuhörender Person würdigt. Überdies hält die WzT essenzielle Lebenserfahrungen sowie Gedanken und Wünsche für persönlich nahestehende Menschen fest.
Dazu gibt es für WzT-Fachpersonen einen Gesprächsleitfaden, er beinhaltet Grundfragen, die im Laufe des Gesprächs angesprochen werden sollen. Die Gespräche werden am Kantonsspital St. Gallen von einer Kollegin und mir geführt. Aus dem Erzählten wird ein verschriftlichtes Dokument in Ringbuchform und damit eine sehr persönliche Hinterlassenschaft an ausgewählte nahestehende Personen. Die Generativität, das Weitergeben, spielt eine ebenso bedeutende Rolle wie der Prozess, der während des Erzählens geschieht. Die Weitergabe kann noch zu Lebzeiten oder erst nach dem Tod erfolgen, nach Wahl der erzählenden Person.
Mirjam Buschor: Angehörige können durch diese geistige Hinterlassenschaft Trost in der Trauer erfahren und so die Möglichkeit haben, noch einmal bewusst Abschied zu nehmen. Die WzT kann das Risiko für eine komplizierte Trauer minimieren. Das autobiografische Vermächtnis ist auch ein Geschenk, das an Familienmitglieder, Freund:innen oder Weggefährt:innen weitergegeben werden kann. Ich erkläre den Patient:innen, dass es um sie als ganzen Menschen geht, um all die gesunden Anteile. Die Menschen sind mehr als ihre Erkrankung.
Eingeführt wurde die WzT am Kantonsspital St.Gallen im Jahr 2018 auf Anregung unserer Pflegefachkraft Michaela Forster, die auch die Projektverantwortliche für die WzT ist. Sie hat die Fragen des Gesprächsleitfadens, den wir hier verwenden, mit Herrn Chochinov persönlich besprochen – er hat sie in dieser Form für die Schweiz freigegeben.
Welche Patient:innen können die WzT in Anspruch nehmen? Und: Welche nehmen sie erfahrungsgemäß in Anspruch?
G. Mallaun: Grundsätzlich kommt die WzT am Kantonsspital St.Gallen für Patient:innen im palliativen Stadium ihrer Erkrankung zur Anwendung. Gemäß der Intention von Chochinov muss eine oder mehrere der folgenden Indikationen erfüllt sein: Selbstentwertung, existenzielle Not, Sinnverlust und/oder das Bedürfnis, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Aus meiner Erfahrung ist es für unsere Gesprächspartner:innen am einfachsten, das Angebot anzunehmen, wenn sie einen ausgeprägten Wunsch nach einer Hinterlassenschaft hegen.
Wenn ich im Erstkontakt mit Interessent:innen die WzT jeweils nochmal vorstelle, sind es aber regelmäßig die Beschreibung der Aspekte verlorener Würde und der Ausblick auf eine Würdigung, die eine sichtbare Zustimmung im Gesicht erkennen lassen.
M. Buschor: In unserer Projektbeschreibung steht, dass grundsätzlich jeder Mensch, der mit lebensbedrohenden Krankheiten konfrontiert ist, auf die Würdezentrierte Therapie angesprochen werden kann. Sie sollte so früh wie möglich angeboten werden.
Die Faustregel ist: frühestens sechs Monate und spätestens zwei Wochen vor dem Tod. Es gibt Studien, die zu „early integration“ anhalten, also dazu, Patient:innen früh auf ihre Lebensqualität anzusprechen. Aber oft ist es so, dass „palliativ“ in der Klinik immer noch „sehr nah am Sterben“ bedeutet. Damit erfolgt die palliative medizinische Intervention spät und eben auch der Einsatz der WzT. Dabei würde es oft schon viel früher Sinn machen, die Würde zu stärken. WzT geht in unserer Erfahrung im Spital auch mit einer besseren Symptomkontrolle einher.
Es stellt sich auch die Frage, wie präzise das Lebensende vorauszusagen ist. Dank moderner Therapien leben Patient:innen länger, Überlebenszeit zu prognostizieren ist nicht einfach und außerdem heikel bezüglich der Kommunikation.
Wichtig für die Teilnahme ist, dass Patient:innen motiviert sind, dass sie kognitiv klar sind, ihr Einverständnis geben können und sich sprachlich verständlich ausdrücken können. Außerdem muss die Sprache ihre Wirkung entfalten können, deswegen lassen wir auch keine Übersetzungen zu. Interviewende und Teilnehmende müssen die gleiche Sprache sprechen.
Ein Flyer fasst die wichtigsten Punkte der WzT zusammen (Abb. 1).
Welche Vorteile hat die Therapie für die Patient:innen?
G. Mallaun: Erinnerungen „einzuladen“ und sie zu erzählen ist ein identitätsstiftender Prozess. Die Begegnung mit der eigenen Vergangenheit, mit sich selbst, ist für die erzählende Person berührend, und natürlich auch für die zuhörende, sie weckt leichte und schwere Emotionen, sie weckt Freude am Erreichten, an selbstinitiierten guten Wendungen und solchen, die als Geschenk empfunden wurden.
Beim Vorlesen reagieren sehr viele Patient:innen mit spontanen Zwischenrufen: „Das haben Sie schön gesagt!“ Die Antwort darauf kann nur lauten: „Sie haben es so erzählt.“ Am Ende des Vorlesens und Redigierens herrscht praktisch immer eine Atmosphäre von stiller Freude, vielleicht auch Stolz über das Ergebnis der geleisteten Anstrengung, und Dankbarkeit.
Eine Gesprächspartnerin meinte im Nachhinein, das Erzählen selbst und die emotionalen Reaktionen der Empfänger:innen auf ihre Lebensrückschau hätten ihr nochmal einen Kraftschub gegeben.
Muss es manchmal ganz schnell gehen?
G. Mallaun: Ja, manchmal eilt es. Und manchmal merkt man während des Prozesses, dass es zu eilen beginnt. Daher wird oft nach Beendigung des Gesprächs die Frage wichtig: „Falls es nicht möglich ist, Ihnen das schriftliche Dokument vorzulesen, soll Ihre Lebensrückschau so, wie Sie sie jetzt erzählt haben, gedruckt und den Empfänger:innen zugestellt werden?“ In aller Regel stimmen die Betroffenen zu. Von denjenigen, die vor Fertigstellung ihrer Lebensrückschau verstorben sind, haben alle mir bekannten zugestimmt.
Spielt die Erkrankung eine zentrale oder eine Nebenrolle bei der Wiedererzählung des eigenen Lebens?
G. Mallaun: Das ist sehr unterschiedlich. Manche Patient:innen beginnen ihre Rückschau mit der aktuellen Krankheitssituation und beschreiben Last und Sorgen, auch ihre Trauer, sich vom Leben und ihren Liebsten zu verabschieden.
Andere erzählen erst auf Nachfrage von ihrer Erkrankung. Und ganz wenige entscheiden auf die Nachfrage hin, dass sie der Krankheit in ihrer Lebensrückschau keinen Raum geben möchten.
Was sind die größten Herausforderungen bei der Arbeit in der WzT?
G. Mallaun: Für uns Ausführende kann es herausfordernd sein, wenn jemand trotz Interesse an der WzT kaum etwas erzählt oder im Gegenteil überaus viele Erinnerungen hat und sie selbst kaum in einen Sinnzusammenhang stellen kann, sodass das zu tun an uns liegt. Herausfordernd kann zuweilen sein, beim Erinnern traumatischer Lebenserfahrungen wie Gewalt, Trennungen oder Verluste individuell adäquat zu reagieren. Zudem ist es wichtig und manchmal herausfordernd, als Zuhörende mitzudenken, wie das Erzählte auf die Empfänger:innen wirken kann, und allenfalls belastende Äusserungen mit den Erzählenden zu besprechen und zu bearbeiten.
Gibt es ein schönstes Erlebnis mit der WzT, über das Sie berichten wollen?
M. Buschor: Ich hatte die Möglichkeit, die WzT meiner eigenen Mutter anzubieten. Also habe ich selber ein solches Vermächtnis bekommen, mit dem Titel „Mit allem im Frieden“. Meine Mutter hat mir ihre Lebensrückschau noch zu ihren Lebzeiten zu Weihnachten geschenkt. Es war nicht einfach, dieses Vermächtnis entgegenzunehmen, aber es hat einen unschätzbaren Wert. Darin habe ich einiges gelesen, das Biografisches in meinem Leben erklärt und in ein anderes Licht gerückt hat.
Ohne ins Detail zu gehen, kann ich Patient:innen nun auch sagen, dass ich persönlich eine gute Erfahrung mit der WzT gemacht habe.
G. Mallaun: Sehr berührt hat mich, als eine bereits sehr geschwächte Frau bei der Übergabe der fertigen Dokumente fragte: „Würden Sie es mir noch einmal vorlesen?“ Noch einmal wollte sie ihr Leben Revue passieren lassen. Mit geschlossenen Augen hat sie zugehört.
Ein anderer Gesprächspartner war beim Vorlesetermin ganz aufgekratzt und sagte, er müsse unbedingt noch etwas, was in der Zwischenzeit passiert sei, einbringen. Das Erzählen seiner Lebensgeschichte hatte ihn zum Nachdenken über seine zerrissene Herkunftsfamilie gebracht. Über Social Media hatte er nach seinem Halbbruder gesucht, ihn gefunden und einen Kontakt herstellen können. Darüber war er sehr glücklich. Durch den Kontakt mit dem Halbbruder waren weitere sehr berührende Erinnerungen geweckt worden.
Wer stellt die Indikation zur WzT?
M. Buschor: Die Indikation wird nicht von einer Person gestellt, sondern von Multiplikator:innen. Die Kolleg:innen des interprofessionellen Teams der Palliativstation und die Ärzt:innen in den Palliativsprechstunden erhalten eine Einführung zur WzT. Einmal pro Woche ist die WzT auch fester Bestandteil in unseren interprofessionellen Besprechungen auf der Station.
Melden sich nur wenige Patient:innen für die WzT, versuchen wir auch herauszufinden, woran das liegt. Ein Faktor kann zum Beispiel ökonomischer Druck auf die Personaleinheiten sein. Um das Thema WzT aufzubringen, braucht man Zeit und Ruhe. Ein großer Vorteil ist, dass unsere Fachpersonen für WzT auch zu Patient:innen nach Hause gehen. Das ist nicht nur für Teilnehmende schön, sondern nimmt auch den Druck vom Spital, eine ruhige Umgebung zu bieten, in der es nicht nur um Medizinisches geht.
Sind positive Effekte der WzT auf das Personal zu beobachten?
M. Buschor: Dem medizinischen Personal, uns, hilft die WzT dabei, die Persönlichkeitsmerkmale und das Leben der Patient:innen wieder mehr in den Fokus zu rücken. Palliativmedizin verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, dem bio-psycho-sozialen und spirituellen Menschenbild entsprechend. Es besteht ein Spannungsfeld zwischen den Ansprüchen einer qualitativ hochstehenden, modernen Medizin, ökonomischen Aspekten und dem ganzheitlichen Therapieansatz. WzT stärkt den ganzheitlichen Blick. Sie schafft Augenhöhe. Das schätze ich sehr.
In welchem Tätigkeitsverhältnis stehen die Fachpersonen für WzT?
M. Buschor: Die Fachpersonen haben ein persönliches Interesse an dem Thema und machen Weiterbildungen zur WzT. Sie bekommen einen Stundenlohn. Das Palliativzentrum trägt die Produktionskosten für die Dokumente und die Anreisekosten.
Gibt es Datenschutzmaßnahmen?
M. Buschor: Die Lebensrückschauen gibt es nur in gedruckter Form. Es gibt immer wieder Diskussionen dazu, weil Angehörige öfter nach der digitalen Form des Dokumentes fragen. Ich bin klar dagegen, weil ein digitales Dokument veränderbar wird. Außerdem sollen die Persönlichkeitsrechte der Patient:innen geschützt werden.
Und es geht auch um das Patient:innengeheimnis. Dazu gehört auch, dass alle, die in der WzT arbeiten, einen Arbeitsvertrag mit dem Kantonsspital St.Gallen unterschreiben, dass WzT-Dokumente nicht in privaten Haushalten aufbewahrt werden dürfen und dass das Spital die Diktiergeräte für die Gespräche zur Verfügung stellt, deren Inhalte regelmäßig gelöscht werden sollten.
Was sind Empfehlungen für Kliniken, die die WzT etablieren wollen?
M. Buschor: Es ist gut, wenn man die Literatur konsultiert und sich anschließend mit Institutionen, die bereits mit WzT arbeiten, in Verbindung setzt. Netzwerkarbeit ist hier sehr wichtig. Wir sind offen, unsere Erfahrungen weiterzugeben, natürlich ohne dass wir die Dokumente weitergeben können.
Haben Sie ein Schlusswort zur WzT?
M. Buschor: Die WzT ist ein Instrument, um Menschen ganzheitlich zu betrachten. Ich persönlich empfinde dann auch Demut gegenüber der Lebensgeschichte der Patient:innen. In einer sehr ökonomisierten und schnelllebigen Medizin sollten wir uns das immer wieder vergegenwärtigen.
G. Mallaun: Aus meiner Erfahrung ist die WzT für die Erzählenden und für die Empfangenden berührend und wertvoll. Und auch für mich als Ausführende, da ich gerne Menschen essenziell begegne und gerne schreibe. Sie ist wundervoll und sinnstiftend.
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...