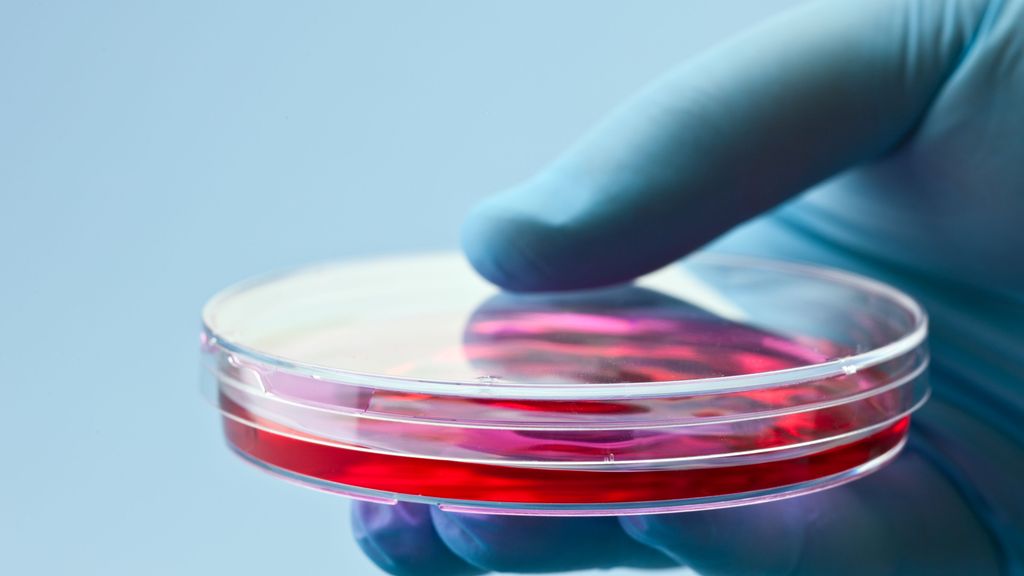
©
Getty Images/iStockphoto
Multiples Myelom: viele Studien mit spannenden Daten
Jatros
30
Min. Lesezeit
28.02.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In der Therapie des multiplen Myeloms hat es zahlreiche Entwicklungen gegeben, die beim Jahreskongress 2018 der American Society of Hematology (ASH) präsentiert wurden. Prof. Maria Krauth, Wien, geht im Interview auf einige wichtige Erkenntnisse ein.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Welches war beim multiplen Myelom aus Ihrer Sicht das größte Highlight, das beim ASH präsentiert wurde?</strong></p> <p><em><strong>M. Krauth:</strong></em> Es wurden sehr viele neue Daten präsentiert, daher ist es schwierig, ein Highlight herauszugreifen. So wurden spannende Studien im refraktären und im Front-Line-Setting vorgestellt. Auch die Kombination mit neuen Substanzen war ein wichtiger Aspekt. Aufgefallen sind die guten Daten von Daratumumab in Kombination mit Lenalidomid und Dexamethason in der MAIA-Studie, die es in die Late-Breaking Abstracts Session geschafft hat. Für die Klinik relevant waren auch die Ergebnisse unter anderem der OPTIMISMMStudie mit Patienten, die auf Lenalidomid refraktär sind. Lenalidomid ist mittlerweile etabliert in der Therapie des Multiplen Myeloms und kann als Backbone unterschiedlicher Kombinationstherapien in verschiedenen Therapielinien und Settings angesehen werden. Es kommt daher also zu einer zunehmenden Anzahl an Patienten, die mit Revlimid (vor)behandelt wurden und unter dieser Therapie oder danach einen Relaps erleiden.</p> <p><strong>Könnten Sie bitte das Design der MAIA-Studie und deren wichtigste Ergebnisse umreißen und Ihre Einschätzung dazu abgeben?</strong></p> <p><em><strong>M. Krauth:</strong></em> Die MAIA-Studie ist eine randomisierte Phase-III-Studie, in der man die Kombination aus Daratumumab, Lenalidomid und Dexamethason mit Lenalidomid plus Dexamethason verglichen hat. Eingeschlossen waren mehr als 700 Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die nicht für eine Transplantation geeignet waren. Der primäre Endpunkt war das PFS, sekundäre Endpunkte waren Gesamtansprechrate, die MRD und das Gesamtüberleben. Bei dieser Patientenpopulation hatte man in der FIRSTStudie schon gute Erfahrungen mit Lenalidomid plus Dexamethason gemacht: Die PFS-Daten dieser Kombination waren anderen Regimen überlegen. Und von Daratumumab wissen wir aufgrund der ALCYONE-Studie, dass es bei nicht transplantationsfähigen Patienten ebenfalls ausgezeichnete Überlebensdaten bei niedriger Toxizität in Kombination mit anderen Substanzen in der Erstlinientherapie erzielen kann. Interessant war nun, wie die Ergebnisse der Kombination beider Substanzen aussehen. Lenalidomid wurde in der Standarddosis von 25mg an den Tagen 1 bis 21 verabreicht. Daratumumab wurde ebenfalls in der Standarddosierung von 16mg/kg gegeben – in den Zyklen 1 und 2 wöchentlich, in den Zyklen 3 bis 6 alle zwei Wochen und ab dem 7. Zyklus einmal pro Monat bis zur Krankheitsprogression. Die Patienten der beiden Therapiearme entsprachen einander hinsichtlich des Alters, des Performance-Status und der Zytogenetik.<br /> Die PFS-Daten waren dann so beeindruckend, dass die MAIA-Studie in der Late-Breaking Abstracts Session vorgestellt wurde. Für die Dreierkombination Daratumumab/ Lenalidomid/Dexamethason wurde das mediane PFS bei einem durchschnittlichen Follow- up von 28 Monaten nicht erreicht; bei Lenalidomid/ Dexamathason lag es bei knapp 32 Monaten (Abb. 1). Auch dieses Ergebnis ist zwar für sich genommen sehr gut, bei genauer Betrachtung der Grafik läßt sich aber erkennen, dass die beiden Kurven im Verlauf eher weit auseinander gehen. Dies spricht dafür, dass das mediane PFS unter der Dreierkombination, also im Daratumumab-Arm, wahrscheinlich noch länger nicht erreicht werden wird. Das Risiko für Progression oder Tod wurde bei nicht transplantationsfähigen Patienten mit multiplem Myelom um rund 45 % verringert. Ähnlich gut sehen auch die Ansprechraten aus. Außerdem wurde mit der Dreierkombination ein tieferes Ansprechen im Sinne eines sehr guten teilweisen Ansprechens (VGPR) und vollständigen Ansprechens (CR) erreicht.<sup>1</sup> Damit haben wir auch für die älteren, nicht transplantationsfähigen Patienten äußerst wirksame Therapieoptionen in der Erstlinien-Behandlung.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Onko_1901_Weblinks_jatros_onko_1901_s35_abb1.jpg" alt="" width="450" height="356" /></p> <p><strong>Sie haben die OPTIMISMM-Studie erwähnt. Welches ist nach Ihrer Einschätzung das wichtigste Ergebnis dieser Studie?</strong></p> <p><strong><em>M. Krauth:</em></strong> Die OPTIMISMM-Studie ist ebenfalls eine Phase-III-Studie; verglichen wurde die Kombination aus Pomalidomid, Bortezomib und Dexamethason mit Bortezomib/Dexamethason. Das Besondere an dieser Studie ist, dass alle Patienten bereits mit Lenalidomid vorbehandelt oder Lenalidomid-refraktär waren. Die Patienten hatten im Durchschnitt bereits zwei vorangegangene Therapielinien erhalten; 70 Prozent von ihnen waren refraktär auf Lenalidomid. Das ist genau die Patientenkohorte, die in der Praxis zunehmend eine Rolle spielt.<br /> Pomalidomid wurde in der Dosierung von 4mg pro Tag an den Tagen 1 bis 14 gegeben, Bortezomib in den ersten acht Zyklen in der Dosis von 1,3mg/m<sup>2</sup> an den Tagen 1, 4, 8 und 11, anschließend an den Tagen 1 und 8. Dexamethason wurde in einer Dosis von 20mg bzw. in einer reduzierten Dosis von 10mg am Tag und am Tag nach Bortezomib verabreicht. Behandelt wurde bis zur Krankheitsprogression. Die Patientencharakteristika einschließlich der Nierenfunktion in beiden Therapiearmen waren ausgeglichen. Auch hier zeigte die Dreierkombination einen eindeutigen Überlebensvorteil: In der Intention-to-treat-Population lag das mediane PFS unter der Dreierkombination bei rund 11 Monaten versus 7 Monate. Dabei profitierten besonders Patienten, die nur eine vorangegangene Therapielinie hatten. Diese hatten PFS-Raten von knapp 21 versus 12 Prozent. Zu den Nebenwirkungen ist zu sagen, dass Grad-3- und -4-Nebenwirkungen unter der Dreierkombination etwas erhöht waren, besonders Neutropenien und Infektionen.<sup>2</sup></p> <p><strong>Wie ordnen Sie das Poster von Daniel Lechner mit den Real-World-Daten zu Pomalidomid/Dexamethason bei Patienten mit relapsierten/refraktären multiplen Myelomen aus Österreich ein?</strong></p> <p><strong><em>M. Krauth:</em></strong> Sogenannte Real-World- Daten gewinnen in der täglichen klinischen Praxis zunehmend an Bedeutung, da es um Patienten geht, die nicht so stark selektiert sind wie in den großen Phase-III-Studien. Es ist wichtig, national und international Daten zu erheben, um zu sehen, ob die Resultate der klinischen Studien auch in nicht selektierten Patientenpopulationen reproduziert werden können. Damit beschäftigt sich Dr. Lechner und er hat versucht, die Daten der Zulassungsstudie MM-003 von Pomalidomid zu reproduzieren. Das ist gelungen: Die Ansprechraten waren gleich gut und sogar noch besser als in der klinischen Studie. So berichtete Dr. Lechner von Ansprechraten von rund 50 Prozent und von einem durchschnittlichen PFS von 11,8 Monaten. In der MM-003-Studie waren es nur 4 Monate gewesen. Eine Ursache dafür ist möglicherweise, dass die Patienten in der Zulassungsstudie Pomalidomid erst sehr spät bekommen haben – nach etwa fünf bis sechs vorangegangenen Therapielinien. In der Real-World-Studie war die durchschnittliche Zahl vorangegangener Therapielinien deutlich weniger, im Median 4 Vortherapien. Dabei war die Verträglichkeit von Pomalidomid/ Dexamethason gut. Es mussten nur wenige Dosisreduktionen vorgenommen werden. Zum Therapieabbruch kam es in der Regel aufgrund einer Krankheitsprogression, aber nicht wegen Pomalidomidbedingten Nebenwirkungen. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Neutropenien und Infektionen. Auch die Rate an Thromboembolien war etwas höher bei Patienten die Pomalidomid erhielten. Die Mehrzahl der Patienten erhielt eine Thromboseprophylaxe, hauptsächlich ASS. Es wurden keine Nebenwirkungen beobachtet, die nicht zuvor in den klinischen Studien aufgetreten waren. Die Sicherheit von Imnovid bestätigte sich also auch in der „realen Welt“. Letztlich passen daher die von Dr. Lechner erhobenen Daten gut zu den Daten aus der Zulassungsstudie.</p> <p><strong>Könnten Sie nun noch einmal zusammenfassen, was Sie aus den drei Studien für die klinische Praxis mitnehmen? Was ist die Quintessenz für das klinische Prozedere?</strong></p> <p><em><strong>M. Krauth:</strong></em> Wir müssen hier unterscheiden zwischen Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom und den bereits vorbehandelten Patienten, die unter anderem bereits refraktär sind auf Revlimid. Für mich ist besonders wichtig, dass Patienten, die nicht für eine Transplantation geeignet sind – also auch viele ältere Patienten –, trotzdem von Anfang an mit einer sehr effektiven Therapie behandelt werden können. Und das nicht nur mit Zweier-, sondern auch mit Dreierkombinationen bei guter Verträglichkeit und einem günstigen Nebenwirkungsprofil. Daher wird die Dreierkombination möglicherweise der neue Therapiestandard für diese Patienten werden.<br /> Was die beiden anderen Studien angeht, ist es wichtig mitzunehmen, dass die Gruppe der Patienten, die auf Lenalidomid refraktär sind, zunehmen wird. Dies ist im klinischen Alltag ein Problem. Dank der OPTIMISMM- und der Real- World-Studie von Dr. Lechner haben wir nun gute Daten, dass Pomalidomid bei diesen Patienten sehr gut wirkt – und zwar in der Zweierkombination mit Dexamethason wie auch in der Dreierkombination mit Bortezomib/Dexamethason bzw. einer anderen Substanz. Und schließlich sollte man festhalten, dass die Ergebnisse der Phase-III-Studien mit Pomalidomid auch in die reale Welt übertragen werden können, wie Dr. Lechner gezeigt hat.</p> <p><strong><em>Vielen Dank für das Gespräch!</em></strong></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Facon T et al.: Blood 2018; 132(suppl): LBA-2 <strong>2</strong> Dimopoulos MA et al.: Blood 2018; 132(suppl): 3278 <strong>3</strong> Lechner D et al.: Blood 2018; 132(suppl): 2018</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


