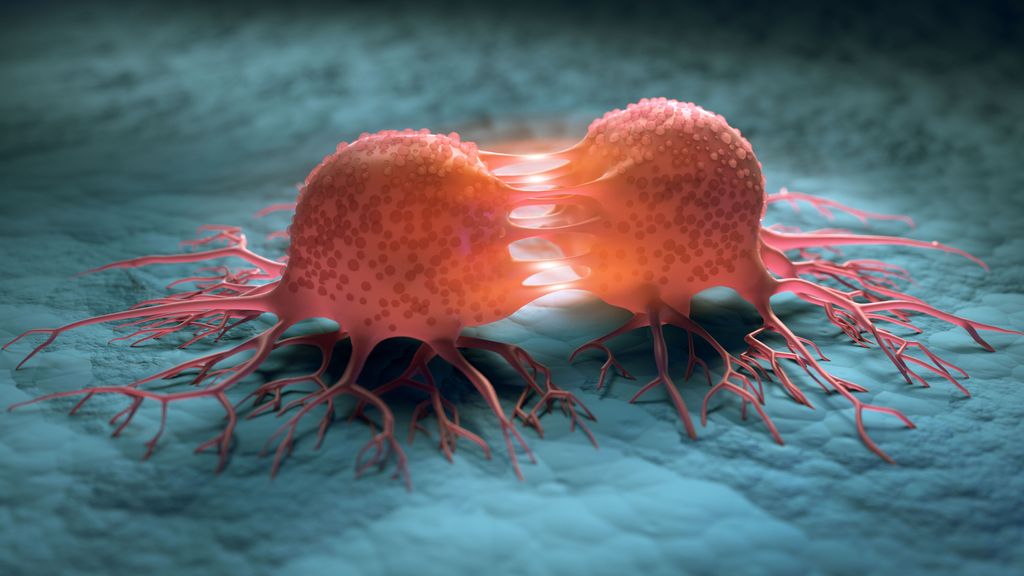
©
Getty Images/iStockphoto
Lungenzytologie – Relevanz und Aussagekraft
Jatros
Autor:
OA Dr. Johann Schalleschak
Zentrallabor, Otto-Wagner-Spital<br> E-Mail: johann.schalleschak@wienkav.at
30
Min. Lesezeit
25.05.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Lunge gehört zu jenen Organen, für welche die Zytologie eine wichtige diagnostische Bedeutung hat. Bereits in den 1950er-Jahren haben Pulmologen die Vorteile der neu aus Amerika gekommenen Methode erkannt und in ihrem Bereich erfolgreich eingesetzt. Die Vorteile der Methode waren und sind eine suffiziente Diagnose auch bei geringer Materialmenge und die Möglichkeit, rasch zu einem Befund zu gelangen. ROSE („rapid on-site evaluation“) ist ein Beispiel dafür.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Durch verbesserte Entnahmetechniken und die Technik der histologischen Aufarbeitung des Zellblocks stieg zwar die Zahl von Fällen, in welchen auch histologisch verwertbares Material vorhanden ist, doch lag z.B. bei einer Erhebung im Jahr 2013 in unserem Haus, dem Otto- Wagner-Spital (OWS), der Prozentsatz von Fällen, bei welchen nur eine zytologische Diagnose möglich war, insgesamt bei 43,2 % , bei den malignen Fällen bei 25,1 % .</p> <h2>Weg der Befunderstellung</h2> <p>Basis jedes Befundes ist das morphologische Bild, danach werden immunzytochemische Färbungen festgelegt, die heute zum Befundstandard gehören (Abb. 1). Seltener kommen Spezialfärbungen, wie z.B. die Bakterienfärbungen nach Gram und Ziehl-Neelsen, zum Einsatz. In die Befundung einbezogen werden auch Informationen aus der Anamnese, wie Vorerkrankungen oder erfolgte Therapien, der bronchologische Befund und Laborergebnisse wie Tumormarkerspiegel oder Resultate durchflusszytometrischer Messungen. Im Befund werden die gewonnenen Fakten zusammengeführt: Er sollte eine Angabe über die Materialqualität (nicht aussagekräftig, bedingt aussagekräftig mit einer Begründung oder aussagekräftig) enthalten, sodann eine Beschreibung des morphologischen Bildes und der Ergebnisse der immunzytochemischen Färbungen mit einer abschließenden Gesamtdiagnose. Zusätzlich ist die Angabe einer Dignitätsbewertungsgruppe empfehlenswert. Diese verdeutlicht die Diagnose und hilft bei der statistischen Aufarbeitung. In manchen Häusern, wie dem unseren, wird eine Einteilung in fünf „Bewertungsgruppen“ verwendet (0 = insuffizient, II = benigne, III = auffällig bzw. unklar, IV = tumorverdächtig, V = maligne). Andere Institute verwenden die Beurteilung nach der Empfehlung der Österreichischen Gesellschaft für Zytologie mit vier Gruppen (0 = insuffizient, A = benigne, B = auffällig, unklar, C = tumorverdächtig oder maligne).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Onko_1703_Weblinks_s66_abb1.jpg" alt="" width="894" height="766" /></p> <h2>Befundaussagen</h2> <p>Die Zytologie ist eine morphologische Methode und entsprechend sind die Fragen des Klinikers an sie. Er erwartet eine Aussage über die Dignität, über die Art der Erkrankung bzw. bei malignen Tumoren eine Typenzuordnung evtl. mit Angabe eines Primärorgans und eine Aussage über den Ausbreitungsgrad.</p> <h2>Dignität</h2> <p>Die Dignität einer Veränderung kann zytologisch zumeist bestimmt werden, auch in Schnellfärbungen. 2011 und 2013 haben wir genauere Daten bezüglich der Dignitätsbestimmung erhoben, die Sensitivität der Zytologie lag dabei bei 95 % bzw. 98,5 % , die Spezifität bei 99 % bzw. 100 % . Die Basis der statistischen Zahlen waren 2397 Fälle im Jahr 2011 und 2288 Fälle im Jahr 2013. Der Anteil unklarer Fälle liegt im Zentrallabor des OWS über Jahre ungefähr gleich hoch bei 2 bis 3 % .</p> <h2>Bestimmung der Art der Erkrankung</h2> <p>Bei benignen Erkrankungen handelt es sich zumeist um Entzündungen oder Granulomatosen, seltener um Zysten, benigne Tumoren, meistens Hamartome oder Fibrosierungen. Bei den malignen Erkrankungen führen die primären Lungentumoren, wobei verhornende Plattenepithelkarzinome auch ohne Immunzytochemie zu diagnostizieren sind, bei der nicht verhornenden Variante wird der Marker P40 zur Absicherung bzw. Zuordnung eingesetzt. Adenokarzinome können im Allgemeinen morphologisch und in Einzelfällen über den Marker TTF1 diagnostiziert werden. Eine Verschleimung ist erkennbar. Eine Subtypisierung in lepidisch, mikro-oder makropapillär etc. ist nicht möglich. Die Diagnose von neuroendokrinen Tumoren ist unterschiedlich schwierig: Das typische Karzinoid und das kleinzellige Karzinom weisen ein charakteristisches zytologisches Bild auf. Das atypische Karzinoid hat eine hinweisende Morphologie und kann mithilfe des Proliferationsindex zugeordnet werden. Das großzellige neuroendokrine Karzinom ist zytologisch uncharakteristisch: Es ist ein wenig differenziertes, nicht kleinzelliges Karzinom und kann nur über das immunzytochemische Markerprofil diagnostiziert werden.<br /> Ähnlich verhält es sich bei Metastasen: Es gibt solche mit typischer Morphologie wie das Kolon- oder das hellzellige Nierenzellkarzinom, solche, die wie das Blasenkarzinom kein organtypisches Bild zeigen, aber mithilfe der Immunzytochemie bestimmt werden können, und solche, für welche auch kein brauchbarer Marker vorhanden ist, wie das Pankreaskarzinom.<br /> Melanome bereiten in ihrer amelanotischen Form Schwierigkeiten. Zwar existieren Marker mit hoher Spezifität wie Melan A oder HMB45, doch muss man, wenn kein anamnestischer Hinweis vorhanden ist, erkennen, dass ein Melanom vorliegt. Der Tumor kann nämlich sehr unterschiedliche Bilder bieten, er kann einem Adenokarzinom ebenso wie einem spindelzelligen mesenchymalen Tumor ähneln.<br /> Lymphome sind unterschiedlich gut zu diagnostizieren, M. Hodgkin hat ein typisches Bild und ist immunzytochemisch bestätigbar. Die Bestimmung der Untergruppe ist zytologisch jedoch nicht möglich. „High grade“ (sensible) Lymphome bereiten keine Schwierigkeiten, da Blasten leicht erkennbar sind. Schwieriger bis unmöglich ist die Diagnose von „low grade“ (indolenten) Lymphomen, einen Hinweis geben das gleichförmige Zellbild und – da es sich zumeist um B-Zell-Lymphome handelt – die durchgängige Anfärbung mit einem B-Zell-Marker.<br /> Bleiben die Sarkome – sie sind die größte Hürde für den Zytologen. Ist die Dignität durch ein extrem polymorphes Zellbild erkennbar, so ist die Typenzuordnung zumeist nicht möglich. Kann man einen Zelltyp, z.B. glatte Muskelzellen erkennen, bestehen Schwierigkeiten bei der Dignitätsbestimmung. Insgesamt ist die Übereinstimmung in der Tumortypisierung zwischen Zytologie und Histologie in den letzten Jahren gestiegen und generell hoch. Hintergrund dafür ist der routinemäßige Einsatz der Immunzytochemie bzw. -histologie, 2013 haben wir eine entsprechende Statistik erhoben (Tab. 1). Es handelte sich um 563 Fälle, über alle Tumortypen lag die Übereinstimmung bei 95,6 % (Plattenepithel-Ca 94,7 % , Adeno-Ca 98,2 % , kleinzelliges Ca 97,7 % , Metastasen 88,2 % ).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Onko_1703_Weblinks_s66_tab1.jpg" alt="" width="2151" height="1045" /></p> <h2>Ausbreitungsgrad maligner Tumoren</h2> <p>Eine Aussage über den Ausbreitungsgrad eines Tumors ist zytologisch nur insofern möglich, als man z.B. bei einem Hautknoten sagen kann, ob eine Absiedlung des Tumors vorhanden ist. Für Fragen nach einer Infiltration z.B. in tiefere Schleimhautschichten ist die Gewebsarchitektur notwendig, sie sind daher von der Zytologie nicht beantwortbar.</p> <h2>Einschränkungen</h2> <p>Die größte technische Einschränkung ist der Materialmangel, da oft nur zwei oder drei Ausstriche von häufig sehr ungleicher Qualität vorhanden sind. Auf einem Ausstrich finden sich viele Tumorzellen, auf dem nächsten nur wenige oder gar keine. Dass einige wichtige Marker für die Immunzytochemie nicht adaptierbar sind, stellt einen weiteren Mangel dar. Einschränkungen in der Befundung finden sich in jenen Fällen, für welche die Gewebearchitektur benötigt wird, daher ist die Einteilung der Adenokarzinome in Subgruppen wie schon erwähnt ebenso wie die Einteilung fibrosierender Prozesse zytologisch unmöglich. Erkennbar sind nur Hinweise auf einen fibrosierenden Prozess. Schwierigkeiten bezüglich der Dignitätsbestimmung können bei benignen Erkrankungen auftreten, wenn erhebliche Atypien vorhanden sind, wie bei Virusinfektionen (z.B. HPV) und aktiven fibrosierenden Prozessen (z.B. nach Strahlentherapie). Auch die Unterscheidung reaktiver Lymphknoten vs. „low grade“ NHL kann Probleme bereiten.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Die Zytologie ist eine sehr leistungsfähige und verlässliche Methode, jedoch im hohen Maß abhängig von der Erfahrung der Untersucher. Dazu gehören Bronchologen bzw. Röntgenologen, die suffizientes Material gewinnen müssen, und Zytologen, die sich über die Grenzen der Methode im Klaren sein müssen, damit sie ihre Möglichkeiten ausschöpfen, aber auch wissen, welche Aussagen zytologisch nicht möglich sind. Große Spezialkliniken wie das Otto- Wagner-Spital, in dem täglich zwischen 7 und 10 Bronchoskopien durchgeführt werden, sind dabei sicher im Vorteil.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


