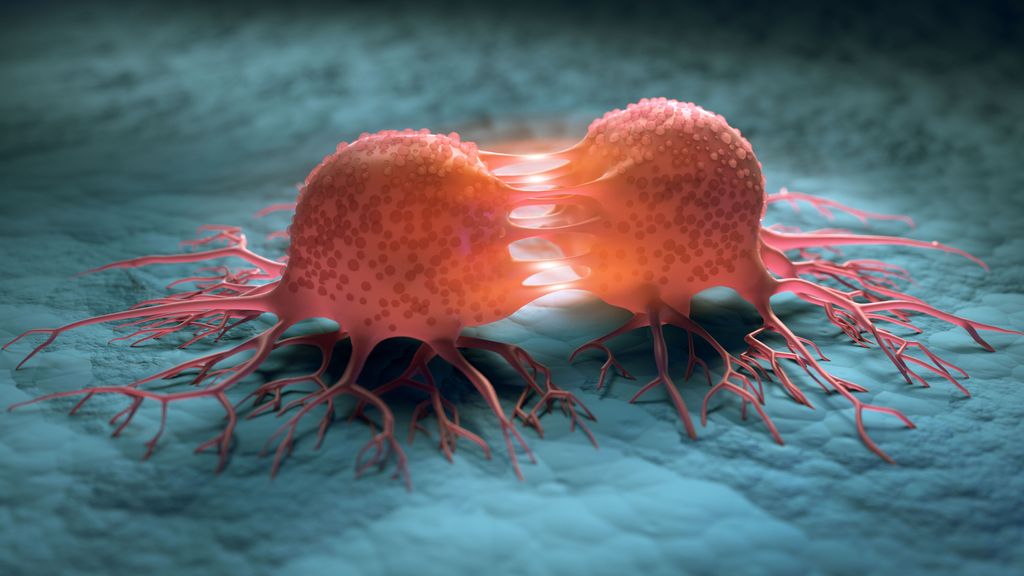
©
Getty Images/iStockphoto
Kolonkarzinom: Das Mikrobiom spricht mit
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
07.03.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Das Wissen, dass das Mikrobiom beim Kolorektalkarzinom (CRC) eine wichtige Funktion hat, setzt sich immer mehr durch. Die Hinweise zum Einfluss des Mikrobioms mehren sich nicht nur bei der Rolle in der Entstehung des CRC, sondern auch im Verlauf und in der Behandlung. Schliesslich wird auch sichtbar, dass der Begriff des Mikrobioms breit gefasst werden muss und nicht nur Bakterien einen Einfluss haben können.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Mit einer Biomasse von einem halben Kilo mit insgesamt rund 100 Trillionen Bakterien hat das Mikrobiom laut Prof. Dr. med. Herbert Tilg vom Departement für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie der Medizinischen Universität Innsbruck einen bedeutenden Einfluss auf die lokale und systemische Immunität des Organismus. Im Rahmen eines Hauptvortrages anlässlich des WCGC 2018 in Barcelona vermochte der Vortragende die Zuhörenden in seinen Bann zu ziehen. Das Mikrobiom, das metabolische Prozesse entscheidend mitbeeinflusst und selbst mannigfachen Einflüssen ausgesetzt ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Krankheiten des Leber- und Magen-Darm-Trakts.</p> <h2>Der mikrobielle Fingerabdruck</h2> <p>Das Mikrobiom verteilt sich im Intestinaltrakt in geregelter Art und Weise in unterschiedlicher Menge und Zusammensetzung auf verschiedene Kompartimente der Schleimhaut und ist verhältnismässig stabil zusammengesetzt. Bei den Bakterien wurden bislang rund 500 Spezies ermittelt. Allerdings sind es vor allem sechs bakterielle Phyla, die eine bislang bekannte wichtige Rolle spielen: Firmicutes (65 %), Bacteroidetes (25 %), Actinobacteria (5 %), Proteobacteria (3 %), Fusobacteria (1 %) und Verrucomicrobia (1 %).<br /> Die Zusammensetzung ist erstaunlich personenspezifisch und wird auch als mikrobieller Fingerabdruck bezeichnet. Allerdings kann eine spezifische Diät schnell und reproduzierbar die Zusammensetzung des Mikrobioms verändern. Eine fleischbetonte Ernährung erhöhte das Vorkommen von Galle-toleranten Mikroorganismen (Alistipes, Bilophila und Bacteroides) und verringerte die Konzentrationen von Firmicutes, die diätetische Pflanzenpolysaccharide metabolisieren (Roseburia, Eubacterium rectale und Ruminococcus bromii).<sup>1</sup></p> <h2>Aufschlussreiche metagenomische Studien in CRC-assoziierten Mikrobiomsignaturen</h2> <p>Es existiert laut Tilg ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Entzündung, Mikrobiom und Gastrointestinalkarzinomen, was der Vortragende mit einer Reihe von Studien untermauerte. Ein Beispiel ist die Rolle von Lipocalin-2 (LCN2), auch als Neutrophilen-Gelatinase- assoziiertes Lipocalin (NGAL) bekannt: Es wird von verschiedenen Zelltypen freigesetzt und ist ein attraktiver Biomarker für Entzündungen, Ischämie, Infektionen und Nierenschäden. Sowohl intestinale als auch metabolische Entzündungen, wie sie bei Adipositas und verwandten Störungen beobachtet werden, sind mit einer erhöhten LCN2-Synthese verbunden. Während LCN2 im Darmtrakt die Zusammensetzung der Darmmikrobiota reguliert und entzündungshemmende Aktivitäten zeigt, demonstriert es auch proinflammatorische Aktivitäten in anderen experimentellen Einstellungen.<sup>2</sup><br /> Bei entzündlichen Darmerkrankungen werden hohe mukosale und fäkale Konzentrationen von LCN2 – auch als antimikrobielles Siderophor-bindendes Peptid bezeichnet – beobachtet. Die Autoren einer Arbeit konnten zeigen, dass LCN2 vor früh einsetzender Kolitis und spontanem Auftreten von rechtsseitigen Kolontumoren schützt, die bei einem IL-10-Mangel auftreten. LCN2(-/-)/Il10(-/-)-Mäuse zeigen tiefgreifende Veränderungen in der mikrobiellen Zusammensetzung des Darms, was zu Entzündungen und Tumorgenese beiträgt. Dies wird auch durch die Übertragbarkeit des Phänotyps gezeigt.<sup>3</sup><br /> Experimentelle Beweise aus den vergangenen Jahren zeigen somit eine Schlüsselrolle für die Darmmikrobiota bei entzündlichen und malignen Magen- Darm-Erkrankungen. Die Ernährung hat einen starken Einfluss auf die mikrobielle Zusammensetzung und beeinflusst das Risiko, ein CRC zu entwickeln. So haben grosse metagenomische Studien in humanen CRC-assoziierten Mikrobiomsignaturen im Rahmen der kolorektalen Adenom-Karzinom-Sequenz auf eine fundamentale Rolle der intestinalen Mikrobiota bei der Entwicklung von gastrointestinalen Malignitäten hingewiesen. Weitere Studien sind notwendig, um die Mechanismen der Tumorpromotion und der mikrobiellen Koevolution bei CRC zu entschlüsseln. Dies könnte künftig auch therapeutisch genutzt werden.<sup>4</sup></p> <h2>CRC-assoziierte Mikroben mit proneoplastischer Aktivität</h2> <p>Die vom Mikrobiom zum Überleben, Gedeihen und Vermindern der Immundetektion in der Dickdarmschleimhaut verwendeten Instrumente haben in einer dysplastischen präkanzerösen Umgebung gemäss Tilg tumorpromovierende Eigenschaften. Die CRC-Entwicklung ist hierbei ein sequenzieller Prozess mit mehrfachen Erscheinungsformen, bei dem sowohl die Entzündung als auch die Mikrobiota wichtige Rollen haben. Aufgrund ihrer engen und miteinander verflochtenen Beziehung sind sie schwer zu entwirren.<br /> Metanomics-Studien liefern einen guten Einblick in diejenigen Mikroben, die mit der CRC-Progression assoziiert sind. Zu nennen sind beispielsweise die derzeit am besten untersuchten CRC-assoziierten Mikroben F. nucleatum, enterotoxigene B. fragilis und Colibactin-produzierender E. coli, die eine Modulation der Tumorimmunumgebung bewirken und zur Förderung von DNA-Schäden beitragen.<sup>5</sup></p> <h2>Biofilme: erhöhtes Tumorrisiko</h2> <p>Eine weitere Studie konnte laut Tilg zeigen, dass die Schleimhautmikrobiotaorganisation ein kritischer Faktor ist, der mit einer Untergruppe von CRC assoziiert ist. So wurden invasive polymikrobielle bakterielle Biofilme identifiziert, Strukturen, die früher mit einer nicht malignen Darmpathologie assoziiert waren: in 89 % bei Tumoren auf der rechten Seite (13 von 15 CRC, 4 von 4 Adenomen), aber nur in 12 % bei linksseitigen Tumoren (2 von 15 CRC, 0 von 2 Adenomen).<br /> Überraschenderweise wurden bei Patienten mit Biofilm-positiven Tumoren, ob Krebs oder Adenom, alle Biofilme auf der tumorfreien Schleimhaut weit entfernt von ihren Tumoren lokalisiert. Die bakteriellen Biofilme wurden mit vermindertem Kolonepithelzellen-E-Cadherin und erhöhter IL-6- und Stat3-Aktivierung der Epithelzellen sowie einer erhöhten Proliferation der Kryptenepithelzellen in normaler Darmschleimhaut assoziiert. Allerdings konnte keine konsistente bakterielle Gattung, die mit den Tumoren assoziiert war, nachgewiesen werden. Der Biofilmnachweis der Darmschleimhaut kann ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von sporadischem CRC vorhersagen.<sup>6</sup><br /> Die Mikrobiota, die mit präkanzerösen Läsionen bei erblichem CRC assoziiert sind, bleiben weitgehend unbekannt. Doch eine Studie untersuchte die Kolonschleimhaut von Patienten mit familiärer adenomatöser Polyposis (FAP), die früh im Leben benigne Polypen entwickeln. Sie identifizierte fleckige bakterielle Biofilme, die vorwiegend aus Escherichia coli und Bacteroides fragilis bestanden. Gene für Colibactin (clbB) und Bacteroides-fragilis-Toxin (bft), die für sekretierte Onkotoxine kodieren, waren im Vergleich zu gesunden Individuen in der Kolonschleimhaut von FAP-Patienten stark angereichert. Tumoranfällige Mäuse, die mit E. coli (Colibactin exprimierend) zusammen mit enterotoxigenem B. fragilis kolonisiert wurden, zeigten im Dickdarm ein erhöhtes Interleukin 17 und im Kolonepithel DNA-Schäden mit schnellerem Tumorbeginn und höherer Mortalität im Vergleich zu Mäusen, die jeweils nur mit einem bakteriellen Stamm kolonisiert wurden. Diese Daten weisen auf eine unerwartete Verbindung zwischen früher Kolonneoplasie und tumorigenen Bakterien hin.<sup>7</sup></p> <h2>Metagenom-Studien: neue Spezies sowie rotes Fleisch im Verdacht</h2> <p>Eine weitere Metagenom-weite Assoziationsstudie (MGWAS) mit Stuhlproben von Patienten mit fortgeschrittenem Adenom und Karzinom sowie von gesunden Probanden demonstriert die mikrobiellen Gene, Stämme und Funktionen, die in jeder Gruppe angereichert sind. Eine Analyse potenzieller Risikofaktoren zeigt, dass eine hohe Aufnahme von rotem Fleisch im Vergleich zu Obst und Gemüse mit dem Anwachsen von bestimmten Bakterien in Verbindung gebracht wird, die zu einer «feindseligeren» Darmumgebung beitragen könnten. Die Studienautoren beobachteten eine Zunahme bestimmter Bacteroides (dorei, massiliensis, ovatus, vulgatus) und E. coli beim CRC.<br /> B. dorei, B. vulgatus und E. coli korrelierten zudem mit den CRP-Spiegeln. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass fäkale Mikrobiom-basierte Nachweisstrategien für die Früherkennung und Behandlung von kolorektalen Adenomen oder Karzinomen nützlich sein können.<sup>8</sup><br /> Eine chinesische Studiengruppe publizierte die erste Metagenom-Profiling- Studie des Mikrobioms von CRC-Patienten. Ihr Ziel war die Entdeckung und Validierung mikrobieller Biomarker in ethnisch unterschiedlichen Kohorten sowie ausgewählte Biomarker mithilfe einer erschwinglichen klinisch relevanten Technologie unabhängig zu validieren. Damit geht die Studie einen Schritt weiter zu einer erschwinglichen nicht invasiven Frühdiagnostik von Biomarkern für Darmkrebs mittels Stuhlproben. Die Autoren entdeckten eine signifikante Anreicherung neuer Spezies, einschliesslich Parvimonas micra und Solobacterium moorei mit einem starken Netzwerk untereinander.<sup>9</sup></p> <h2>Virale Dysbiose ebenfalls verdächtig</h2> <p>Patienten mit kolorektalem Karzinom (CRC) haben somit möglicherweise eine andere Darmmikrobiomsignatur als Personen ohne CRC. Über die virale Komponente von CRC-assoziiertem Mikrobiom ist wenig bekannt. Das Ziel einer weiteren Studiengruppe war es deshalb, virale taxonomische Marker von CRC zu identifizieren und zu validieren, die bei der Erkennung der Krankheit oder der Vorhersage des Ergebnisses verwendet werden könnten.<br /> Es zeigte sich, dass die Diversität der Darm-Bakteriophagen-Gemeinschaft bei Patienten mit CRC im Vergleich zu Kontrollen signifikant erhöht war. Die klinische Subgruppenanalyse zeigte, dass eine Dysbiose des Darmvirus mit frühem und spätem CRC assoziiert war. Die Autoren fanden zudem veränderte Interaktionen zwischen Bakteriophagen und oralen bakteriellen Kommensalen in Stuhlproben von Patienten mit CRC im Vergleich zu gesunden Kontrollen.<sup>10</sup></p> <h2>CRC & Metastasierung: die Rolle von Fusobacterium nucleatum und einer Antibiose</h2> <p>CRC umfassen gemäss Tilg eine komplexe Mischung aus malignen Zellen, nicht transformierten Zellen und Mikroorganismen. Fusobacterium nucleatum gehört zu den am häufigsten vorkommenden Bakterienarten in CRC-Geweben. Eine Studiengruppe konnte zeigen, dass die Kolonisation von menschlichen CRC mit Fusobacterium und seinem assoziierten Mikrobiom – einschliesslich Bacteroides-, Selenomonas- und Prevotella- Spezies – in distalen Metastasen beibehalten wird. Dies belegt die Mikrobiomstabilität zwischen gepaarten primären und metastatischen Tumoren. In-situ-Hybridisierungs- Analysen zeigten, dass Fusobacterium vorwiegend mit Krebszellen in den metastatischen Läsionen assoziiert ist. In Maus-Xenotransplantaten von menschlichen primären kolorektalen Adenokarzinomen werden lebensfähiges Fusobacterium und sein assoziiertes Mikrobiom durch aufeinanderfolgende Passagen aufrechterhalten. Eine Behandlung dieser Mäuse mit Metronidazol reduzierte die Fusobacteriumbelastung, die Krebszellproliferation und das Gesamttumorwachstum. Diese Beobachtungen sprechen für eine weitere Untersuchung von antimikrobiellen Interventionen als eine mögliche Behandlung für Patienten mit Fusobacterium-assoziiertem CRC.<sup>11</sup></p> <h2>Die «guten» Darmbakterien unterstützen die Immuntherapie</h2> <p>Gegen CTLA-4 gerichtete Antikörper wurden erfolgreich als Krebsimmuntherapie verwendet. Eine Studie konnte zeigen, dass die Antitumorwirkungen der CTLA-4-Blockade von verschiedenen Bacteroides- Spezies abhängen. Tumoren in Antibiotika-behandelten oder keimfreien Mäusen reagierten nicht auf CTLA- Blockade. Dieser Defekt wurde durch eine Schlundsonde mit B. fragilis, durch Immunisierung mit B.-fragilis-Polysacchariden oder durch adoptiven Transfer von B.-fragilis-spezifischen T-Zellen überwunden.<sup>12</sup><br /> Residente Darmbakterien können somit die Reaktionen des Patienten auf die Krebsimmuntherapie beeinflussen. So konnte eine Arbeitsgruppe zeigen, dass der Antibiotikaverbrauch mit einer schlechten Reaktion auf eine immuntherapeutische PD- 1-Blockade einhergeht. Die Forscher stellten Proben von Patienten mit Lungen- und Nierentumoren zusammen und fanden heraus, dass nicht antwortende Patienten niedrige Konzentrationen des Bakteriums Akkermansia muciniphila aufwiesen. Die orale Supplementierung der Bakterien in Antibiotika-vorbehandelten Mäusen stellte die Antwort auf die Immuntherapie wieder her.<sup>13</sup><br /> Zwei weitere Studiengruppen untersuchten Melanompatienten, die eine PD- 1-Blockade erhielten, und fanden eine grössere Menge an «guten» Bakterien im Darm der antwortenden Patienten. Non-Responder hatten ein Ungleichgewicht in der Zusammensetzung der Darmflora, was mit einer beeinträchtigten Immunzellenaktivität korrelierte. Daher könnte die Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora den Patienten bei der Krebsbekämpfung helfen.<sup>14, 15</sup> Von diesem laut Tilg spannenden Gebiet der Krebsforschung wird künftig noch sehr viel zu hören sein.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: World Conference on Gastrointestinal Cancers (WCGC)
2018, Vortrag von Herbert Tilg: Opening Lecture «The
microbiome in colon cancer», 20. Juni 2018, Barcelona
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> David LA et al.: Nature 2014; 505(7484): 559-63 <strong>2</strong> Moschen AR et al.: Trends Endocrinol Metab 2017; 28(5): 388-97 <strong>3</strong> Moschen AR et al.: Cell Host Microbe 2016; 19(4): 455-69 <strong>4</strong> Tilg H et al.: Cancer Cell 2018; 3 3(6): 954-64 <strong>5</strong> Brennan CA et al.: Annu Rev Microbiol 2016; 70: 395-411 <strong>6</strong> Dejea CM et al.: Proc Natl Acad Sci U S A 2014; 111(51): 18321-6 <strong>7</strong> Dejea CM et al.: Science 2018; 359(6375): 592- 97 <strong>8</strong> Feng Q et al.: Nature Communications 2015; 6: Article number: 6528 <strong>9</strong> Yu J et al.: Gut 2017; 66: 70-8 <strong>10</strong> Nakatsu G et al.: Gastroenterology 2018; pii: S0016- 5085(18) 30479-7 <strong>11</strong> Bullman S et al.: Science 2017; 358(6369): 1443-8 <strong>12</strong> Vétizou M et al.: Science 2015; 350(6264): 1079-84 <strong>13</strong> Routy B et al.: Science 2 018; 359(6371): 91-7 <strong>14</strong> Gopalakrishnan V et al.: Science 2018; 359(6371): 97-103 <strong>15</strong> Matson V et al.: Science 2018; 359(6371): 104-8</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


