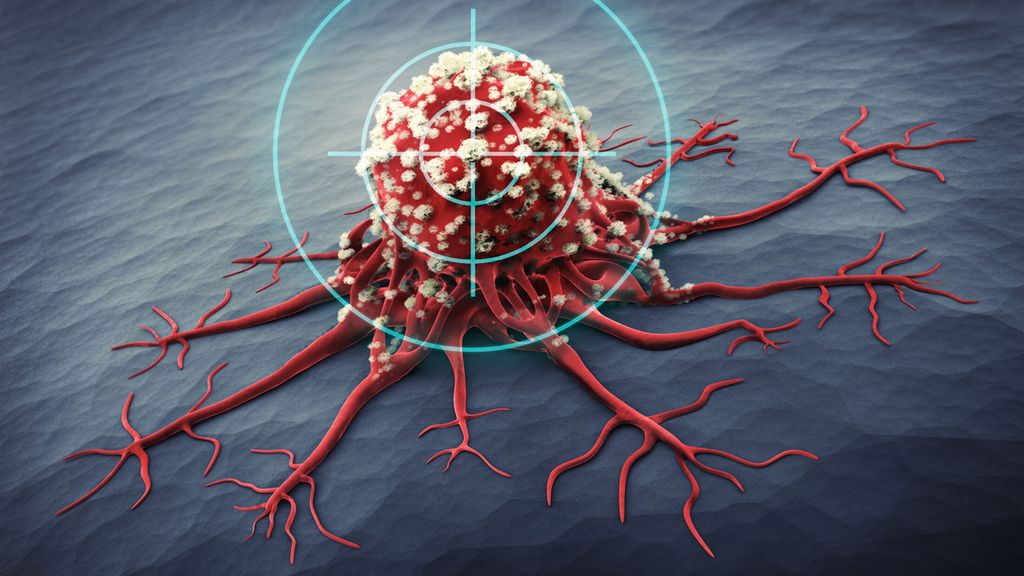
©
Getty Images/iStockphoto
Ketogene Diät bei Krebs: therapeutische oder nur ergänzende Maßnahme?
Jatros
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Michael Micksche
Ehem. Leiter des Instituts für Krebsforschung, MedUni Wien<br> E-Mail: michael.micksche@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
13.09.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Diätetische Maßnahmen als Bestandteil einer Krebstherapie werden seit vielen Jahren sowohl emotional als auch sachlich diskutiert. Ein Wunschdenken ist es, dass eine spezifische Ernährung bzw. deren Bestandteile zu einer Sensibilisierung von Krebszellen für/gegenüber Standard-Krebstherapien wie Chemo-, Strahlen-, aber auch Immuntherapie führt. Besonders die sogenannte ketogene Diät – kohlenhydratarme Kostform („low carb diet“) – hat wegen postulierter antitumoraler Effekte sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten eine gewisse Popularität erlangt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die ketogene Diät (KD) beruht auf der Beobachtung von Otto Heinrich Warburg – einem späteren Nobelpreisträger –, der 1924 erstmals beschrieben hat, dass sich Krebszellen zur Energiegewinnung der aeroben Glykolyse und nicht der oxidativen Phosphorylierung bedienen. Anstatt Glukose zu verbrennen, vergären sie Zucker zu Laktat. Fette und deren Bestandteile, wie Fettsäuren, verwerten Krebszellen nur in geringem Ausmaß. Bei dieser KD bilden sich sogenannte Ketonkörper, die dann Glukose weitgehend als Energielieferant ersetzen.<br /> Die Rationale für diese fettreiche „Low carb“-Diät ist die Verminderung der Glukoseverfügbarkeit, wodurch das Energiesubstrat für Krebszellen verknappt wird und diese durch Energieentzug „verhungern“. Zusätzlich wird durch die Senkung der Glukosespiegel eine Reduktion von Insulin und „Insulin-likegrowth“- Faktoren, die als Wachstumssignale fungieren, erzielt.<br /> Die Frage ist, ob und welche Schlüsse wir aus den publizierten Daten über KD von präklinischen Modellen bzw. von Studien bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit bei Krebspatienten ziehen können.<br /> Die Experten der Arbeitsgemeinschaft PRiO (Arbeitsgemeinschaft Prävention und Integrative Onkologie) in der Deutschen Krebsgesellschaft gaben 2014 auf Basis einer systematischen Literaturrecherche folgende negative Stellungnahme zum Thema KD bei Krebs ab:<br /> 1. Es liegt keine wissenschaftliche Untersuchung vor, die belegt, dass eine derartige Kostform Wachstum und Metastasierung eines Tumors beim Menschen verhindern bzw. zurückdrängen kann. 2. Es liegt auch keine wissenschaftliche Untersuchung vor, die beweist, dass eine derartige Kostform die Wirksamkeit einer Chemo- und/oder Strahlentherapie verbessert. 3. Es liegt des Weiteren keine wissenschaftliche Untersuchung vor, die beweist, dass die Verträglichkeit einer Chemotherapie beim Menschen durch diese Kostform verbessert wird.<br /> Zum derzeitigen Zeitpunkt kann eine Anwendung einer kohlenhydratarmen oder ketogenen Diät für diese Indikation nicht empfohlen werden.</p> <p>R. J. Klement hat in der Publikation „Beneficial effects of ketogenic diets for cancer patients: a realist review with focus on evidence and confirmation“ 29 tierexperimentelle Untersuchungen und 24 Patientenstudien einer systematischen Analyse unterzogen. Dabei berichtet der Autor, dass die Mehrheit, d.h. 72 % der präklinischen Studien, eine Evidenz für einen antitumoralen Effekt einer KD aufwiesen.</p> <p>Dieser Nachweis war dagegen beim Menschen schwach ausgefallen und nur auf individuelle Kasuistiken beschränkt. Der Autor folgerte weiters. „A probabilistic argument shows that the available data strengthen the belief in the anti-tumor effect hypothesis at least for some individuals.“ Dafür aber konnte eine nebenwirkungsfreie/-arme Durchführbarkeit der KD bei Krebspatienten allgemein bestätigt werden. Es gab in keiner dieser Studien einen Hinweis auf einen Tumor-promoting Effekt.</p> <p>Der rezente Review von S. B. Seidelmann et al. „Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis“ beschreibt für diese Kostform keinen Benefit für Langzeitüberleben; wobei eine Korrelation mit der Proteinquelle, d.h. tierisch = negativ und pflanzlich = positiv, in der Ernährung klar dokumentiert wurde.</p> <p>In der Publikation von D. Lettieri-Barbato und K. Aquilano „Pushing the limits of cancer therapie: the nutrient game“ wird – nach ausführlichem Review der Evidenzbasis – eine auf pflanzlicher Basis bestehende KD empfohlen, die in präklinischen Studien als therapeutische Intervention erforscht werden sollte. Unter dem Motto: „The game goes on!“</p> <p>Aus diesen nun vorliegenden Publikationen zum Thema „KD bei Krebspatienten“ kann der Schluss gezogen werden, dass kontrollierte und auch randomisierte klinische Studien dringend erforderlich sind, damit die postulierte antitumorale Wirksamkeit – im Sinne einer therapeutischen Diätform – bzw. die Nützlichkeit (Lebensqualitätsverbesserung, klinischer Benefit etc.) der KD beim Krebspatienten „evidenzbasiert“ bestätigt wird und diese Kostform generell empfohlen werden kann.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


