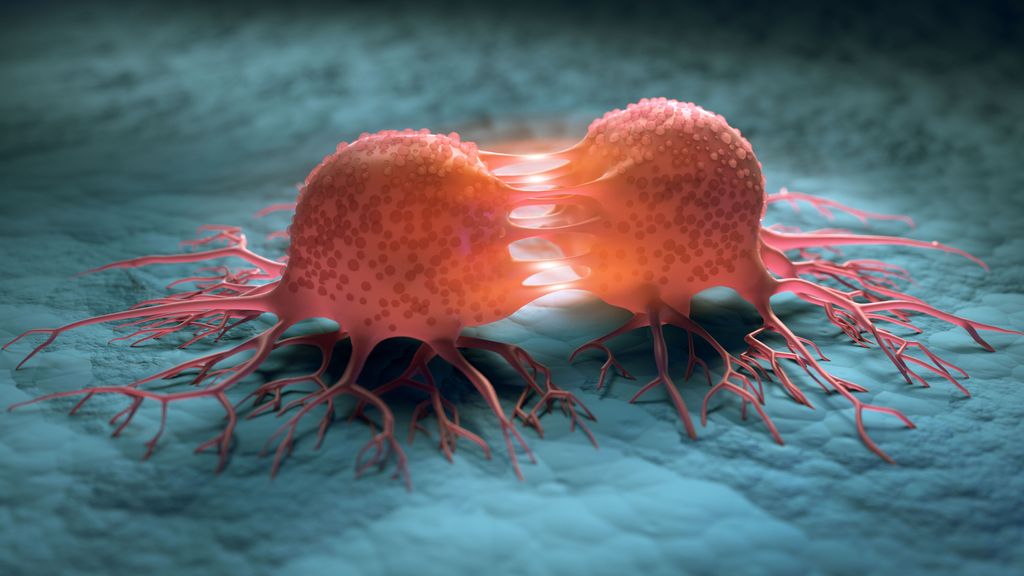
©
Getty Images/iStockphoto
Interventionelle Radiologie beim primären Leberzellkarzinom
Jatros
30
Min. Lesezeit
12.04.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) ist der vierthäufigste Tumor beim Mann und macht rund 10 % aller Krebserkrankungen weltweit aus. Univ.-Prof. Werner Jaschke von der Medizinischen Universität in Innsbruck sprach mit uns über den Stellenwert der interventionellen Radiologie bei der Behandlung des primären HCC, das auch Thema seines Vortrags beim Surger-I-nnsbruck Meeting im Dezember 2017 in Innsbruck war.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Herr Prof. Jaschke, die Inzidenz des hepatozellulären Karzinoms ist in den letzten Jahren gestiegen. Wie kommt es dazu?<br /><br /> W. Jaschke:</strong> Das primäre hepatozelluläre Karzinom ist eine Tumorentität, die weltweit eine sehr hohe Sterblichkeitsrate aufweist. Die Inzidenz ist in den letzten Jahren angestiegen. Gewisse Risikogruppen, wie Patienten mit Hepatitis B und C und Leberzirrhosepatienten, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein primäres HCC zu entwickeln. Seit einigen Jahren ist bekannt, dass Patienten mit einer alkoholischen oder nicht alkoholischen Fettleber auch ein erhöhtes Risiko aufweisen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Inzidenz weltweit ansteigt. Während in den Entwicklungsländern hauptsächlich die Viruslast für den Anstieg verantwortlich ist, ist es in den Industrieländern vor allem die Fettleber, die durch Diabetes, Fehlernährung oder zu hohen Alkoholkonsum verursacht wird.<br /><br /> <strong>Welche Rolle spielt die Radiologie in der Diagnostik und Therapie des primären HCC?<br /><br /> W. Jaschke:</strong> Die Diagnostik des HCC basiert fast ausschließlich auf bildgebenden Verfahren. Bei der Behandlung spielt die interventionelle Radiologie ebenso eine herausragende Rolle. Ganz im Gegensatz zu anderen Tumorerkrankungen, wo primär Strahlen- oder Chemotherapie oder Chirurgie eine dominante Rolle spielen, ist es beim HCC also umgekehrt. In den letzten 20 Jahren wurden hier enorme Fortschritte erzielt.<br /><br /><strong> Welche Behandlungsoptionen gibt es derzeit und wann werden diese eingesetzt?<br /><br /> W. Jaschke:</strong> In Europa gibt es ein Klassifikationsschema, nach dem die hepatozellulären Karzinome eingeteilt werden. Dieses „Barcelona Clinic Liver Cancer“(BCLC)-Staging-System teilt die HCC in 5 Stadien ein. Die BCLC-Klassifikation berücksichtigt sowohl das Tumorstadium als auch den Allgemeinzustand des Patienten und gibt gleichzeitig Hinweise auf die optimale Therapie in Abhängigkeit vom Stadium der Erkrankung.<br /> Die Einteilung erfolgt in das sehr frühe Stadium (0), das frühe Stadium (A), das intermediäre Stadium (B), das fortgeschrittene Stadium (C) und das terminale Stadium (D) (siehe Abb. 1., Seite 54).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Onko_1802_Weblinks_jatros_onko_1802_s50_abb1.jpg" alt="" width="1454" height="920" /></p> <p><br /><strong> Wie werden Leberkarzinome in frühen Stadien therapiert?<br /><br /> W. Jaschke:</strong> HCC im sehr frühen Stadium (Stadium 0) entsprechen einem einzelnen HCC mit einem Durchmesser von unter 2cm. In diesem Stadium ist die empfohlene Therapie die lokale Ablation mittels Radiofrequenz oder anderer thermischer Verfahren. Die Ablation wird bildgesteuert durchgeführt, üblicherweise im CT, seltener mit Ultraschall.<br /> Bei HCC im frühen Stadium (Stadium A) handelt es sich um einen oder weniger als drei Herde, die weniger als 3cm Durchmesser groß sind. Falls der Patient an einer portalen Hypertension leidet, ist die primär empfohlene Methode die Ablation. Wenn der Pfortaderdruck normal ist, kommt alternativ auch die chirurgische Resektion in Betracht. Ist der Patient für eine Lebertransplantation geeignet, dann stellt dies die beste Methode dar. Infolge der Organknappheit werden allerdings viele Patienten mittels chirurgischer Resektion oder Ablation behandelt. Die Ablation wird hierbei jedoch bevorzugt, weil sie weniger invasiv ist.<br /> In diesen sehr frühen oder frühen Stadien haben die Patienten prinzipiell die Chance auf Heilung. Das mittlere Überleben ist länger als fünf Jahre und die Langzeitüberlebensrate beträgt 40–70 % . In diesem Stadium sind die meisten Patienten also noch zu heilen, wobei das nur die Tumorerkrankung betrifft. Die zugrunde liegende Lebererkrankung wird natürlich nicht beeinflusst.<br /><br /><strong> Wie viele der Patienten befinden sich in Stadium 0 oder A?<br /><br /> W. Jaschke:</strong> Leider befindet sich die Mehrzahl der Patienten jenseits der Stadien 0 oder A. Die meisten Patienten befinden sich im intermediären Stadium oder Stadium B, d.h., sie haben mehr als drei Knoten oder einen einzelnen Herd, der größer ist als 5cm. In dieser Phase sind die interventionellen Verfahren die alleinigen Therapieverfahren. Die bevorzugte Methode ist die Chemoembolisation.<br /><br /><strong> In diesem Stadium kommen also keine chirurgische Verfahren mehr zum Einsatz?<br /><br /> W. Jaschke:</strong> Wie immer ist die Welt komplexer, als sie in den Schemata dargestellt wird. Es gibt inzwischen Literatur, die belegt, dass Patienten mit einem einzelnen Herd, auch wenn er größer als 5cm ist oder zwischen 3 und 5cm groß ist, nach Ablation oder Resektion länger überleben als nach Chemoembolisation. Das Ziel aller Verfahren ist immer, dass die Patienten durch eine effektive Therapie auf das Stadium A „herunterbehandelt“ werden („Downstaging“). Dann kann man prinzipiell überlegen, ob die Patienten doch noch einer Lebertransplantation unterzogen werden sollen.<br /> Beim fortgeschrittenen Stadium (Stadium C) gibt es bereits eine Makrogefäßinvasion der Pfortader und eventuell auch Absiedelungen außerhalb der Leber. Hier war bisher die einzige zugelassene Behandlungsmethode eine Therapie mit dem Multikinaseinhibitor Sorafenib. Das Problem bei dieser Behandlungsmethode ist die relativ hohe Toxizität, weshalb viele Patienten die Behandlung abbrechen. In einer randomisierten Studie, in der ein interventionelles radiologisches Verfahren mit Sorafenib verglichen wurde, brachen 64 % aller Patienten die Sorafenib-Behandlung aufgrund von Toxizitäten ab. Die selektive interne Radiotherapie (SIRT) hat im Vergleich zu Sorafenib die gleiche Wirksamkeit hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens und Gesamtüberlebens gezeigt. Die Nebenwirkungen waren bei dieser Behandlungsmethode allerdings deutlich geringer. Deshalb ist bei Patienten in diesem Stadium zu überlegen, ob sie mit Sorafenib oder SIRT behandelt werden. Beide Behandlungsverfahren sind relativ teuer.<br /> Bei Patienten mit einem HCC im terminalen Stadium (Stadium D) ist die Leberfunktion bereits sehr schlecht. Die Patienten haben ein mittleres Überleben von weniger als 3 Monaten. Hier wird „best supportive care“ empfohlen und keine aufwendige Therapie mehr gemacht.<br /><br /><strong> In Innsbruck wurde vor Kurzem das Lebercentrum Innsbruck (LCI) gegründet. Was können Sie uns darüber berichten?<br /><br /> W. Jaschke:</strong> Die Behandlung von Lebererkrankungen erfordert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, die in den Innsbrucker Universitätskliniken zuvor bereits in Tumorboards erfolgt ist. Wir haben allerdings die hohe Expertise in der Behandlung von Lebererkrankungen gebündelt und das Lebercentrum Innsbruck gegründet. Ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal ist, dass im LCI alle vorher genannten Methoden in einem Zentrum angewandt werden.<br /> Besonders zu erwähnen ist, dass wir die Ablationsverfahren hinsichtlich ihrer Wirksamkeit optimiert haben. Bei den Ablationsverfahren ist die gängigste Methode die Radiofrequenzablation. Über eine dünne Nadel, die perkutan eingebracht wird, wird im Gewebe durch Radiowellen Hitze erzeugt. Das Problem dabei ist, dass durch diese Nadel eine zylinderförmige Ablationszone erzeugt wird. Bei größeren Tumoren müssen deshalb mehrere Nadeln benutzt werden oder die Nadel muss umpositioniert werden. Das große technische Problem dabei ist, dass Lücken zwischen den Ablationszonen auftreten, durch die Rezidive entstehen. In Innsbruck wurde das Verfahren optimiert, indem die Nadeln CT-gesteuert stereotaktisch eingebracht werden. Durch diese hochpräzise Positionierung kann genau geplant werden, wo die Nadeln positioniert werden, damit keine Ablationslücken entstehen.<br /> Wir benutzen noch weitere bildgebende Tricks. So haben wir auch die Möglichkeit, den Tumor vor der Ablation und das Ablationsareal nach dem Verfahren zu fusionieren. Dadurch kann man genau erkennen, ob das Ablationsareal das gesamte Tumorvolumen abdeckt. Das gibt dem Operateur zusätzliche Sicherheit, dass das gesamte Tumorvolumen durch Hitze abgetötet wurde.<br /><br /><strong> Vielen Dank für das Gespräch!</strong></p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


