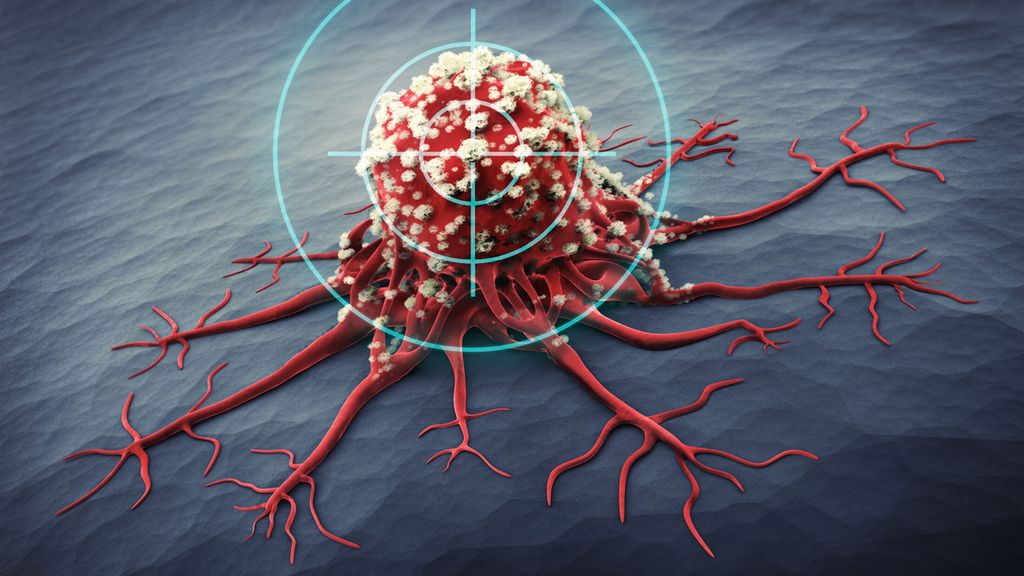
©
Getty Images/iStockphoto
Immuntherapie: Resistenzen gegenüber Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren
Jatros
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Michael Micksche
Ehem. Leiter des Instituts für Krebsforschung, MedUni Wien<br> E-Mail: michael.micksche@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
12.07.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren hat bei Patienten mit bereits fortgeschrittenen Krebserkrankungen wie Melanom, Blasen-, Nieren-, HNO- und auch mit nicht kleinzelligem Lungenkarzinom zu spektakulären und auch lang anhaltenden Tumorrückbildungen geführt. Etwa 20–40 % dieser Patienten können als Responder eingestuft werden. Tatsache ist, dass viele Patienten primär kein Ansprechen zeigen („innate resistance“) oder nach initialen Tumorrückbildungen unter der Therapie eine Progression („adaptive resistance“) entwickeln.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die zellulären und molekularen Mechanismen, die zu diesen primären bzw. erworbenen Resistenzen führen, sind das Ziel aktueller Forschungen. Auf Basis dieser Kenntnisse werden Therapiekombinationen in klinischen Studien evaluiert, um die Ergebnisse der Immuntherapie verbessern zu können.<br /> Die Immunantwort gegenüber Krebszellen und ebenso die Resistenzen sind dynamische Prozesse, die bei jedem Patienten individuell – in Abhängigkeit von der eigenen Situation, von environmentalen und auch genetischen Faktoren – entstehen können. Sicherlich spielen Interventionen wie Chirurgie, Chemo-, Strahlen- und auch Immuntherapie eine wesentliche Rolle bei der Tumor-Host-Bilanz. Viele Faktoren können diese Immunantwort gegen den eigenen Tumor beeinflussen und sich als Resistenz manifestieren.<br /> Immunoediting – der Begriff für die Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Tumor – ist gekennzeichnet durch drei Phasen: 1) Erkennungsphase – Eliminierung, 2) Equilibrium/ Gleichgewicht und 3) Escape. Damit eine antitumorale Immunreaktion stattfinden kann, ist eine gewisse Reaktionsabfolge notwendig. Ein wichtiger erster Schritt sind die Antigenpräsentation und Erkennung, die von der Generierung und Rekrutierung von reaktiven T-Zellen gefolgt wird. Zytotoxische Lymphozyten, die dann in das Mikroenvironment des Tumors eindringen, haben die wichtige Aufgabe der Elimination („killing“) von Krebszellen; schließlich ist die Bildung von Memory-Zellen von wesentlicher Bedeutung für die Erhaltung dieser Immunantwort.<br /> Seit Langem sind die sogenannten Escape-Phänomene von Krebszellen, die ihr Entkommen aus der immunologischen Überwachung und damit Tumorprogression ermöglichen, bekannt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass genau diese Mechanismen auch bei den Resistenzen zum Tragen kommen.<br /> Die ungenügende Generierung und die nicht ausreichende Funktion von Effektor-T-Zellen sind die wichtigen Säulen dieser Resistenzen. Mögliche Mechanismen, die zur primären und/oder auch zur erworbenen Resistenz gegenüber der Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren führen können, sind: ein Fehlen von Erkennungsmerkmalen (keine oder ungenügende Antigenexpression [keine Neoantigene oder geringer Mutationslevel, Verlust von MHC-Molekülen], keine oder ungenügende Antigenaufbereitung und -präsentation); geringe Infiltration mit Effektorzellen; eine Sekretion von metabolischen und inflammatorischen Molekülen wie z.B. Indolamin-2,3-Dioxygenase (IDO); fehlende Cytokin/ Chemokin-Signale (IFN?); die Generierung von Suppressorzellen (T-regs etc.) sowie die Expression von PD-1 und PD-L1 bzw. von alternativen Checkpoint-Molekülen an Tumor bzw. Abwehrzellen. Dies sind nur Beispiele der wesentlichen Mechanismen, die aber zeigen, wie komplex die Interaktion und auch das Nichtreagieren von Immunzellen mit Krebszellen sein können.<br /> Es gibt zahlreiche Hinweise, dass das Tumor-Microenvironment, dessen immunsuppressive Komponente mit Fortschreiten des Tumors ebenfalls zunimmt, an diesen Resistenzen wesentlich beteiligt ist. Eine interessante Beobachtung dazu ist, dass Tumorinfiltrierende Lymphozyten (TIL) in die Apoptose getrieben werden und so durch ihr „Fehlen“ Resistenzen entstehen.<br /> Die beteiligten Mechanismen sind Fas/Fas-Ligand-mediiert und werden durch polymorphkernige „myeloid-derived“ Suppressorzellen (PMN-MDSC), welche hohe Level vom Fas-Liganden exprimieren, besonders getriggert. Eine Blockade des Fas- Liganden steigert in einem Tiermodell die Effektivität der Checkpoint- Blockade und hebt Resistenzen auf. Die Bedeutung von prädiktiven Biomarkern für ein Ansprechen auf Immuntherapie ist ein weiterer wesentlicher Ansatzpunkt für eine bessere Patientenselektion.<br /> Ein wichtiger Weg, um die primären und erworbenen Resistenzen zu umgehen, scheint in den Kombinationstherapien zu liegen. In klinischen Studien sollen Kombinationen von Checkpointblockierenden Maßnahmen mit immunstimulierenden Agenzien (Anti-OX40,-CD40), metabolischen Modulatoren (IDO-Hemmer), anderen Immunmodulatoren (TGF-ß-, CXCR4-Inhibitoren), Makrophageninhibitoren, onkolytischen Viren, Krebsimpfstoffen, adoptiver Zelltherapie und im Besonderen auch mit zielgerichteten Therapien und Strahlentherapien untersucht werden.<br /> Diese Auflistung zeigt nicht nur die Vielzahl und Vielfalt der Möglichkeiten für Kombinationstherapien, sondern auch die Komplexität und Problematik der klinischen Situation im Umgang mit immunologischen Resistenzen und deren Überwindung bei Krebs. Können die vielen offenen Fragen, die bereits am Anfang bei der Planung dieser Studien bestehen – wie Rationale für die Kombination, Dosis, Sequenz, Dauer und (Immun-)Monitoring der Therapien – bereits jetzt auf Basis der vorhandenen Kenntnisse über die Mechanismen der primären und erworbenen Resistenzen beantwortet werden? Die Antwort ist wohl Nein! Dies bedeutet, dass weitere Studien zu den grundlegenden Mechanismen der Resistenzentstehung und -überwindung erforderlich sind.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


