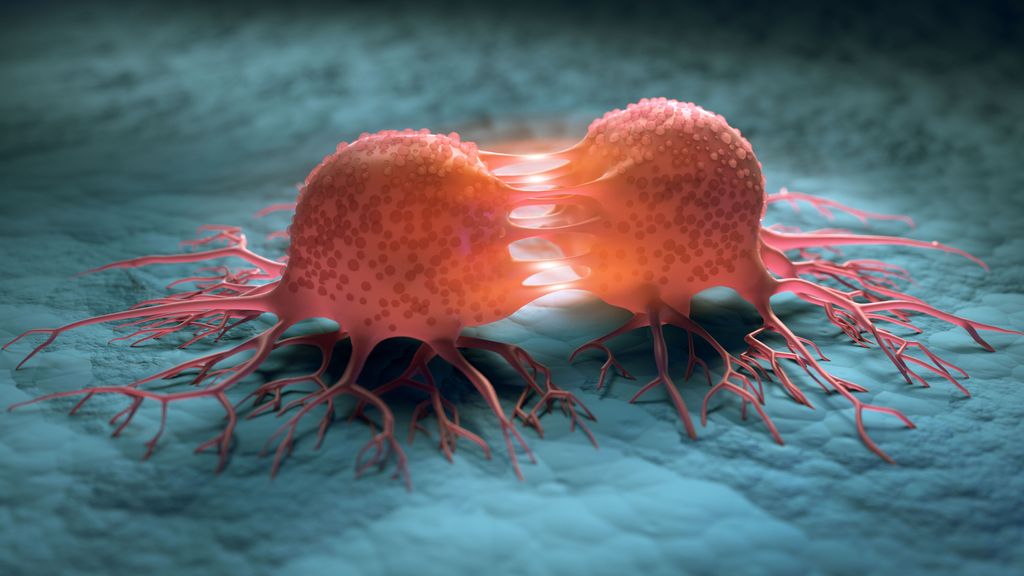
©
Getty Images/iStockphoto
Gezielte, epigenetische und immunologische Therapiestrategien kritisch beleuchtet
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
26.12.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie bot auch 2017 wieder die Gelegenheit zu einer Diskussion der Versorgungslage in den drei Ländern, einer kritischen Wertung aktueller Studienergebnisse und zur Vorschau auf mögliche zukünftige Therapiestrategien in der Hämatoonkologie. Hier eine Auswahl.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Für das nächste Jahr wird die Zulassung des ersten Produkts von mit einem chimären Antikörperrezeptor modifizierten T-Zellen erwartet. In den USA, wo das CTL019-Produkt von Novartis unter dem Namen Kymriah<sup>®</sup> (generisch: Tisagenlecleucel) bereits für die Therapie der rezidivierten oder refraktären akuten lymphatischen B-Zell-Leukämie zugelassen ist, kostet die einmalige Therapie umgerechnet etwa 400 000 Euro, so Dr. med. Michael Hudecek vom Universitätsklinikum Würzburg.<sup>1</sup> Das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in den USA diskutiert derzeit verschiedene Bezahlmodelle für Therapien, die humane Zellen ersetzen oder verändern.<sup>2</sup> Neben einer pauschalen Bezahlung pro Fall kommen auch erfolgsabhängige Modelle in Betracht, beispielsweise eine monatliche Zahlung bis zum Tod oder eine Zahlung nur bei Erreichen einer Remission. Damit würde das Risiko der Behandlung wie der Kosten nicht alleine bei Patient und Kostenträgern bleiben, sondern vom Hersteller mitgetragen werden.<br /> Nicht nur CAR-T-Zell-Produkte sind enorm kostspielig. Prof. Dr. med. Andreas Petzer, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie, wies in Stuttgart auf die enormen Herausforderungen hin, die sich aus den immer höheren Preisen für neue Arzneimittel ergeben. Er warnte, dass sich Mediziner nicht von der Politik in die Rolle drängen lassen dürfen, zu entscheiden, wer ein Medikament bekommt und wer nicht. Sehr wohl sollten sich aber die Fachgesellschaften vermehrt in die sachliche Diskussion um eine Kosten-Nutzen-Bewertung einbringen.</p> <h2>Imatinib bei CML noch nicht passé</h2> <p>Auch wenn sich Zweit- und Drittgenerations- Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) zur Therapie der chronischen myeloischen Leukämie (CML) durch eine raschere tiefe molekulare Remission (MR) als das inzwischen generisch erhältliche Imatinib auszeichnen, muss nicht jeder Patient mit den etwa zehn Mal teureren neueren Originalpräparaten behandelt werden. In der TIDEL-II-Studie wurde beispielsweise ein stufenweises Vorgehen ausgehend von Imatinib (400mg) nach der Tiefe des Ansprechens zu bestimmten Zeitpunkten vorgeschlagen.<sup>3</sup> Erst bei ungenügendem Ansprechen auf eine höhere Dosis von Imatinib (800mg) oder bei Unverträglichkeit wurde auf Nilotinib umgestellt. Insgesamt erreichten mit dieser Strategie 59 % der Patienten nach 60 Monaten eine MR<sup>4,5</sup> – laut Prof. Dr. med. Susanne Saussele, Mannheim, ein durchaus mit Absetzstudien mit den Zweitgenerations-TKI vergleichbares Ergebnis. Prof. Dr. med. Stefan Krause, Erlangen, schlug vor, nach Therapiezielen stratifiziert vorzugehen. Beim Therapieziel therapiefreie Remission (TFR) – beispielsweise bei jüngeren, ansonsten gesunden Patienten – sprechen die Studiendaten eher für Nilotinib und Dasatinib. Bei älteren Patienten mit zahlreichen Komorbiditäten bezeichnete er es aber als angemessen, die Therapie mit Imatinib zu beginnen und primär eine stabil kontrollierte Erkrankung anzustreben.</p> <h2>Absetzkriterien unter Routinebedingungen oft erreicht</h2> <p>Eine retrospektive Analyse von Daten von 151 Patienten mit CML aus der Region Mecklenburg-Vorpommern untersuchte die Häufigkeit des tiefen Ansprechens bei TKITherapie einer CML im klinischen Alltag.<sup>4</sup> Patienten mit TKI-Erstlinientherapie (84 % Imatinib) erreichten nach median 22,3 Monaten zu 81 % eine MR<sup>4,0</sup>, nach median 34,3 Monaten zu 64 % eine MR<sup>5,0</sup>. Das ist besser als von den Autoren erwartet, wahrscheinlich wegen eines Selektionsbias in den verwendeten Daten des Greifswalder Labors. Nichtsdestotrotz zeigen die Ergebnisse, dass viele Patienten mit CML auch im Alltag und mit Imatinib ein tiefes Ansprechen als Bedingung für einen Absetzversuch erreichen.</p> <h2>Methadon sorgt für Diskussionsstoff</h2> <p>Vonseiten der Patienten ist der Druck derzeit gross, Methadon zur Unterstützung der Krebstherapie einzusetzen. Ursache der hohen Erwartungen an eine mögliche Verstärkung des Chemotherapie-Effekts ist eine entsprechende Berichterstattung in Publikumsmedien. Allerdings fehlt noch eine entsprechende klinische Evidenz. Dr. med. Claudia Friesen vom Universitätsklinikum Ulm berichtete über In-vitro-Untersuchungen, die die Wirkverstärkung des antitumoralen Effektes bei gleichzeitiger Gabe von Methadon und Chemotherapie belegen. Einzelfallberichte zeigen auch bei Patienten eine Wirksamkeit solch einer Kombination. Klinische Studien sind allerdings erst in Planung. Entsprechend warnte Priv.-Doz. Dr. med. Ulrich Schuler vom Universitätsklinikum Dresden, eine zuverlässige Interpretation der Befunde sei bislang aufgrund der geringen Fallzahlen und einer fehlenden Objektivierung durch externe Kontrollen nicht möglich. Zudem gebe es auch belastende und gefährliche Nebenwirkungen. Die Übertragung von Invitro- Effekten auf die Situation im Menschen sei aufgrund fehlender Daten aus randomisierten klinischen Studien wissenschaftlich und ethisch nicht zulässig.</p> <h2>Alltagserfahrungen mit Ruxolitinib bei PV</h2> <p>Gute Erfahrungen mit der Therapie der Polycythaemia vera (PV) mit hohem Risiko mit Ruxolitinib berichten Wissenschaftler aus Minden.<sup>5</sup> In einer Kohorte mit 25 Patienten fanden sie eine gute Kontrolle von Mikrozirkulationsstörungen und thromboembolischen Komplikationen bei der Therapie mit dem Januskinase(JAK)-Inhibitor. 24 der 25 Patienten hatten zuvor im Median über 2,6 Jahre eine zytoreduktive Therapie mit Hydroxyurea (HU) erhalten, die mediane Dauer der Therapie mit Ruxolitinib lag bei 2,0 Jahren. Mikrozirkulationsabhängige Komplikationen waren unter HU häufiger als unter Ruxolitinib (18 vs. 4 Ereignisse), thromboembolische Ereignisse vergleichbar häufig. Unter HU waren mehrere sekundäre Malignome aufgetreten (Plattenepithelkarzinome, Brustkrebs, Nierenkrebs), unter Ruxolitinib ein Basalzellkarzinom, allerdings bei vorausgegangener Therapie mit HU. Unter dem JAK-Inhibitor waren Blutungen und Infektionen häufiger, die aber meist mild waren und nicht zu einem Therapieabbruch führten. In Minden nehmen dementsprechend fast alle Patienten bis auf einen weiter Ruxolitinib zur Therapie der PV ein.</p> <h2>FLT3-gerichtete CAR-T-Zellen bei AML</h2> <p>Das Transmembranprotein FLT3, das bei AML häufig mutiert ist, stellt eine gute Zielstruktur für immunologische Therapieansätze dar, erläuterte Dr. med. Michael Hudecek ein denkbares zukünftiges Therapieprinzip.<sup>1</sup> In vitro und in vivo waren FLT3-gerichtete CAR-T-Zellen zytotoxisch gegen AML-Zellen aktiv, unabhängig davon, ob das FLT3-Gen eine interne Tandemduplikation (FLT3-ITD) oder eine Mutation in der Tyrosinkinasedomäne (FLT3-TKD) aufwies. Zudem scheinen FLT3-gerichtete CAR-T-Zellen eine synergistische Wirkung mit FLT3-Inhibitoren zu entfalten. In vitro führte die Gabe des FLT3-Inhibitors Crenolanib zu einer verstärkten Präsentation von FLT3 an der Zelloberfläche und damit zu einer besseren Erkennung durch die FLT3-CAR-TZellen, die die AML-Zellen vollständig eliminierten. Weil FLT3 auch auf normalen hämatopoetischen Stammzellen und Progenitorzellen vorkommt, muss das therapeutische Fenster allerdings gut definiert werden, betonte Hudecek. Er schlägt den Einsatz autologer FLT3-CAR-T-Zellen bei AML vor der Transplantation vor, um eine MRD-Negativität zu erreichen. Nach Depletion der CAR-T-Zellen würde dann die allogene Stammzelltransplantation folgen.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und
Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische
Onkologie, 29. September bis 3. Oktober 2017,
Stuttgart
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Hudecek M et al.: (Critical) review: CAR-T cells. Oncol Res Treat 2017; 40(Suppl 3): 216. DGHO 2017; Abstr. V741 <strong>2</strong> Hettle R et al.: The assessment and appraisal of regenerative medicines and cell therapy products: an exploration of methods for review, economic evaluation and appraisal. Health Technol Assess 2017; 21(7): 1-204 <strong>3</strong> Yeung DT et al.: Upfront imatinib with selective early switching to nilotinib leads to excellent achievement of deep molecular response in chronic phase CML: 5 year (final) analysis of the TIDEL-II study. Blood 2016; 128(22); ASH 2016; Abstr. 939 <strong>4</strong> Wilfert H et al.: Retrospective analysis of BCRABL1- monitoring among CML patients in Mecklenburg- West Pommerania. Oncol Res Treat 2017; 40(Suppl 3): 148; DGHO 2017; Abstr. P543 <strong>5</strong> Sadjadian S et al.: Safety and efficacy of long-term ruxolitinib treatment in 25 high-risk polycythemia vera patients. Oncol Res Treat 2017; 40(Suppl 3): 149; DGHO 2017; Abstr. P546</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


