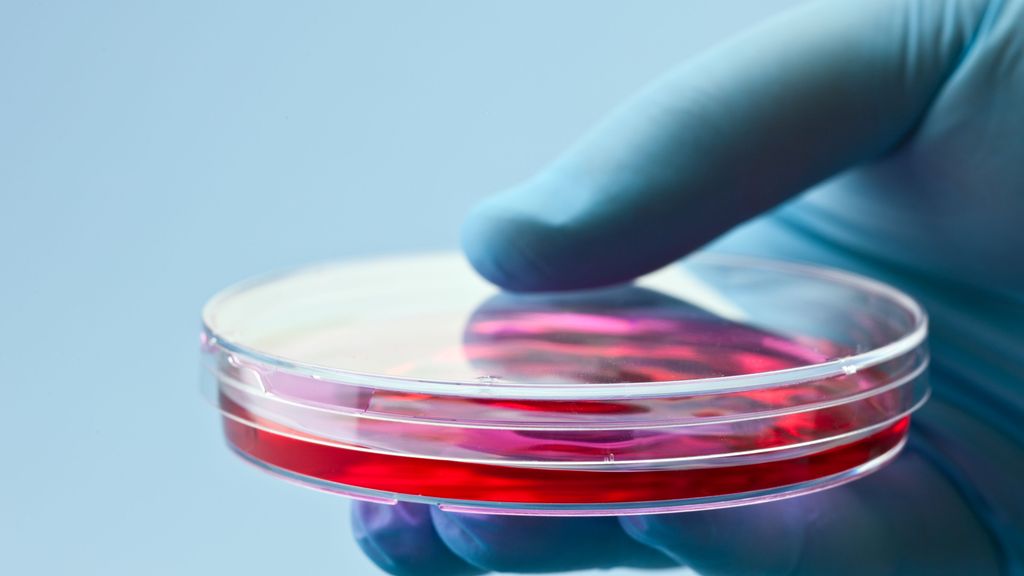
©
Getty Images/iStockphoto
Fokus auf Immuntherapien
Jatros
30
Min. Lesezeit
28.02.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der ASH-Kongress 2018 stand stark im Zeichen von Therapien für die chronische lymphatische Leukämie und für B-Zell-Lymphome. Dazu wurden zahlreiche Studien präsentiert. Univ.-Prof. Richard Greil, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin III, Landeskrankenhaus Salzburg, fasst seine persönlichen Highlights des Kongresses zusammen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Daten zu malignen hämatologischen Erkrankungen?</strong></p> <p><strong>R. Greil:</strong> Bei der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) geht der Trend zur chemotherapiefreien Behandlung. Ich möchte aber mit einer kleinen Investigator- induzierten Studie zur CLL beginnen, die Patienten mit ganz niedrigem Risiko einschloss: Patienten mit einem mutierten Immunglobulinstatus und ohne TP53-Mutation, was auf etwa 20 Prozent der CLL-Patienten zutrifft. In dieser Population konnte man bisher mit einer FC-R-Therapie (Fludarabin, Cyclophosphamid plus Rituximab) erreichen, dass etwa 60 Prozent der Patienten nach zwölf Jahren krankheitsfrei sind, mit einem Plateau nach zehn Jahren. Das deutet darauf hin, dass sie möglicherweise geheilt sind.<br />Jetzt wurde von einer Gruppe ein Studienprotokoll vorgestellt, das das FC-RRegime modifiziert hat: Fludarabin und Cyclophosphamid bleiben erhalten, aber Rituximab wird durch Obinutuzumab ersetzt und zusätzlich kommt Ibrutinib hinzu. In dieser Konstellation wurde bei 100 Prozent der Patienten eine Response und bei 90 Prozent eine Minimale- Resterkrankungs(MRD)-Negativität festgestellt. Es besteht also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es in einem noch höheren Ausmaß zu einer wirklichen Heilung in dieser Population von CLLPatienten kommen wird, ohne dass sie eine allogene Stammzelltransplantation benötigen. Interessant wird sein, wie lange die Patienten Ibrutinib tatsächlich brauchen. Aktuell wurden Daten in „Blood“ publiziert, die außerdem dafür sprechen, dass etwa ein Viertel der bisher eingesetzten Ibrutinib-Dosis ausreicht, um den B-Zell-Rezeptor voll zu besetzen. Es könnte daher sein, dass in dieser Konstellation kurze Therapiezeiten und sehr viel niedrigere Dosen bei deutlich besserer Verträglichkeit hervorragende Resultate liefern.<br />In der iLLUMINATE-Studie, in der wir ja die meisten Patienten eingebracht haben, wurde die Kombination von Ibrutinib plus Obinutuzumab mit Chlorambucil plus Obinutuzumab verglichen. Chlorambucil/Obinutuzumab wurde nach der Publikation von Goede et al. im „New England Journal of Medicine“ für eine nicht FC-R-taugliche Patientenpopulation mit einem Alter von über 60 Jahren oder mit Komorbiditäten und eingeschränkter Nierenfunktion als Standardtherapie festgelegt.<sup>1</sup> Das iLLUMINATEProtokoll zeigt eine Hazard-Ratio für das progressionsfreie Überleben (PFS) von knapp 0,2 – also eine 80-prozentige Risikoreduktion. Bei Patienten mit einer TP53-Mutation oder -Deletion und/oder einer 11q-Deletion liegt die Hazard-Ratio bei 0,1 – das bedeutet eine 90-prozentige Reduktion. Das transformiert sich in einen signifikanten Unterschied in der Zeit bis zur nächsten Behandlung. In einer präklinischen Sitzung sind sehr interessante Resultate präsentiert worden, die den Unterschied zwischen Rituximab und Obinutuzumab bei Patienten mit CLL beleuchten. In der Vergangenheit hat man gesehen, dass die Bendamustin-Rituximab-Kombination besonders schlecht bei Patienten mit einer NOTCH-Mutation wirkt. Kollegen aus den USA konnten zeigen, dass Rituximab den NOTCH-Signalweg aktiviert, was kontraproduktiv ist und das Überleben der Tumorzellen sichert. Dagegen ist Obinutuzumab inert und bewirkt kein Kalziumsignal und kein Signal „downstream“ des B-Zell-Rezeptors. Es könnte also sein, dass sehr selektive biologische Unterschiede bestehen, die nicht nur an der höheren antigenabhängigen zellulären Zytotoxizität von Obinutuzumab liegen, sondern auf einem anderen Signalweg beruhen.<br />Ebenfalls sehr interessant war die Arbeit einer französischen Studiengruppe, die eine Real-World-Evidenz für das Auftreten von Mutationen gezeigt hat. In der Realität treten bei bis zu 50 Prozent der Patienten unter Ibrutinib- Therapie im Laufe der Jahre Mutationen im B-Zell-Rezeptor auf. Allerdings stellt sich immer die Frage, wie diese Patienten vorselektioniert wurden, ob sie eine First-Line-Therapie mit Ibrutinib erhielten oder schon mehrfach vorbehandelt worden sind.</p> <p><strong>Studienpräsentationen zu CAR-T-Zell- Therapien wurden mit großem Interesse verfolgt. Welche Studien waren in diesem Bereich für Sie am spannendsten?</strong></p> <p><strong>R. Greil:</strong> Zusammenfassend gibt es eine Reihe von Folgeberichten aus bestehenden Protokollen wie dem ZUMA-Trial und anderen Studien mit den verschiedenen CAR-Konstrukten, die sowohl für die akute lymphatische B-Linien-Leukämie (B-ALL) als auch für die diffusen großzelligen B-Zell-Lymphome (DLBCL) verwendet worden sind. Fasst man diese Daten zusammen, bleiben die Resultate nach einem Follow-up von eineinhalb bis zwei Jahren konstant. Anscheinend gibt es also einen Plateaubereich bei etwa 50 Prozent der Patienten, die keinen Progress erleiden. Patienten, die in eine komplette Remission kommen, und das ist nach wie vor die Voraussetzung für einen langfristigen Therapieerfolg, haben offensichtlich relativ lange andauernde Plateauwerte. Diese sind unabhängig vom CAR-Konstrukt. Voraussetzung für einen langfristigen, möglicherweise kurativen Therapieerfolg bei dem DLBCL und der CLL ist das Erreichen einer MRD-Negativität.<br />Eine Reihe sehr interessanter Präsentationen befasste sich mit der Frage, wie diese Effekte verbessert werden können. Immerhin entwickeln etwa 50 Prozent der Patienten keine komplette Remission. Die vorgestellten Daten sprechen dafür, dass diese Patienten eine Resistenz im FAS- oder im TRAIL-Signalweg haben, das heißt in den Zell-Todesrezeptor- Molekülen, über die vor allem CD4- zytotoxische T-Zellen ihre Wirkung entfalten sowie ein Teil der FAS-Ligand-freisetzenden NK- und T-Zellen. Anscheinend sprechen Patienten mit diesen Resistenzen nicht auf die CAR-T-Zell- Therapie an, entwickeln aber unter Umständen eine erhöhte Toxizität.<br />Ein zweiter sehr interessanter Punkt war die Frage, welche CAR-T-Zellen bei der Transfektion der T-Zellen expandieren und für den Erfolg gegenüber den Tumorzellen verantwortlich sind. Es wurde gezeigt, dass zu Beginn sogenannte pauci-klonale, also im T-Zell- Rezeptor auf die Antigene der Tumorzellen ausgerichtete, CD8-Zellen stark expandieren. Wenn der Tumor bekämpft ist, geht die CD8-Population zurück und es kommt zu einer stärkeren Expansion von CD4-Zellen, die das CAR-Konstrukt besitzen. Diese halten aufgrund einer Memoryfunktion plus/minus einer zytotoxischen Funktion den Tumor langfristig unter Kontrolle. Das ist auch wichtig für das Verständnis, welche Zellen man am besten transfizieren sollte und welche in der Beobachtung optimal sind, um eine ausreichende Tumorkontrolle zu erreichen.</p> <p><strong>Welche Fragen in Bezug auf CAR-T-Zell- Therapien sollten in näherer Zukunft geklärt werden?</strong></p> <p><strong>R. Greil:</strong> Es wurden Real-World-Daten von 17 amerikanischen Zentren mit insgesamt über 200 Patienten gezeigt. Interessant daran ist, dass nur knapp 50 Prozent der Patienten die Einschlusskriterien der Studien erfüllt hätten. Es handelte sich also nicht um ein hochselektives Patientenkollektiv, sondern vor allem um viele Patienten über dem 60. Lebensjahr, Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, erhöhten Leberenzymen und anderen eigentlichen Kontraindikationen. In dieser sehr heterogen zusammengesetzten multizentrischen Real- World-Evidenz war die Remissionsrate gleich wie in den Studien: etwa 50 Prozent komplette Remission mit einem gleichen Plateauwert. Das zeigt, dass es eine gewisse Brauchbarkeit und Durchführbarkeit in der Praxis gibt.<br />Offen ist die Frage, ob Patienten, vor allem bei einer B-ALL, die unter einer CAR-T-Zell-Therapie eine komplette Remission erreichen, danach eine allogene Stammzellentransplantation erhalten sollten oder nicht. Und dazu gibt es kein klares Ergebnis, weil ein Teil der Patienten bei den gepoolten Datenanalysen gleich gute Ergebnisse erzielte, egal ob allogen transplantiert wurde oder nicht. Hier stellt sich die Frage, was man tun sollte.</p> <p><strong>Wie sieht die Umsetzung der CAR-TZell- Therapie in Österreich aus?</strong></p> <p><strong>R. Greil:</strong> Wir bereiten gerade intensiv die Logistik vor, die es dafür braucht. In Salzburg rechnen wir damit, am Anfang des ersten Quartals des Jahres damit beginnen zu können. Zuerst wird kein flächendeckender Einsatz möglich sein, da das Therapieverfahren an spezialisierte Zentren gehört – in Österreich gibt es etwa fünf. Dort muss es weiterentwickelt werden, auch mit einem Zugang zu den entsprechenden Studien. Doch nicht nur der logistische Aufwand ist erheblich, auch die derzeitige Preiskonstellation ist schwierig. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Finanzierung im Rahmen der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF). Ich hoffe, dass die Pharmaunternehmen, die CART- Zell-Therapien anbieten, zumindest im ersten Jahr etwas tun müssen, damit das Verfahren zu einem vertretbaren Preis erhältlich ist. Wichtig ist, dass wir in der Zwischenzeit mehr gute Daten gewinnen, die die Bedeutung dieses Verfahrens klären. Dafür waren die am ASH präsentierten Studien mit Sicherheit sehr hilfreich.</p> <p><strong>Haben Sie hier interessante Präsentationen zum Nebenwirkungsmanagement gehört?</strong></p> <p><strong>R. Greil:</strong> Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die Manipulation von T-Zellen schon immer ein gefährlicher Weg war, zum Beispiel die Gabe von sehr hoch dosierten Zytokinen oder von aktivierten T-Zellen. Ich glaube nicht, dass die CAR-T-Zell-Therapie extrem gefährlich ist. Wir kommen aber in eine Situation, wo mehrere immunologische Verfahren miteinander konkurrieren. So greifen beispielsweise die bispezifischen Antikörper mit einem Arm auf die T-Zellen und mit dem anderen auf Lymphomzellen zu. Sie verursachen eine ähnliche Zytokinfreisetzung und neurologische Symptome wie die CAR-T-Zell-Therapie. In Wirklichkeit ist das alles nur Ausdruck der aktivierten T-Zellen. Wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, was die Neurotoxizität verursacht und reguliert.<br />Die Immuntherapie durchläuft im Moment eine unglaubliche Entwicklung, aber es braucht auf der klinischen Seite Maß und Ziel, denn wir müssen erreichen, dass wir die Therapien nicht nur sicher, sondern auch finanzierbar implementieren.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Goede V et al.: N Engl J Med 2014; 370: 1101-10</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


