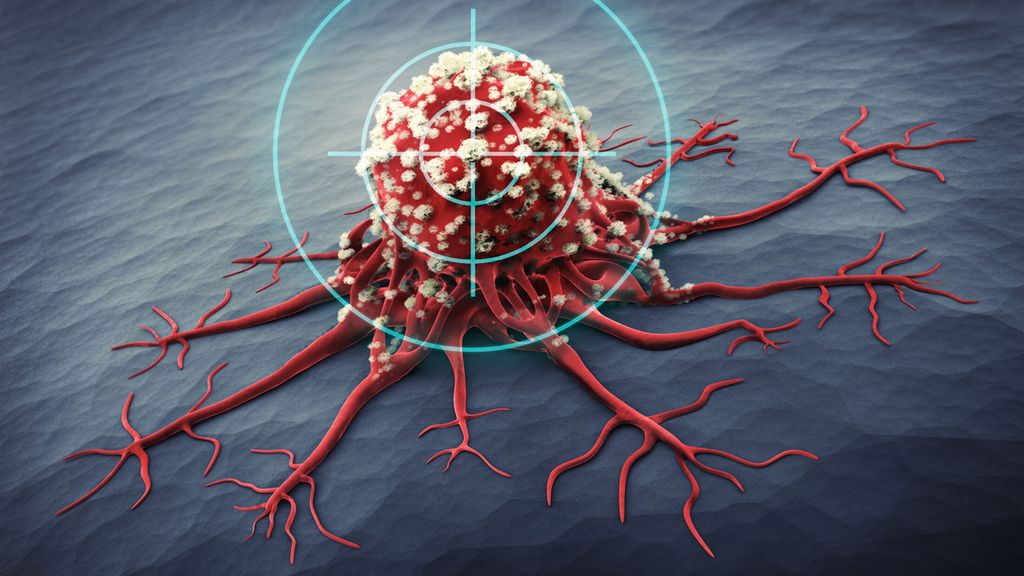<p class="article-intro">Bei rund einem Drittel der Brustkrebspatientinnen wird eine genetische Veränderung als (mit-)verursachend angesehen. Aber nur in etwa 30 % dieser Fälle kann bislang die entsprechende Genmutation identifiziert werden. Für die restlichen Erkrankungen in belasteten Familien sind die genetischen Faktoren bisher noch unentdeckt („missing heritability“). Für die neu zu entdeckenden Risikogene müssen Daten im Rahmen von prospektiven Studien erst gewonnen werden. Sie können dann von Betroffenen und deren betreuenden Ärzten als Grundlage im präferenzsensitiven Entscheidungsprozess für bzw. gegen die Inanspruchnahme risikoadaptierter präventiver Maßnahmen genutzt werden.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Bislang ist erst 1/3 dieser Risikogene identifiziert, rund 30 % aller Brust- und Eierstockkrebserkrankungen sind durch Risikogene (mit-)verursacht.</li> <li>Mittels Hochdurchsatzanalysen in großen Kollektiven im Rahmen internationaler Studien werden gegenwärtig neue Risikogene identifiziert.</li> <li>Moderne molekulargenetische Analyseverfahren („Paneldiagnostik“) ermöglichen die Untersuchung einer Vielzahl dieser Risikogene für erblichen Brust- und Eierstockkrebs.</li> <li>In <em>BRCA1/2</em>-negativen Risikofamilien wird eine Kombination von moderat bis niedrig penetranten Genen als (Mit-)Verursacher des erblichen Brust- und Eierstockkrebses vermutet.</li> <li>Während für die hochpenetranten Risikogene <em>BRCA1</em> und <em>BRCA2</em> evidenzbasierte Daten für die nicht direktive Beratung und Prävention von Mutationsträgerinnen vorhanden sind (z.B. altersspezifische Inzidenzen), liegen sie für die moderaten Risikogene noch nicht vor.</li> </ul> </div> <h2>Was wir zu genetischen Faktoren beim Mammakarzinom bereits wissen</h2> <p>Rund 30 % aller Mammakarzinompatientinnen zeigen eine familiäre Belastung nach den Einschlusskriterien des Deutschen Konsortiums Familiärer Brust- und Eierstockkrebs.<sup>1, 2</sup> Diese Kriterien wurden anhand empirischer Daten zu familiären Risikokonstellationen definiert, die mit einer mindestens 10 % igen <em>BRCA1/2</em>-Mutationsnachweisrate einhergehen und bei deren Vorliegen eine erbliche Ursache in Betracht gezogen werden sollte. Zur vereinfachten Identifikation von belasteten Familien wurde eine Checkliste entwickelt, die online abrufbar ist.<sup>3</sup> Die bisher identifizierten Risikogene erklären etwa 30 % der Fälle in den belasteten Familien. Dabei zeigen sich die hochpenetranten Gene <em>BRCA1</em> und <em>BRCA2</em> am häufigsten mutiert. Es sind Schlüsselgene in der DNA-Doppelstrangreparatur, die als mutierte Allele über einen monogenen Erbgang an 50 % der Nachkommen vererbt werden. Für die übrigen genetisch bedingten Erkrankungen sind die verursachenden Gene noch nicht identifiziert („missing heritability“) bzw. ausreichend charakterisiert. Für diese Gene wird derzeit angenommen, dass neben den Hochrisikogenen (relatives Risiko >5,0, z.B. <em>BRCA1, BRCA2</em>) eine Vielzahl von selten mutierten moderat penetranten Risikogenen (RR 1,5–5,0, z.B. <em>CHEK2, PALB2</em>) in Kombination mit einer hohen Anzahl häufig mutierter Niedrigrisikovarianten (RR <1,5, z.B. <em>FGFR2</em>) für die erblich bedingten Erkrankungen verantwortlich sind. Mittels NGS(„next generation sequencing“)-Verfahren werden heute neben <em>BRCA1</em> und <em>BRCA2</em> bereits weitere Risikogene für den erblichen Brust- und Eierstockkrebs untersucht (sogenannte „Paneldiagnostik“), die im Rahmen aktueller wissenschaftlicher Projekte derzeit identifiziert werden. Diese zusätzlichen Risikogene liegen deutlich seltener mutiert vor als <em>BRCA1</em> und <em>BRCA2</em>. Je nach Studienkollektiv zeigen in Deutschland 4–8 % der Risikofamilien ursächliche Veränderungen in den weiteren Risikogenen. Das Deutsche Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs hat für die umfassende molekulargenetische Diagnostik das „TruRisk®“-Genpanel etabliert, welches sämtliche Risikogene berücksichtigt und jeweils an den aktuellen Kenntnisstand angepasst wird.</p> <h2>Das genetische Risiko kann als Chance genutzt werden</h2> <p><em>BRCA1</em>- oder <em>BRCA2</em>-Mutationsträgerinnen tragen ein lebenslang erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Mamma- bzw. Ovarialkarzinoms. In aktuellen Studien konnte für <em>BRCA1</em>-Mutationsträgerinnen ein mittleres Erkrankungsrisiko bis zum 70. Lebensjahr von 60 % (95 % CI: 44 % bis 75 % ) für Brustkrebs und 59 % (95 % CI: 43 % bis 76 % ) für Eierstockkrebs gezeigt werden. Die Risiken liegen für <em>BRCA2-</em>Mutationsträgerinnen bei 55 % (95 % CI: 41 % bis 70 % ) für Brustkrebs und 16,5 % (95 % CI: 7,5 % bis 34 % ) für Eierstockkrebs.<sup>4</sup> Diese lebenslangen Erkrankungsrisiken sind darüber hinaus vom jeweiligen Lebensalter abhängig, das heißt für <em>BRCA1</em>- und <em>BRCA2</em>-Mutationsträgerinnen, dass die Erkrankungsrisiken mit zunehmendem Lebensalter abnehmen. Wurde in einer Familie bei der Indexpatientin eine pathogene <em>BRCA1/2</em>-Mutation nachgewiesen, dann ergibt sich für gesunde Angehörige die Möglichkeit einer prädiktiven Testung. Aufgrund des autosomal dominanten Erbganges werden die Mutationen nur mit einer 50 % igen Wahrscheinlichkeit an die Nachkommen weitergegeben, womit gesunde Angehörige vielfach die Chance auf eine Entlastung haben. In diesen Fällen sind weder intensivierte Früherkennungsmaßnahmen notwendig noch prophylaktische Operationen indiziert. Wird die familienspezifische <em>BRCA1/2</em>-Mutation bei der Ratsuchenden nachgewiesen, dann kann dies in einer Familie mit vielen Erkrankten die Chance bedeuten, proaktiv nach nicht direktiven Beratungen einen individuellen Weg zu präventiven Maßnahmen zu gehen. So kann sie beispielsweise an einem risikoadaptierten intensivierten Brustkrebsfrüherkennungsprogramm in einem der 17 spezialisierten Zentren für Familiären Brust- und Eierstockkrebs teilnehmen. Alternativ stehen risikoreduzierende Operationsverfahren, wie die prophylaktische beidseitige Mastektomie (PBM) bzw. die prophylaktische kontralaterale Mastektomie, für unilateral bereits erkrankte Frauen zur Verfügung. Hierbei arbeitet das Konsortium eng mit ausgewiesenen Brustzentren und Krebszentren zusammen. Die kontralaterale prophylaktische Mastektomie kann für einseitig erkrankte <em>BRCA</em>-Mutationsträgerinnen unter bestimmten Bedingungen einen Überlebensvorteil darstellen.<sup>5</sup> Die prophylaktische Entfernung der Eierstöcke und Eileiter (PBSO) ist derzeit noch alternativlos, da keine effizienten Früherkennungsmaßnahmen für das Ovarialkarzinom bestehen. Die PBM senkt das Risiko für ein Mammakarzinom um mehr als 95 % .<sup>6</sup> Die PBSO vermindert das Ovarialkarzinomrisiko bei gesunden <em>BRCA1/2</em>-Mutationsträgerinnen um ca. 97 % . Zusätzlich wird durch die PBSO das Brustkrebsrisiko um 50 % und das Risiko für ein kontralaterales Zweitkarzinom um 30 bis 50 % reduziert.<sup>7</sup> Empfohlen wird die PBSO um das 40. Lebensjahr bzw. nach abgeschlossener Familienplanung. Die Entscheidung für bzw. gegen die Inanspruchnahme einer prophylaktischen Operation sollte auf einer individuellen Risikoeinschätzung basieren. Hierbei ist es wichtig, die Patientin über absolute Erkrankungsrisiken für einen überschaubaren Zeitraum (z.B. die nächsten 5 bis 10 Jahre) aufzuklären. Gemeinsam mit der Ratsuchenden erfolgt eine individuelle Bewertung inklusive eines Angebotes zur zusätzlichen psychosozialen Beratung als weitere Basis für eine langfristig tragfähige Entscheidung der Frau.</p> <h2>Können Präventionsangebote für <em>BRCA1/2-</em>Mutation auf Menschen mit Mutationen in anderen Genen übertragen werden?</h2> <p>Für die „neuen Risikogene“, die aufgrund der sich rasant entwickelnden technischen Möglichkeiten der molekulargenetischen Diagnostik in Kürze in einer Vielzahl identifiziert werden, liegen zuvor erörterte essenzielle Daten noch nicht vor. Die lebenslangen Erkrankungsrisiken sind im Vergleich zu Frauen mit einer<em> BRCA1</em>- oder <em>BRCA2</em>-Mutation niedriger, allerdings gibt es überwiegend keine Angaben zu altersabhängigen Erkrankungsrisiken. Diese sind aber Grundlage für eine lebenslang tragfähige Entscheidung über einen nicht rückgängig zu machenden operativen Eingriff. Entscheidet sich eine gesunde Mutationsträgerin in einem fortgeschrittenen Lebensalter für eine prophylaktische Mastektomie, wenn ihr verbleibendes Lebenszeitrisiko dem Restrisiko nach einer prophylaktischen Brustgewebsentfernung entspricht? Ist die Entscheidung für eine prophylaktische Mastektomie einer gesunden <em>BRCA</em>-Mutationsträgerin Anfang 20 mit einer ca. 1 % igen Erkrankungswahrscheinlichkeit im kommenden Lebensjahr dringlich oder ermöglicht ihr diese statistische Wahrscheinlichkeit auf dem Boden ihres Stammbaumes und der Mutation, die Entscheidung zu vertagen und auf ihre aktuelle Lebenssituation abzustimmen? Vermutlich ist doch eine Intervention zum persönlich ungünstigen Zeitpunkt schädlicher, als keine Intervention vornehmen zu lassen. Die Mitteilung der absoluten Erkrankungsrisiken für den überschaubaren Zeitraum kann ihr Zeit für Beratungen und Abwägung verschaffen. Zu den notwendigen Informationen für einen informierten Entscheidungsprozess gehören auch der Phänotyp (z.B. TNBC), der Erkrankungsverlauf/die Prognose, die Effizienz von Früherkennungsmaßnahmen und das Ansprechen auf eine Therapie (z.B. PARP-Inhibitoren). Als Beispiel sei hier das moderate Risikogen <em>RAD51C</em> genannt. Seine Identifikation gelang im Jahr 2010 im Deutschen Konsortium.<sup>8</sup> Es liegt vermutlich in <1 % der belasteten Familien mutiert vor. Bislang konnten international ca. 80 Familien mit einer Mutation im <em>RAD51C-</em>Gen ausgewertet werden und es ergab sich überwiegend der histologische Phänotyp eines Luminal-A-Mammakarzinoms.<sup>9</sup> In die Entscheidung für oder gegen eine prophylaktische Operation sollte die Information zum erwarteten Phänotyp einfließen. Eine Entscheidung könnte bei einer zu erwartenden Erkrankung an einem Luminal-A-Mammakarzinom, welches der intensivierten Früherkennung gut zugänglich ist und eine gute Prognose meist ohne Einsatz einer Chemotherapie bedeutet, anders ausfallen, als wenn ein TNBC auftreten könnte. <br /> Solange solche Daten nicht vorliegen, können klinische Empfehlungen nur in begrenztem Umfang diskutiert werden, sicher aber nicht einfach vom „Beispiel <em>BRCA1/2</em>“ übertragen werden. Die derzeit 17 spezialisierten Zentren des Deutschen Konsortiums Familiärer Brust- und Eierstockkrebs bieten seit Mitte der 1990er-Jahre etablierte Strukturen für die Beratung und Betreuung von Betroffenen sowie eine Basis für die Erforschung der neuen Risikogene und die Translation dieser Erkenntnisse in risikoadaptierte Versorgungskonzepte.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Meindl A et al: Hereditary breast and ovarian cancer: new genes, new treatments, new concepts. Dtsch Arztebl Int 2011; 108(19): 323-30<br /><strong>2</strong> Kast K et al: Prevalence of BRCA 1/2 germline mutations in 21401 families with breast and ovarian cancer. J Med Genet 2016; 53(7): 465-71<br /><strong>3</strong> <a href="http:/www.konsortium-familiaerer-brustkrebs.de/" target="_blank">http://www.konsortium-familiaerer-brustkrebs.de/</a><br /><strong>4</strong> Mavaddat N et al: Cancer risks for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: results from prospective analysis of EMBRACE. Journal of the National Cancer Institute 2013; 105(11): 812-22<br /><strong>5</strong> Heemskerk-Gerritsen BA et al: Improved overall survival after contralateral risk-reducing mastectomy in BRCA1/2 mutation carriers with a history of unilateral breast cancer: a prospective analysis. Int J Cancer 2015; 136(3): 668-77<br /><strong>6</strong> Meijers-Heijboer H et al: Breast cancer after prophylactic bilateral mastectomy in women with BRCA1 and BRCA2 mutation. N Engl J Med 2001; 345: 159-64<br /><strong>7</strong> Domchek SM et al: Association of risk-reducing surgery in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers with cancer risk and mortality. JAMA 2010; 304: 967-75<br /><strong>8</strong> Meindl A et al: Germline mutations in breast and ovarian cancer pedigrees establish RAD51C as a human cancer susceptibility gene. Nat Genet 2010; 42(5): 410-4<br /><strong>9</strong> Gevensleben H et al: Pathological features of breast and ovarian cancers in RAD51C germline mutation carriers. Virchows Arch 2014; 465(3): 365-9</p>
</div>
</p>