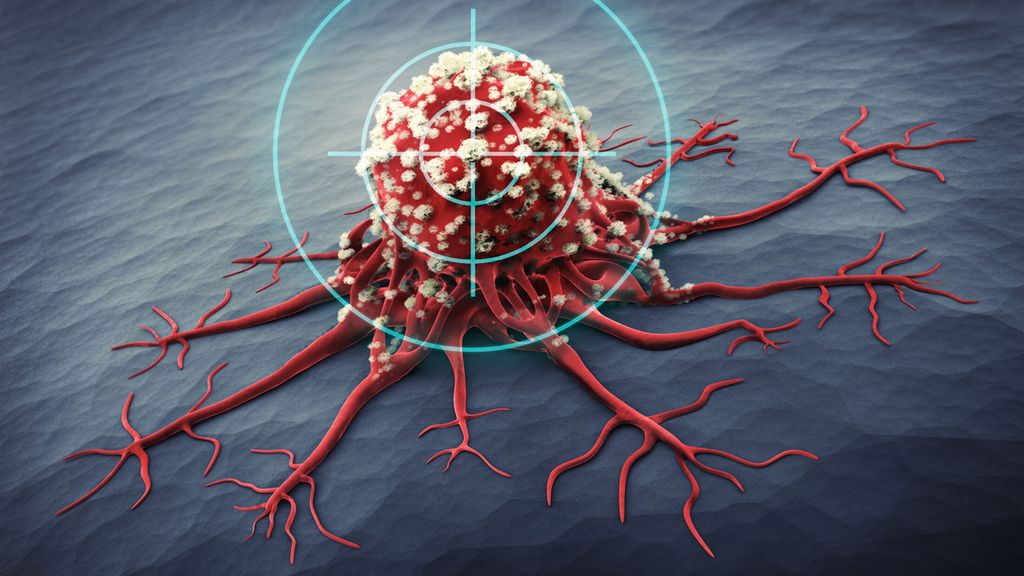
©
Getty Images/iStockphoto
CML, BCR-ABL-negative MPN und MDS im Fokus
Jatros
Autor:
Prim. Univ.-Prof. Dr. Klaus Geissler
Vorstand der 5. Medizinischen<br> Abteilung mit Onkologie<br> Krankenhaus Hietzing der Stadt Wien<br> E-Mail: klaus.geissler@wienkav.at
30
Min. Lesezeit
15.09.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Bei der chronischen myeloischen Leukämie war das Absetzen von TKI nach tiefer molekularer Remission das zentrale Thema auf dem diesjährigen EHA-Kongress. Bei der Polycythaemia vera wurde für Ruxolitinib das Spektrum der potenziellen Kandidaten für diese Therapie auch auf Patienten ohne Splenomegalie erweitert und ein krankheitsmodifizierender Effekt durch den Nachweis einer zunehmenden Verminderung des „JAK2 V617F mutation burden“ unter Ruxolitinib gezeigt. Die immer häufigere Anwendung der NGS-Technologie in sämtlichen Bereichen war deutlich zu erkennen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Chronische myeloische Leukämie</h2> <p>Bei der chronischen myeloischen Leukämie (CML) war das Absetzen von TKI nach tiefer molekularer Remission das zentrale Thema. J. Richter präsentierte in der Presidential Session die Ergebnisse der EURO-SKI-Studie, in welcher bei CML-Patienten, die über mindestens 3 Jahre mit einem TKI behandelt wurden und die für mindestens 1 Jahr eine molekulare Response über 4 Logarithmusstufen (MR<sup>4</sup>) hatten, der TKI abgesetzt wurde (Abb. 1). Insgesamt waren 868 Patienten eingeschlossen worden, 94 % hatten Imatinib erhalten, 4 % Nilotinib und 2 % Dasatinib. Das mediane Alter der Patienten betrug 51,9 Jahre und die mediane Dauer der TKI-Behandlung 91 Monate. Das „molecular relaps-free survival“ betrug nach 6 Monaten 62 % , nach 12 Monaten 56 % und nach 24 Monaten 55 % . In der Educational Session erläuterte S. Saußele jene Voraussetzungen, bei deren Gegebenheit das Absetzen eines TKI erwogen werden kann. Chronische Phase der CML, Transskript Art, Erstlinienbehandlung oder Zweitlinienbehandlung wegen Intoleranz, Dauer der TKI-Einnahme sowie Dauer und Tiefe der molekularen Remission scheinen bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle zu spielen. S. Mustjoki ging in dieser Sitzung dann noch auf die immunologischen Prädiktoren eines erfolgreichen Behandlungsabbruchs ein. Dabei zeigte sich, dass in allen bisherigen Untersuchungen eine erhöhte Anzahl von NK-Zellen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einer bleibenden Remission nach Absetzen des TKI signifikant korrelierte. <br /> Im Rahmen des EHA-Meetings 2016 wurden auch die Ergebnisse der ENESTfreedom- und ENESTop-Studie von G. Saglio und T. Hughes vorgestellt. Bei der ENESTfreedom-Studie wurden Patienten mit einer mindestens zweijährigen Nilotinib-Frontlinetherapie eingeschlossen, die eine MR<sup>4,5</sup> erreicht hatten. Dann erfolgte eine einjährige Nilotinib-Konsolidierung, bevor Nilotinib abgesetzt wurde. Bei der ENESTop-Studie wurden hingegen Patienten eingeschlossen, die eine mindestens dreijährige TKI-Therapie absolviert hatten (davon Imatinib für mindestens 4 Wochen und Nilotinib für mindestens 2 Jahre), ehe sie bei Erreichung von MR<sup>4,5</sup> eine einjährige Konsolidierung mit Nilotinib erhielten. Bei ENESTfreedom betrug nach 48 Monaten die behandlungsfreie Remissionsrate 51,6 % , bei ENESTop 57,9 % . In beiden Studien erreichten fast alle Patienten, die ein molekulares Rezidiv hatten, mit einer Reinitiierung einer Nilotinib-Therapie zumindest wieder eine „major molecular response“ (MMR = MR<sup>3</sup>, 99 % in ENESTfreedom, 98 % in ENESTop). Mit Absetzen des TKI wurden bei manchen Patienten muskuloskelettale Schmerzen beobachtet, deren Genese noch nicht ganz klar ist. <br /> Die Kosten der TKI-Therapien sind aufgrund der steigenden Prävalenz von CML-Patienten ein signifikantes Problem. Aus diesem Grund besteht ein berechtigtes Interesse an der Entwicklung generischer Medikamente, die ein Gegenregulativ für die ständig zunehmenden Kosten in diesem Bereich darstellen. Eine polnische Arbeitsgruppe um T. Sacha bestätigte die Wirksamkeit und Sicherheit eines Imatinib-Generikums durch Daten, die in einem polnischen Imatinib-Generikum-Register bei insgesamt 461 CML-Patienten erhoben wurden, die von Glivec® auf das Imatinib-Generikum umgestellt wurden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Onko_1604_Weblinks_Seite64.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Moderne NGS-Technologien gewinnen an Bedeutung</h2> <p>Moderne NGS-Technologien erlangen eine immer größere Bedeutung bei der Erstellung von Mutationsprofilen bei unterschiedlichen Tumorentitäten zum Diagnosezeitpunkt und auch zur Ermittlung der Dynamik somatischer Mutationen im Verlauf einer Erkrankung. T. Kim präsentierte solche Mutationsanalysen von insgesamt 100 CML-Patienten. Die am häufigsten mutierten Gene waren <em>ASXL1, ABL1</em> und <em>TET2</em>. Bei longitudinalen Untersuchungen zeigten sich sowohl Muster des Gewinnes und der Persistenz als auch Muster des Verlustes von Mutationen. Es zeigte sich, dass die Mutationslast auch bei erfolgreicher TKI-Therapie persistieren kann. Solche Mutationen dürften am ehesten in einem BCR/ABL-negativen Zellklon beherbergt sein. Der Verlust von Mutationen war mit keinem spezifischen klinischen Endpunkt korreliert, während der Zugewinn an Mutationen durchwegs ein fehlendes Ansprechen auf eine TKI-Therapie anzeigte.</p> <h2>BCR-ABL-negative MPN</h2> <p>Bei den BCR-ABL-negativen myelo­proliferativen Neoplasien (MPN) wurde bei der Myelofibrose (MF) mit dem JAK1/2-Inhibitor Ruxolitinib erstmals der „proof on concept“ für die Wirksamkeit einer pathophysiologieorientierten Therapie erbracht. S. Verstovsek zeigte in der klinischen Sitzung die Langzeitergebnisse der Ruxolitinib-Therapie bei Patienten mit MF aus der COMFORT-I-Studie, in der Ruxolitinib vs. Placebo in einem Cross-over-Design verglichen wurde. Die Verminderung des mittleren Milzvolumens, welches bei den Ruxolitinib-Patienten zur Woche 24 31,6 % betrug, erwies sich als dauerhaft und betrug in Woche 264 37,6 % . Auch das OS war mit einer HR von 0,69 gegenüber Placebo signifikant besser. Die klinisch relevantesten Nebenwirkungen der Ruxolitinib-Therapie waren Herpes-zoster-Infektionen und Basalzellkarzinome der Haut. <br /> Ruxolitinib wird derzeit in der Routine bei MF vor allem bei Patienten mit intermediärem Risiko II und denen mit Hochrisiko eingesetzt. Passamonti berichtete über die Sicherheit und Wirksamkeit von Ruxolitinib bei Patienten mit DIPPS „intermediate 1“ im Rahmen einer „phase-IIIb expanded-access study“. Insgesamt 700 Patienten mit „intermediate 1“ MF wurden eingeschlossen. Zu Woche 24 erreichten 62 % der Patienten eine Reduktion des Milzvolumens um mehr als 50 % , in Woche 72 betrug dieser Anteil sogar 78,5 % . Zusätzlich zur Verminderung der Splenomegalie wurde auch eine signifikante Verbesserung der krankheitsassoziierten Symptome festgestellt. <br /> Auch bei der MF scheinen die molekularen Profile neben JAK2, Calreticulin und MPL klinisch relevant zu sein. P. Guglielmelli zeigte, dass die Komplexität der Mutationsprofile eine prognostische Bedeutung haben dürfte. Es bestätigte sich die negative prognostische Bedeutung der Tripelnegativität, die durch eine höhere Anzahl von High-Risk-Mutationen erklärbar sein könnte, vor allem durch das Auftreten von SRSF2-Mutationen. <br /> Die Polycythaemia vera (PV) ist die zweite MPN-Entität, für die Ruxolitinib bereits zugelassen ist. In der RESPONSE-Studie wurde der günstige Effekt von Ruxolitinib bei PV auf Aderlassfrequenz, Milzgröße und krankheitsassoziierte Symptome wie etwa Pruritus gezeigt, ein allfälliger krankheitsmodifizierender Effekt von Ruxolitinib konnte jedoch bisher nicht dokumentiert werden. A. Vanucchi präsentierte eine explorative Analyse aus der RESPONSE-Studie im Hinblick auf die Veränderung des „JAK2 V617F allele burden“ unter Ruxolitinib. Patienten im Ruxolitinib-Arm zeigten einen kontinuierlichen Rückgang des „allele burden“ auf –12,2 % in Woche 32 und auf –40 % in Woche 208, während Patienten im Arm mit „best available therapy“ dieses Phänomen nicht zeigten. Von 107 Patienten im Ruxolitinib-Arm erreichten 7 sogar eine Allelreduktion von mehr als 90 % . Darüber hinaus wurde von F. Passamonti nachgewiesen, dass sich der klinisch günstige Effekt von Ruxolitinib nicht nur auf PV-Patienten mit Splenomegalie beschränkt, sondern auch bei Patienten ohne Splenomegalie nachweisbar ist.<br /> Wie bei MF weisen bei der essenziellen Thrombozythämie etwa die Hälfte der Patienten eine JAK2-V617F-Mutation auf, weswegen die Anwendung des JAK1/2-Inhibitors Ruxolitinib auch in dieser Indikation sinnvoll sein könnte. C. Harrison berichtete über die ersten Ergebnisse der MAJIC-Studie, einer randomisierten Studie, in der Ruxolitinib bei Patienten mit ET untersucht wird. Nach den bisherigen Ergebnissen scheint jedoch Ruxolitinib in dieser Indikation keine klinisch relevanten Vorteile im Hinblick auf hämatologische Remissionen, Thromboserate, Blutungsrate und Transformationsrate zu generieren, lediglich die krankheitsassoziierte Symptomatik dürfte günstig beeinflusst werden.</p> <h2>MPN/MDS</h2> <p>Bei der chronischen myelomonozytären Leukämie (CMML), die der Gruppe MPN/MDS zuzuordnen ist, kommt es häufig zur Transformation in eine akute myeloische Leukämie (AML). Die der Transformation zugrunde liegende molekulare Pathophysiologie ist bisher nur spärlich untersucht. K. Geissler präsentierte eine Studie, in der die klinischen, hämatologischen, biologischen und molekularen Charakteristika von CMML-Patienten, die in eine AML transformierten, aus den Daten der Austrian Biodatabase for CMML (ABCMML) analysiert wurden. Dabei zeigte sich, dass CMML-Patienten, die bereits in eine AML übergegangen waren oder zu einem späteren Zeitpunkt in eine solche übergingen, einen signifikant höheren Anteil an Mutationen in einer der <em>RAS</em>-Pfadkomponenten (<em>NRAS, KRAS</em>, NF1, CBL, PTPN11) aufwiesen als jene Patienten, die nicht transformierten. Zusätzlich zeigte sich bei transformierten Patienten ein signifikant höheres spontanes Wachstum myeloischer Kolonien als bei Patienten ohne Transformation. Diese Daten lassen vermuten, dass dem Transformationsprozess bei CMML in eine AML eine Überaktivierung des <em>RAS</em>-Signalpfades zugrunde liegen dürfte: ein Befund der dafür sprechen würde, <em>RAS</em>-Pfad-Inhibitoren bei dieser schwer zu behandelnden Patientengruppe im Rahmen von klinischen Studien zu überprüfen.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


