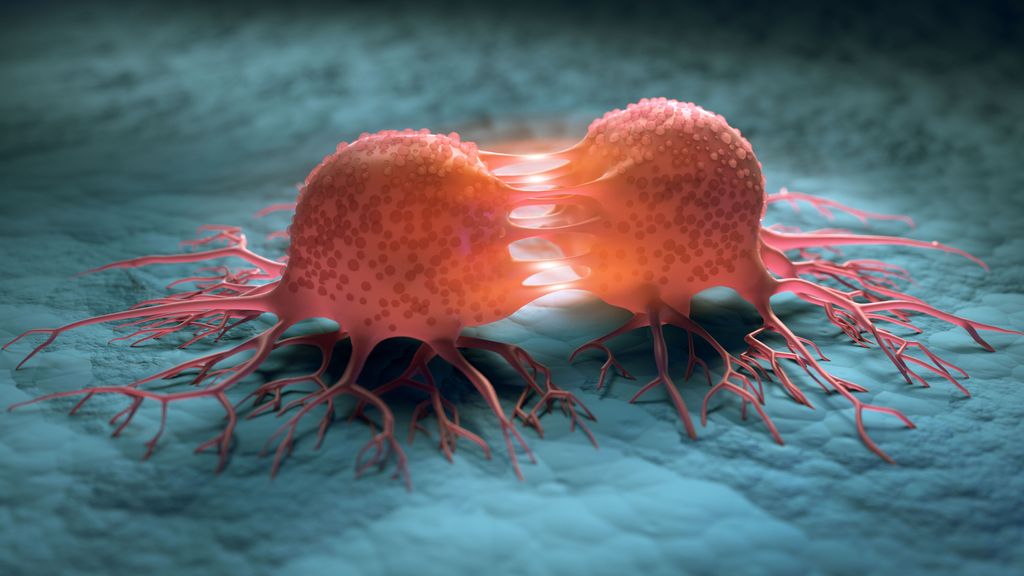
©
Getty Images/iStockphoto
ASCO 2017: Konsolidierungsphase in der Immuntherapie als Monotherapie
Leading Opinions
Autor:
PD Dr. med. Ulf Petrausch
Innere Medizin, FMH<br> Medizinische Onkologie, FMH<br> Allergologie/Immunologie, FMH<br><br> Swiss Tumor Immunology Institute<br> Immun gegen Krebs<br> Zürich<br> E-Mail: ulf.petrausch@swisstii.ch
30
Min. Lesezeit
21.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-content"><p>Im Laufe der letzten Jahre hat sich nun immer mehr das Konzept zweier immunologischer Szenarien etabliert. Prof. Suzanne Topalian vom Johns Hopkins Hospital hat diese beiden Szenarien auf einer Educational Session ausführlich am Beispiel des Lungenkarzinoms erläutert.</p> <h2>Tumoren mit präexistenter, aber blockierter Immunantwort</h2> <p>Ein Szenario ist, dass das Immunsystem maligne Zellen prinzipiell erkennen kann und dann im Verlauf des malignen Wachstums die Immunantwort nach dem Konzept der 3 Es (Elimination, Equilibrium und Evasion, Nature Immunology 2002; 3, 991-998) blockiert wird. Bei diesen Tumoren kann dann die Immunantwort wieder erweckt werden, indem zum Beispiel PD-1/PD-L1 blockierende Antikörper eingesetzt werden. Dieses Konzept würde auch plausibel die Rolle von IFN-a erklären, das für die Expression von PD-L1 auf Tumorzellen mitverantwortlich ist, denn während der initialen Immunantwort wird IFN-a freigesetzt, welches dann die PD-L1-Expression befördert. Ausserdem passt in das Konzept der blockierten Immunantwort die Beobachtung, dass Tumoren mit einer hohen Rate an Mutationen häufiger von einer PD-1/PD-L1-Blockade profitieren. Diese Tumoren exprimieren als Konsequenz Proteine, die vermutlich immunogener wirken und somit eine T-Zell-Antwort ermöglichen. Ein besonderes Beispiel hierfür sind Mikrosatelliten- instabile Tumoren. Diese Tumoren haben eine hohe Mutationslast und profitieren in besonderem Masse von einer PD- 1/PD-L1-Blockade (Abstract 3071).<br /> Kurz vor dem diesjährigen ASCO hat die FDA daraus die Konsequenz gezogen und Pembrolizumab bei metastasierten Mikrosatelliten-instabilen Tumoren aller Entitäten ab der zweiten Therapielinie zugelassen. Prof. Topalian hat deutlich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um die erste Zulassung einer Immuntherapie basierend auf genetischen Veränderungen handelt. Diese Zulassung ist aus meiner Sicht richtungsweisend für die weitere Entwicklung der Immuntherapie, denn genetische Informationen werden auch für die Prädiktion von Immuntherapien immer wichtiger (N Engl J Med 2016; 375: 819-829).</p> <h2>Fehlende Immunantwort im Tumorgewebe</h2> <p>Das andere Szenario, und dieses betrifft die grössere Anzahl von Patienten, ist das Fehlen einer Immunantwort im Tumorgewebe. Hierfür zeigte Prof. Topalian zwei mögliche Situationen auf. Zum einen kann das Tumorgewebe nicht durch die Immunzellen infiltriert werden. Sie illustrierte diese Situation mit einer römischen Kampfreihe einer Legion, die ihre Lanzen als Abwehr nach vorne gegen die Angreifer gerichtet hat. Die von ihr gezeigten immunhistochemischen Präparate wiesen T-Zellen auf, die um den Tumor verteilt waren, aber nicht eindringen konnten, so als ob eine «Abwehrreihe des Tumors» dies verhindern würde. Zum anderen kann eine Immunantwort im Tumor gänzlich fehlen und es können überhaupt keine Immunzellen gefunden werden. Für beide Situationen erscheint eine Monotherapie nicht ausreichend, um eine therapeutische Immunantwort zu induzieren.</p> <h2>Suche nach prädiktiven Biomarkern</h2> <p>Abschliessend zeigte sie das weiterhin bestehende Problem eines Biomarkers, der die einzelnen Szenarien suffizient beschreiben müsste, um dann auch eine Prädiktion erlauben zu können. Auch auf dem diesjährigen Kongress konnte dieser nicht gezeigt werden und weitere Anstrengungen sind nötig. Grundsätzlich wird aber davon ausgegangen, dass hier eher ein Profil aus mehreren Markern erstellt werden muss, um die Wirkung von Immuntherapien vorhersagen zu können.</p> <h2>Kombinationstherapien als Zukunftsmodell</h2> <p>Ungeachtet dieser Probleme wurden verschiedene Studien vorgestellt, die Kombinationen verschiedener Therapien überprüften. Grundsätzlich befinden sich diese Studien im frühen Stadium (Phase I und II) und sind somit noch nicht praxisrelevant. Aber der ASCO-2017-Kongress zeigt deutlich, dass in den nächsten Jahren die Kombinationstherapie an Bedeutung gewinnen wird und nicht nur als Kombination von zwei Medikamenten, sondern auch teilweise von bis zu vier Medikamenten verstanden wird. Die Onkologie wird also neue, komplexe Therapieschemen in Zukunft im Alltag etablieren müssen.<br /> Dass diese frühen Kombinationsstudien wichtig sind, zeigt das Beispiel des metastasierten Nierenzellkarzinoms. Wie schon für Sunitinib wurde nun auch für Pazopanib (Abstract 4506) gezeigt, dass eine Kombination mit einer PD-1-Blockade aufgrund der hepatischen Toxizität nicht möglich ist. Im Gegensatz dazu konnte aber gezeigt werden, dass eine Kombination einer PD-L1-Blockade mit einer VEGFBlockade zu einem hohen Ansprechen und akzeptabler Verträglichkeit führen kann (Abstract 4504: Axitinib plus Avelumab [ORR 67 % ] und Abstract 4505: Bevazizumab plus Atezolizumab [ORR 46 % ]).</p> <h2>Beeinflussung des T-Zell- Metabolismus</h2> <p>Ein weiterer neuer interessanter Ansatz ist die Beeinflussung des T-Zell-Metabolismus. Tryptophan ist eine essenzielle Aminosäure und wichtig für eine funktionelle T-Zell-Antwort. Im Tumor wird Tryptophan durch das Enzym «indoleamine 2,3 dioxygenase» (IDO) zu dem immunsuppressiven Kynurenin abgebaut. IDO-Inhibitoren versuchen, diesen enzymatischen Schritt im Tumorgewebe zu verhindern. So wurde eine Basket-Phase-I/II-Studie mit dem IDO-Inhibitor Epacadostat in Kombination mit Nivolumab vorgestellt (Abstract 3003). Zum einen zeigte sich eine kaum gesteigerte Toxizität im Vergleich zur alleinigen PD-1-Blockade, zum anderen konnte eine ermutigend hohe DCR beim Melanom (88 % ) und bei Kopf-/ Halstumoren (61 % ) gesehen werden.<br /> Auch Arginin ist für die T-Zell-Antwortet wichtig, und es ist bekannt, dass immunsuppressive myeloische Zellen (MDSCs) Arginase produzieren, um Arginin im Tumor zu depletieren. CB-1158, ein Arginase- Inhibitor, wurde in einer Phase-I («First in man»)-Studie getestet. Hierbei zeigte sich in Kombination mit einer PD- 1-Blockade eine gute Verträglichkeit. Über die Wirksamkeit konnte noch nicht berichtet werden, da noch zu wenige Patienten behandelt wurden (Abstract 3005).</p> <h2>Erste Untersuchungen mit agonistischen Antikörpern für kostimulatorische Rezeptoren zeigen gute Verträglichkeit</h2> <p>Darüber hinaus wurde über die Kombination von Nivolumab mit dem agonistischen Antikörper Varlilumab berichtet, der an den kostimulatorischen Rezeptor CD27 bindet. Auch diese Kombination zeigte in einer Phase-I-Studie gute Verträglichkeit (Abstract 3007). Diese erste Beobachtung ist sehr wichtig, da agonistische Antikörper für kostimulatorische Rezeptoren ein hohes Nebenwirkungsrisiko haben können.<br /> Wie von mir im letztjährigen immunologischen Rückblick auf den ASCO 2016 bereits beschrieben, läuft die Entwicklung im Augenblick auf Therapieschemata hinaus, die eine PD-1/PDL-1-Blockade als Basis nutzen. Zu diesen werden nun weitere Medikamente hinzugefügt, um das Tumorgewebe einer Immunantwort zugänglicher zu machen.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


