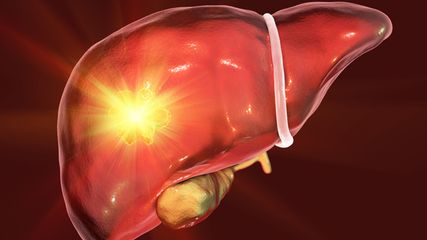<p class="article-intro">Die exokrine Pankreasinsuffizienz ist gekennzeichnet durch die funktionelle Einschränkung der Pankreasenzym- und Bikarbonatsekretion. Unbehandelt führt sie zu Gewichtsverlust und Mangelzuständen. Im Folgenden wird auf Ursachen, Diagnostik und therapeutische Massnahmen eingegangen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Häufiges, oft (noch) subklinisches Vorkommen der exokrinen Pankreasinsuffizienz</li> <li>Variable klinische Symptomatik</li> <li>Therapie: ausreichend hoch dosierte Pankreasenzyme</li> <li>Ernährung: normale ausgewogene Kost</li> <li>Erhöhtes Osteoporoserisiko</li> </ul> </div> <p>Die physiologische Enzymsekretion des Pankreas hängt stark von der Nahrungsaufnahme ab, steigt unmittelbar nach einer Mahlzeit rasch um das Fünf- bis Zehnfache der basalen Sekretion an und fällt dann innerhalb von drei bis vier Stunden langsam wieder ab.<sup>1</sup> Weitere Faktoren, die die exokrine Sekretion beeinflussen, sind die Konsistenz und der Fettgehalt der Nahrung. Die exokrine Sekretionsleistung ist abhängig von der Menge des funktionsfähigen exokrinen Pankreasparenchyms und erst bei einem Verlust von ca. 90 % des Gewebes manifestiert sich eine exokrine Pankreasinsuffizienz durch Fettstühle.<br /> In erster Linie wird eine exokrine Pankreasinsuffizienz bei Erkrankungen des Pankreas und bei Mukoviszidose beobachtet. Zu Ersteren zählt insbesondere die chronische Pankreatitis, bei welcher eine exokrine Insuffizienz mit einer Prävalenz von 30 bis 90 % beobachtet wird und sich meist erst Jahre bis Jahrzehnte nach Beginn der Erkrankung manifestiert.<sup>2</sup> Häufig kann ein genauer Zeitpunkt des Erkrankungsbeginns nicht eruiert werden.<sup>3</sup> Auch nach akuter Pankreatitis kann eine exokrine Insuffizienz auftreten, deren Ausprägung vom Ausmass des Gewebeunterganges abhängt.<sup>4</sup> Bei einem Teil der Fälle ist die Unterscheidung zwischen einer akuten Pankreatitis und dem Schub einer chronischen Pankreatitis klinisch erschwert.<sup>5</sup> Weitere Ursachen sind Tumoren des Pankreas oder ein Diabetes mellitus, bei dem die exokrine Insuffizienz meist nicht substitutionspflichtig ist. Zahlreiche weitere gastroenterologische Erkrankungen wie chronische entzündliche Darmerkrankungen oder die glutensensitive Enteropathie sowie postoperative Zustände nach Resektionen am Pankreas, Magen oder Ösophagus sind in variablem Ausmass mit einer exokrinen Pankreasinsuffizienz assoziiert. <sup>6, 7</sup> Zuletzt konnte mit einer grossen populationsbasierten Studie, der Study of Health in Pomerania (SHIP), ein Zusammenhang zwischen dem intestinalen Mikrobiom und einer exokrinen Insuffizienz belegt werden.<sup>8</sup></p> <h2>Diagnostik</h2> <p>Die klinischen Symptome einer exokrinen Pankreasinsuffizienz sind sehr verschieden und oft nicht spezifisch. Eine milde Form der Insuffizienz kann sich lediglich mit Meteorismus oder abdominellen Schmerzen manifestieren. Klassische Beschwerden sind Fettstühle und Diarrhöen. Diese resultieren daraus, dass die Fettmalabsorption der Kohlenhydrat- und Proteinmalabsorption vorausgeht und sich häufig auch eine beschleunigte Magenentleerung und kürzere Zeit des intestinalen Transits finden. Bei lange bestehender und unbehandelter Insuffizienz können ein Gewichtsverlust und eine Mangelernährung auftreten. Zudem finden sich Mangelzustände fettlöslicher Vitamine, die bis zur Osteopenie oder Osteoporose führen können. Auch die Lebensqualität der Patienten ist stark eingeschränkt.<sup>9</sup><br /> Für die Diagnose einer exokrinen Pankreasinsuffizienz sind neben der Klinik Funktionstests entscheidend, wobei zwischen direkten und indirekten Pankreasfunktionstests unterschieden werden kann. Direkte Pankreasfunktionstests können eine Pankreasinsuffizienz exakter und frühzeitiger detektieren, sind aber technisch deutlich aufwendiger und nicht überall verfügbar. Wesentlich einfacher und weniger zeitaufwendig sind die indirekten Tests. Am weitesten verbreitet ist die Messung der fäkalen Elastase-1, die je nach Ausprägung der exokrinen Insuffizienz eine Sensitivität von 63 bis 100 % und eine Spezifität von 85 % hat. Diese Messung kann auch unter laufender Enzymsubstitution erfolgen, da dieser Test ausschliesslich die humane Elastase misst.<sup>10</sup> Alternative Testverfahren, die in der klinischen Routine seltener angewandt werden, sind die Messung des Chymotrypsins im Stuhl, bei welchem die Enzymsubstitution für mindestens zwei Tage unterbrochen werden muss, die Stuhlfettausscheidung oder spezielle Atemgastests (13C-Triglyzerid-Atemtest).<sup>11</sup></p> <h2>Therapie</h2> <p>Moderne Enzympräparate setzen sich aus fett- (Lipase), kohlenhydrat- (Amylase) und proteinspaltenden Enzymen (Trypsin, Chymotrypsin und weitere Proteasen) zusammen. Die Dosierung orientiert sich an den Lipase-Einheiten und wird in Internationalen Einheiten (I.E.) oder European Pharmacopoeia (Ph. Eur. ) angegeben, wobei Präparate mit verschiedenen Dosisstärken auf dem Markt sind. Sie bestehen aus kleinen Mikropellets oder Minitabletten (maximale Grösse < 2 mm) und sind säurestabil verpackt, um nicht durch den sauren Magensaft denaturiert zu werden.<br /> Die Enzymsubstitution orientiert sich an den klinischen Symptomen. Einen Vorschlag zur Stufentherapie bei Pankreasinsuffizienz gibt Abbildung 1. Zu den Hauptmahlzeiten sollten höhere Dosen als zu Zwischenmahlzeiten eingenommen werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Enzyme unmittelbar vor der Nahrungsaufnahme genommen werden. Bei unzureichendem Therapieansprechen kann eine Dosissteigerung um das Zwei- bis Dreifache versucht werden. Weitere Optionen sind eine Kombination mit Protonenpumpeninhibitoren oder eine Aufteilung der Enzymdosen bei den Mahlzeiten, wobei die Evidenz für Letzteres gering ist, da nur Studien mit geringer Patientenzahl vorliegen. Bei fehlendem Ansprechen müssen andere Differenzialdiagnosen in Erwägung gezogen werden. Dies sind Erkrankungen, die mit einer Zottenatrophie oder einer Dünndarmfehlbesiedelung einhergehen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Innere_1905_Weblinks_lo_innere_1905_s41_abb1_aghdassi.jpg" alt="" width="1004" height="965" /></p> <h2>Gastrektomierte Patienten</h2> <p>Eine Besonderheit stellen Patienten mit partieller oder vollständiger Gastrektomie dar. Aufgrund der fehlenden Säureproduktion sollten die Patienten die Kapseln der Enzympräpate öffnen und das Granulat direkt auf das Essen streuen, um eine optimale Wirkung der Pankreasenzyme zu erzielen. Beachtet werden muss auch, dass bei Patienten nach Resektionen oder Bypass-Operationen im Gastrointestinaltrakt oft trotz normaler Stuhl-Elastase klinisch eine exokrine Pankreasinsuffizienz vorliegt. Hierbei mischen sich die Enzyme nicht mehr mit dem Speisebrei (Chymus) und es liegt eine oftmals substitutionspflichtige pankreocibale Asynchronie vor.</p> <h2>Ernährungstherapie</h2> <p>Da eine Spätkomplikation der exokrinen Insuffizienz eine Mangelernährung oder sogar Sarkopenie sind, ist neben der adäquaten Enzymsubstitution auch eine optimale Ernährungstherapie wichtig. Die Entstehung der Mangelernährung ist vor allem bei chronischer Pankreatitis multikausal, da neben der exokrinen Insuffizienz auch ein ungesunder Lebensstil, Inappetenz durch Schmerzen oder lokale Komplikationen der chronischen Pankreatitis (z. B. Duodenalstenose oder eine den Magen oder das Duodenum komprimierende Pseudozyste) zum Gewichtsverlust beitragen. Deshalb ist eine strukturierte Ernährungsberatung bei Patienten mit exokriner Pankreasinsuffizienz von Bedeutung. Kernelemente sind neben einer ausreichenden Kalorienaufnahme (25–30 kcal/kg Körpergewicht pro Tag) eine ausgewogen bilanzierte Ernährung mit ausreichender Eiweisszufuhr und möglichst keine Fettrestriktion.<sup>12, 13</sup> Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Enzymtherapie.<br /> Die Aufteilung der Nahrung auf mehrere kleine Mahlzeiten und häufige Zwischenmahlzeiten unterstützen die Verdauung bei Pankreasinsuffizienz. Bei fortgeschrittener Pankreasinsuffizienz kann neben der oralen Kost auch hochkalorische Trinknahrung eingesetzt werden. Relativ selten müssen zusätzliche Ernährungsmethoden wie eine Sondenernährung, eine Ernährung über eine perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) oder eine parenterale Ernährung eingesetzt werden.<sup>14</sup> Indikationen hierfür sind eine ausgeprägte Mangelernährung oder eine starke Inappetenz des Patienten. Während die Ernährung über eine naso-gastrale oder -jejunale Sonde nur für einen relativ kurzen Zeitraum angewandt wird, kann über eine PEG langfristig eine ausreichende vollkalorische Ernährung sichergestellt werden. Neben einem Anstieg des Körpergewichts führt eine Sondenernährung vor allem zu einem Rückgang der abdominellen Schmerzen, des Analgetikabedarfs und der Hospitalisierungen.<br /> Die Ernährung sollte auch das erhöhte Osteoporoserisiko bei Patienten mit exokriner Insuffizienz berücksichtigen. Rund 25 % der Patienten mit einer chronischen Pankreatitis leiden unter einer Osteoporose und fast 40 % an einer Osteopenie, wobei die Knochendichte nicht direkt mit der exokrinen Funktion zu korrelieren scheint. Deshalb sind alle Patienten mit einer exokrinen Insuffizienz Risikopatienten und sollten einer Basisdiagnostik inklusive einer Knochendichtemessung unterzogen werden. Eine Hilfe in der Diagnostik gibt die Leitlinie des Dachverbandes für Osteologie (www.dv-osteologie.org). Zur Prophylaxe sollte auf eine ausreichende tägliche Zufuhr von Kalzium (1000 mg) und Vitamin D (800 – 1000 IE) geachtet werden.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Eine exokrine Pankreasinsuffizienz findet sich nicht nur bei chronischer Pankreatitis, sondern auch bei vielen anderen Erkrankungen. Zentraler Bestandteil der Therapie ist eine ausreichende Pankreasenzymsubstitution, die sich an den klinischen Symptomen orientieren soll. Um Komplikationen wie eine Mangelernährung und Osteoporose zu vermeiden, sind eine ausgewogene isokalorische Ernährung und die ausreichende Zufuhr von Kalzium und Vitamin D notwendig.</p> </div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Keller J, Layer P: Gut 2005; 54: vi1-28 (doi:10.1136/gut. 2005.065946) <strong>2</strong> Mayerle J et al.: Dtsch Arztebl Int 2013; 110: 387-93 <strong>3</strong> Johnson CD et al.: Pancreatology 2019; 19: 182-90 <strong>4</strong> Kahl S et al.: JOP 2014; 15: 165-74 <strong>5</strong> Suchsland T et al.: Pancreatology 2015; 15: 265-70 <strong>6</strong> Capurso G et al.: Clin Exp Gastroenterol 2019; 12: 129-39 <strong>7</strong> Seiler CM et al.: Aliment Pharmacol Ther 2013; 37: 691-702 <strong>8</strong> Frost F et al.: Gastroenterology 2019; 156: 1010-5 <strong>9</strong> Johnson CD et al.: Patient 2017; 10: 615-28 <strong>10</strong> Weiss F et al.: PLoS One 2016; 11: e0159363 (doi:10.1371/journal.pone.0159363) <strong>11</strong> Keller J et al.: Best Pract Res Clin Gastroenterol 2009; 23: 425- 39 <strong>12</strong> German Society of Chronic Pancreatitis: Z Gastroenterol 2012; 50: 1176-224 <strong>13</strong> Ockenga J et al.: Aktuel Ernahrungsmed 2014; 39: e43-56 <strong>14</strong> Kruger J et al.: PLoS One 2016; 11: e0166513 (doi:10.1371/journal.pone.0166513)</p>
</div>
</p>