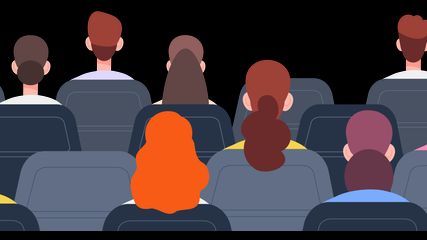Das Kurzdarmsyndrom – aktuelles Therapiemanagement
Autor:
Dr. med. Stefano Fusco
Leitung Schwerpunkt CED und Kurzdarm
Medizinische Klinik 1
Universitätsklinikum Tübingen
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Das Kurzdarmsyndrom ist ein seltenes sowie komplexes, chronisches Krankheitsbild, das in spezialisierten Zentren behandelt wird. Bei der Therapie ist neben der parenteralen Ernährung auf typische Symptome einer Malassimilation zu achten. Viele Patienten können von einer subkutanen Teduglutid-Therapie profitieren.
Keypoints
-
Zur Therapie des KDS zählen eine parenterale Ernährung inkl. Spurenelementen, Vitaminen sowie Vollelektrolytlösungen und ggf. die Teduglutid-Therapie.
-
Mit Antidiarrhoika (Loperamid, Tinctura opii), Antisekretiva (PPI, Somatostatin), der Substitution von Pankreasenzymen sowie Gallensalzbindern und darmselektiven Antibiotika (Rifaximin) lassen sich die meisten Alltagssymptome gut kompensieren.
-
Als chirurgische Optionen stehen die chirurgische Darmrehabilitation oder die Darmtransplantation zur Verfügung.
-
Das Kurzdarmsyndrom bedarf einer interdisziplinären Therapie mit Beteiligung von Hausärzten, Gastroenterologen, Viszeralchirurgen, ambulantem Pflegedienst, Apotheken u.v.m.
Definition des Kurzdarmsyndroms
Beim Kurzdarmsyndrom (KDS) kommt es zu einer Malassimilation durch eine angeborene oder erworbene insuffiziente Dünndarmlänge mit chronischem Mangel an Makro-, Mikronährstoffen und Flüssigkeiten und den daraus resultierenden Mangelzuständen. Das KDS resultiert in der Unfähigkeit des Darmes, Flüssigkeiten und das Gleichgewicht der Nährstoffe durch eine normale orale Ernährung zu erhalten.
Genese des Kurzdarmsyndroms
Das Kurzdarmsyndrom entsteht durch einen Verlust an Darmoberfläche, bedingt durch die chirurgische Resektion von Abschnitten des Magen-Darm-Traktes, meist jedoch des Dünndarms. In der Regel kommt es zum KDS bei einer Restdünndarmlänge von <150cm, je nach Restdickdarmlänge auch erst bei <100cm Restdünndarmlänge. Die häufigsten Ursachen für ein Kurzdarmsyndrom sind Resektionen bedingt durch Darmischämien (Mesenterialarterienembolie, Mesenterialvenenthrombose, schwere Gerinnungsstörungen [Faktor-V-Leiden, Faktor-II-Mutation … ]), Morbus Crohn, Malignome, Strahlenenteritis, Inkarzerationen bei inneren Hernien sowie im Kindesalter der Volvulus und die nekrotisierende Enteritis.
Pathophysiologie des KDS
Das Fehlen bestimmter Darmabschnitte hat Einfluss auf die Absorption verschiedener Nährstoffe bzw. Elektrolyte. So wird Eisen beispielsweise überwiegend duodenal resorbiert, während Gallensalze und Vitamin B12 im terminalen Ileum resorbiert und Aminosäuren duodenal und jejunal aufgenommen werden. Je nach Verlust der entsprechenden Darmabschnitte kommt es zu unterschiedlichen Mangelzuständen. In allen Fällen ist die Resorptionsstrecke zu kurz, um eine ausgeglichene Wasser-Elektrolyt-Homöostase herzustellen.
Klassische Symptome des KDS
Zu den häufigen Symptomen des KDS zählen wässrige bis breiige Diarrhöen mit einer Stuhlfrequenz von 10–30x/Tag. Bei Malassimilation der Gallensalze kommt es zu einer chologenen Diarrhö, die aufgrund einer begleitenden Malresorption von Fetten zu einer Steatorrhö führen kann. Es kann zusätzlich gehäuft zu bakteriellen Fehlbesiedelungen des Restdünndarmes mit daraus resultierendem Völlegefühl und Meteorismus kommen. Die Patienten sind nicht selten anorektisch bzw. sarkopen.
Therapie des KDS
Eine Basistherapie des KDS stellt der parenterale Support dar, der aus der parenteralen Ernährung und der parenteralen Flüssigkeitssubstitution besteht, die meistens über einen Hickman-Katheter, im Einzelfall auch über ein Portsystem, infundiert werden können. Der parenteralen Ernährung sollen Vitamine und Spurenelemente zugesetzt werden. Oral kann noch Vitamin D3 in öliger Lösung supplementiert werden. Die Eisensubstitution sollte parenteral erfolgen. Um einer Sarkopenie vorzubeugen, ist auf eine ausreichende Bewegung, z.B. in Form von Ausdauersport oder Krafttraining, zu achten. Bei Hypersekretion der Magensäure können mittels Protonenpumpeninhibitoren bis zu 500ml Flüssigkeitsverlust pro Tag eingespart werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die orale Nahrungszufuhr von der oralen Flüssigkeitszufuhr strikt getrennt wird, um weitere enterale Flüssigkeitsverluste durch osmotische Wirkungen zu verhindern. Des Weiteren soll die Flüssigkeitszufuhr überwiegend parenteral erfolgen, da die orale Flüssigkeitszufuhr die enterale Resorption von Nährstoffen beeinträchtigt. Die Diarrhöen können bei Gallenverlustsyndrom (bei noch vorhandenem Restkolon) mittels Gallensäurebindern wie Colestyramin oder bei Steatorrhö mittels Pankreatin kuriert werden.
Eine spezifische Therapie der Malassimilation beim KDS kann durch Teduglutid, einem Agonisten des «glucagon-like peptide» 2, erfolgen. Hierbei werden durch tägliche subkutane Injektionen die Krypten- und Zottenhypertrophie bewerkstelligt, die jedoch einer dauerhaften Teduglutid-Therapie bedürfen. Durch die Teduglutid-Therapie lassen sich mehrere Tage pro Woche an parenteraler Ernährung (PE) und Infusionen einsparen, sodass die Patienten auch PE-freie Tage haben. In Einzelfällen gelingt gar der komplette Verzicht auf den parenteralen Support.
Bei Patienten mit Morbus Crohn als Grunderkrankung, die zum KDS geführt hat, ist die dauerhafte pharmakologische Remissionserhaltung dringend geboten, um bei weiteren Entzündungsschüben keinen Verlust weiterer Darmabschnitte oder eine Fistulierung zu riskieren.
Sollte ein Ultra-KDS mit einer Restdarmlänge von <80cm vorliegen, ist über eine chirurgische Rehabilitation oder eine Viszeraltransplantation nachzudenken. Bei der chirurgischen Rehabilitation werden blind endende Anastomosen von Seit-zu-Seit nach End-zu-End reanastomosiert oder es wird eine sogenannte serielle transverse Enteroplastie (STEP) durchgeführt, bei der durch quere Inzisionen an mehreren Stellen des Dünndarmes und Auseinanderziehen des Dünndarmes bei gleicher Darmoberfläche die Strecke bzw. die Transitzeit verlängert wird, was die Resorptionsvorgänge positiv beeinflusst. Als Ultima Ratio kann eine Darmtransplantation ggf. in Kombination mit einer Leber- oder Pankreastransplantation als Multiviszeraltransplantation erwogen werden, was jedoch als Einzelfallentscheidung einem Transplantationszentrum vorbehalten bleibt.
Um einen reibungslosen Ablauf im Alltag der KDS-Patienten zu erzielen, bedarf es der eng verzahnten interdisziplinären Zusammenarbeit der behandelnden Ärzte (Hausärzte, Internisten, Gastroenterologen, Viszeralchirurgen …), des ambulanten Pflegedienstes bzw. der Homecare-Services, der zuliefernden Apotheken und ggf. der Physiotherapeuten sowie weiterer Dienstleister.
Komplikationen beim KDS
Das KDS an sich bringt je nach Ausgleich der Mangelzustände unterschiedliche Komplikationen mit sich. Dazu zählen eine Vitamin-D-assoziierte Osteopenie bis hin zur Osteoporose mit schlimmstenfalls pathologischen Frakturen. Oder eine Fatigue-Symptomatik mit Konzentrationsschwäche, Mattigkeit und Leistungsminderung bei ausgeprägter Eisenmangelanämie. Es kann infolge der bakteriellen Überwucherung auch zu einer D-Laktatazidose kommen, die nicht selten unterdiagnostiziert bleibt.
Bedingt durch die parenterale Ernährung können auch Septikämien über den zentralen Venenzugang sowie Katheterthrombosen oder eine Steatosis hepatis bis hin zur Steatohepatitis (IFALD; «intestinal failure-associated liver disease») entstehen.
Fazit
Die KDS-Patienten haben bei kompetenter Betreuung mit suffizientem Ausgleich der Nährstoffe und der Flüssigkeiten bedingt durch die oben genannten Komplikationen zwar eine herabgesetzte Lebenserwartung. Jedoch können bei Vermeidung von Komplikationen eine nahezu normale Lebensqualität und Lebenserwartung erzielt werden.
Literatur:
beim Verfasser
Das könnte Sie auch interessieren:
Das kardiovaskuläre Risiko von IBD-Patienten
Eine aktive IBD erhöht das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, während bestehende kardiovaskuläre Probleme die Wahl der Medikation erschweren. Das Ziel ist es, die richtige Balance ...
Aktuelle Studien aus Gastroenterologie und Hepatologie
Am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Gastroenterologie (SSG) und der Swiss Association for the Study of the Liver (SASL) vom 11. bis 12. September 2025 in Interlaken ...
Neues aus der Gastroenterologie
Nicht jede Alkoholisierung ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Beim sogenannten Eigenbrauer-Syndrom kommt es infolge pathologischer Auffälligkeiten des Darmmikrobioms zur endogenen ...