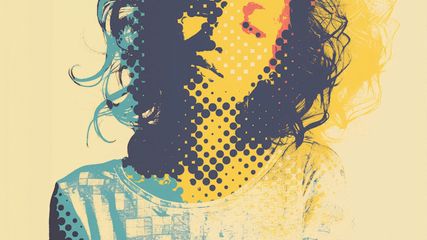«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie
Unser Gesprächspartner:
PD Dr. med. Thorsten Mikoteit
Leitender Arzt Behandlungszentren Angst & Depression und Psychosomatik der Solothurner Spitäler
E-Mail: thorsten.mikoteit@spital.so.ch
Das Interview führte Dipl.-Ing. Dr. techn. Manuel Spalt-Zoidl
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem Interview mit PD Dr. med. Thorsten Mikoteit, Leitender Arzt Behandlungszentren Angst & Depression und Psychosomatik der Solothurner Spitäler, präsentierte der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie aktuelle Herausforderungen und zukunftsträchtige Perspektiven bei der Diagnose und Behandlung dieser belastenden Erkrankung.
Wo stehen wir aktuell bei der Diagnose der Insomnie und welche Hindernisse beeinflussen den klinischen Alltag?
T. Mikoteit: Die Diagnose der Insomnie basiert heute allein auf klinischen Kriterien. Erforderlich ist, dass Patient:innen über mindestens drei Monate hinweg mehrmals wöchentlich über Ein- oder Durchschlafprobleme oder ein frühes Erwachen berichten und dies zu einer spürbaren Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und Befindlichkeit führt. Das bedeutet, dass die Insomnie nicht zwingend objektiviert werden muss.
Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die Insomnie keine eingebildete Störung, sondern ein echtes Leiden ist. Wir haben erkannt, dass es sich dabei nicht um das Problem einer Schlafdeprivation, sondern ganz im Gegenteil um ein sogenanntes «Hyper-Arousal» handelt. Das heisst, man fühlt sich zwar erschöpft und müde, aber man kann nicht einschlafen, wenn man das will. Dies führt zu Fatigue, Abgeschlagenheit und Abnutzungserscheinungen, die auf die Dauer natürlich quälend sind.
Wenn man Patient:innen mit objektiven Methoden, etwa im Schlaflabor, beurteilen möchte, stellt man erstaunlicherweise fest, dass die objektiven Schlafdaten häufig viel besser sind als das subjektive Empfinden. Mit einer Prävalenz von ca. 10% kommt Insomnie etwa so oft vor wie Angststörungen und Depressionen. Es handelt sich somit um eine extrem häufige Störung, die sich mit den gängigen Methoden nicht gut objektivieren lässt.
Gab es in den letzten Jahrzehnten wichtige wissenschaftliche und therapeutische Fortschritte, welche die Diagnostik und Behandlung derInsomnie nachhaltig verändert haben?
T. Mikoteit: Es gibt Forschungen in Richtung besserer Methoden für die Objektivierung der Insomnie und zu Neuromarkern, welche die neurobiologischen Hintergründe erklären. Zum einen werden beispielsweise quantitative High-Density-EEG-Verfahren eingesetzt, um den Schlaf zu untersuchen und auch um zu verstehen, warum Patient:innen manchmal das Gefühl haben, sie wären wach, obwohl sie eigentlich schlafen. Man versucht mit diesen hochauflösenden Schlaf-EEG-Untersuchungen der Hirnaktivität im Schlaf auf regionaler Ebene nachzugehen.
Zum anderen hat es in den letzten Jahren sogenannte Aufwach-Studien gegeben, in denen man die Patient:innen mehrmals in der Nacht aufgeweckt hat und sie gefragt hat, ob sie geschlafen hätten. Häufig lagen Patient:innen hier falsch und man versucht, diese subjektive Falscheinschätzung des Schlaf- und Wachseins besser zu verstehen.
Ausserdem werden weitere Untersuchungen zum «Hyper-Arousal» durchgeführt. Man möchte verstehen, wo es im Gehirn entsteht und wie es sich auf die Hirnfunktionen auswirkt. Unbestritten ist, dass nicht nur die Depression, sondern auch viele andere psychiatrische Störungsbilder mit Insomnie vergesellschaftet sind und sie diesen häufig vorausgeht. Man hat beobachtet, dass es bei der Insomnie zu einem sehr unruhigen REM-Schlaf kommt. Ein guter und gesunder REM-Schlaf ist für die Emotionsregulation jedoch essenziell und diese ist bei vielen psychiatrischen Krankheiten eingeschränkt. Das wiederum wird auf eine unzureichende Regulation des Locus coeruleus zurückgeführt, also jenen Hirnzentrums, welches über Noradrenalin die Aufmerksamkeitsfunktion und die Wachheit reguliert. Diese sollte im REM-Schlaf maximal unterdrückt sein. Bei Insomnie scheint dies nicht der Fall zu sein, wodurch es wahrscheinlich zu diesem «Hyper-Arousal» kommt. So findet zwar ein Schlaf statt, er ist aber nicht erholsam. Aus diesem Ansatz folgt, dass man Menschen nicht mit Schlafmitteln behandeln sollte. Die Arzneimittel machen im schlimmsten Fall abhängig, führen aber nicht zu einem befriedigenden Schlaf. Der Fokus sollte vielmehr auf der Therapie des «Hyper-Arousals» liegen. Hier hat man jetzt unter anderem einen Ansatz gefunden, bei dem man durch Orexin-Rezeptorantagonisten das nächtliche «Hyper-Arousal» reduzieren und Patient:innen zu einem erholsameren Schlaf verhelfen kann.
Was besagen die heutigen Empfehlungen der Schlafgesellschaften für die Behandlung der Insomnie?
T. Mikoteit: Der erste Schritt für die Behandlung der Insomnie ist selbstverständlich, andere Ursachen des Schlafmangels auszuschliessen. Beispiele wären ein Schlafapnoe- oder ein Restless-Legs-Syndrom. Auch Erkrankungen wie eine Herzinsuffizienz, ein chronisches rheumatologisches Schmerzleiden oder andere Ursachen eines störenden Nachtschlafes müssen beurteilt werden. Zur Behandlung der chronischen Insomnie empfehlen die Schlafgesellschaften dann die kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie (KVT-I) als erste Wahl. Das wirksamste Element dieser Therapie ist die Verkürzung der Bettzeit. Patient:innen mit einer Insomnie verbringen tendenziell zu viel Zeit im Bett und haben dadurch weniger Schlafdruck. Das ist so ähnlich, als wenn man zwischendurch immer Süssigkeiten isst und sich dann wundert, wenn man zur Hauptmahlzeit keinen Hunger mehr hat. Dieses Prinzip ist eigentlich relativ einfach, aber die Patient:innen müssen in der Regel dazu angeleitet werden, die Massnahme zu verstehen und genau zu berechnen, wie viel Zeit sie im Bett verbringen dürfen.
Ausserdem gibt es noch andere Elemente der KVT-I. Diese umfassen, die Schlafhygiene besser einzuhalten, tagsüber mehr Sport zu treiben, auf koffeinhaltige Getränke zu verzichten, ein Einschlafritual zu finden, eine Stimulationskontrolle zu implementieren und eine übertriebene schlafbezogene Ängstlichkeit zu reduzieren.
Die KVT-I ist das Mittel der ersten Wahl und eine Alternative zur Einnahme von Schlafmitteln. Im Rahmen der medikamentösen Behandlung würde man sedierende Antidepressiva in niedrigen Dosierungen empfehlen. In letzter Instanz könnte man neue Arzneimittel wie Orexin-Rezeptorantagonisten einsetzen, die eher am biologischen Problem der Insomnie, eben dem «Hyper-Arousal» während der Nacht, ansetzen.
Welche Paradigmenwechsel sehen Sie in der Behandlung der Insomnie in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
T. Mikoteit: Heute gibt es sehr viel Evidenz, dass die KVT-I wirkt, und sie hat sich schon sehr gut in der Community der Schlafforschenden und der schlafmedizinischen Gesellschaften durchgesetzt. Die Tatsache, dass man diese Therapie anstelle von Schlafmedikamenten macht, ist für sich schon ein Paradigmenwechsel. Allerdings gibt es natürlich keine Therapie, die bei allen Menschen hundertprozentig wirkt. Die Frage bleibt daher, wie man mit Non-Respondern umgeht. Ausserdem gibt es bei der Insomnie wahrscheinlich ein Spektrum des Schweregrads. Bei den schwereren Fällen reicht die KVT-I alleine möglicherweise nicht aus und es ist vielleicht doch nötig, auch ein Medikament zu geben. Hier ist die Therapie des «Hyper-Arousals» durch Orexin-Rezeptorantagonisten heute wohl am innovativsten.
In der Zukunft könnte man sich jedoch auch vorstellen, dass man beispielsweise Hirnstimulanzverfahren einsetzt. Hier werden während des Schlafs die Hirnströme durch einfache Ableitungen gemessen und in Abstimmung mit den Phasen der langsamen EEG-Wellen akustische oder elektromagnetische Reize abgegeben, welche die Schlafphasen dann verstärken oder unterdrücken können. So könnte man zum Beispiel Einfluss darauf nehmen, dass man einen stabileren REM-Schlaf oder mehr Tiefschlafphasen hat.
Wenn man bedenkt, dass viele Menschen heute schon eine Smartwatch tragen, die viele Gesundheitsdaten aufnimmt, könnte man sich natürlich vorstellen, dass man mit sehr einfachen Methoden den Schlaf selbst positiv beeinflussen könnte. Allerdings ist hier Vorsicht geboten. Es scheint ein allgemeines Bedürfnis des modernen Menschen zu sein, sich selbst zu optimieren. Das heisst, auch eigene Gesundheitsdaten gezielt und systematisch zu erfassen und daraus Schlüsse zu ziehen, wie man dann gesünder leben könnte. Dies setzt jedoch zwingend voraus, dass die Messdaten relevant sind. Hier haben wir aber das Problem, dass wir nach wie vor nicht so genau sagen können, mit welchen Messdaten guter und gesunder Schlaf abzubilden ist. Daran scheitern dann auch die Empfehlungen. So zeigt sich jedoch auch wieder, dass es sehr wohl wertvoll ist, die biologischen Hintergründe der Insomnie besser zu verstehen, um die Diagnostik oder das Monitoring gezielter anzuwenden und auch um gezielte Ansatzpunkte für Arzneimittel zu finden. Ausserdem müssen diese Methoden validiert sein, ansonsten generiert man eine unnütze Scheinsicherheit.
Welche Hindernisse sehen Sie in der heutigen Regelversorgung von Patient:innen mit Insomnie?
T. Mikoteit: Aufgrund der Häufigkeit der Erkrankung ist es natürlich schwierig, sämtliche Patient:innen zu versorgen. Ein Hausarzt oder eine Hausärztin kann ja beim besten Willen nicht alle Patient:innen, die eine Insomnie haben, in einer Insomnieambulanz anmelden. Diese wäre völlig überfordert. Darum gibt es den Wunsch, solche Therapieformen online anzubieten. Mithilfe einer Smartphone-App, die man per Rezept verordnen kann, könnten Patient:innen dann selbstständig dieses kognitive Trainingsprogramm absolvieren.
Ein weiterer Ansatzpunkt wäre natürlich die Abgabe von einfach anzuwendenden Materialien an die Hausärzt:innen. Dazu würde gehören, dass man ihnen zum Beispiel die Top-5-Tipps der Insomniebehandlung oder andere Inhalte, die innerhalb von zwei Minuten vermittelt werden können, zur Verfügung stellt. Wie gesagt, eine zunehmende Digitalisierung würde dann wirklich ein Gamechanger sein.
Stellt eine Stigmatisierung ein wesentliches Hindernis in derGesellschaft dar?
T. Mikoteit: Ich glaube nicht, dass eine Stigmatisierung ein Hindernis darstellt. In der Bevölkerung wird Insomnie nicht zwingend mit psychiatrischen Problemen assoziiert. Schlafstörungen werden allgemein als unangenehm empfunden, da jeder Mensch natürlich gerne gut schlafen möchte. Wenn man Menschen gute Empfehlungen an die Hand gibt, werden sie diese wohl auch gerne durchführen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das könnte Sie auch interessieren:
Silexan wirkt bei Angst und Depressionen
Angststörungen und Depressionen stellen in der klinischen Praxis häufig einander begleitende Komorbiditäten dar, die sich gegenseitig verstärken können. In einem aktuellen Review war das ...
Die Vergangenheit und Zukunft der biologischen Depressionsbehandlung im Überblick
Trotz erheblicher Fortschritte in der neurobiologischen Forschung basiert die Diagnose der Depression nach wie vor primär auf der klinischen Beurteilung von Symptomen und Verlauf. In ...
Schizophrenie: Therapie durch gezielte Auswahl der Medikamente und Einbindung von Angehörigen und Peers
In den vergangenen Jahren hat es nicht die Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente gegeben, die sich Schizophrenieforscher gewünscht haben. Trotzdem kann den Patient:innen heute ...