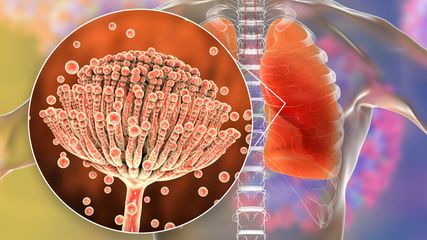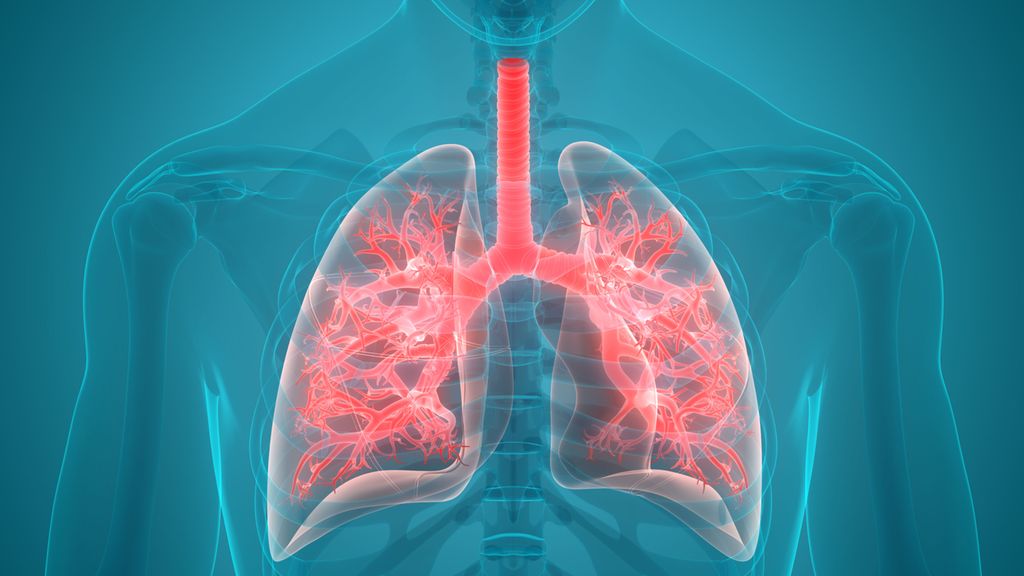
©
Getty Images/iStockphoto
Pulmonal-arterielle Hypertonie: neue Forschung und Therapieempfehlungen
Jatros
30
Min. Lesezeit
06.10.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die pulmonal-arterielle Hypertonie (PAH) hat sich innerhalb weniger Jahre von einer exotischen Erkrankung zu einem Hauptinteressengebiet der medizinischen Forschung entwickelt. Im Rahmen des ERS 2016 wurden unter anderem neue mechanistische Einsichten in die Pathologie der PAH vorgestellt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die physiologische Zirkulation in der Lunge zeichnet sich durch geringen Widerstand, niedrigen Druck und moderaten Fluss aus. So können beträchtliche Mengen Blut durch die Lunge fließen. Probleme treten auf, wenn sich einer dieser Parameter ungünstig verändert. So kann beispielsweise infolge einer Anämie zu viel Blut durch die Lunge gepumpt werden, und Linksherzinsuffizienz erhöht den Widerstand nach der Lunge („downstream pressure“). Beides kann zu Hypertonie in der Lunge führen. Die typische Ursache der PAH ist jedoch in einer Erhöhung des Gefäßwiderstandes in der Lunge selbst zu suchen. Dafür gibt es wieder eine Reihe möglicher Erklärungen, wie Prof. Dr. Harm Jan Boogard von der Universität Amsterdam ausführt. Infrage kommen Vasokonstriktion, Remodelling der Arteriolen, erhöhter venöser Widerstand oder möglicherweise auch Verlust von Lungengewebe (Rarefaction). Diese unterschiedlichen Erklärungen für die PAH entsprechen der Vielzahl der verschiedenen Formen dieser Erkrankung.</p> <h2>Viele Hypothesen, doch offene Fragen bleiben</h2> <p>Historisch wurde zunächst Vasokonstriktion als Ursache der PAH angenommen. Dabei ging man, so Boogard, von Befunden aus, die beispielsweise eine Zunahme von PAH durch Sauerstoffmangel in großer Höhe zeigen. Boogard: „Im Gegensatz zum großen Kreislauf führt im Lungenkreislauf Hypoxie zu Vasokonstriktion.“ Der Mechanismus ist allerdings noch nicht vollständig geklärt. Insbesondere ist unklar, wie Hypoxie als Signal verstanden wird. Vermutet wird ein Zusammenhang mit oxidativem Stress. Doch nicht nur Hypoxie bewirkt Vasokonstriktion in den Lungengefäßen. Ähnliche Effekte wurden unter anderem auch für Serotonin und Endothelin 1 oder Thromboxan A2 beobachtet. Eingeschränkte Vasodilatation infolge eingeschränkter NO-Produktion oder eines Verlustes der Prostazyklin-Synthase haben ähnliche Effekte.<br /> Boogard: „Das erklärt aber nicht alles. Wir können PAH nicht mit Vasodilatoren heilen. Seit 20 Jahren sehen wir also viel Forschung zum arteriellen Remodelling.“ Beispielsweise habe man gelernt, dass sich im Rahmen der Erkrankung auch das Endothel verändert, was insofern gut zur Klinik passe, als beispielsweise die Assoziation der PAH mit Bindegewebserkrankungen oder viralen Infektionen gut mit einer Beteiligung der Endothelzellen vereinbar sei. „Was wir allerdings nicht verstehen, ist, warum es nicht zu einer physiologischen Reparatur des Endothels kommt, sondern an einem bestimmten Punkt pathologische Veränderungen auftreten.“ Eine Beteiligung des Immunsys­tems dürfte hier ausschlaggebend sein. Dennoch bleiben zahlreiche offene Fragen. Diese betreffen beispielsweise die Beteiligung des venösen Systems. Offen ist nicht zuletzt auch die Frage, warum Frauen ein höheres Risiko haben, eine PAH zu entwickeln, als Männer.</p> <h2>Große Höhe als Risikofaktor für pulmonale Hypertonie</h2> <p>Zahlreiche im Rahmen des ERS 2016 präsentierte Arbeiten werfen ein neues Licht auf die Pathophysiologie der PAH. So gilt intensives Interesse dem Zink-Transporter ZIP12. Prof. Dr. Lan Zhao vom Imperial College London weist auf den generell in den Höhenregionen der Welt erhöhten pulmonalen Blutdruck hin. In Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass chronische Hypoxie das Risiko, eine PAH zu entwickeln, erhöht. Beim Menschen legen die epidemiologischen Daten jedoch einen ausgeprägten Zusammenhang mit der Genetik nahe. So liegt der durchschnittliche pulmonale Blutdruck im Lungenkreislauf im 3.600m hoch gelegenen Lhasa bei 15mmHg, in Leadville, Colorado, auf 3.100m hingegen bei 24mmHg (Abb. 1).<sup>1</sup> Auch bei Ratten wurde ein höhenresistenter Stamm identifiziert. Die bei Nagetieren dahinterliegende Mutation ist mittlerweile bekannt. Sie befindet sich auf Chromosom 17 und betrifft ein Gen, das für den Zink-Transporter ZIP12 kodiert. Die Familie der ZIP-Transporter reguliert die Zink-Homöostase in der Zelle. Die mit Höhenresistenz assoziierte Mutation führt zu einer Verkürzung des Proteins, die eine eingeschränkte Fähigkeit zum Zink-Transport erwarten lässt.<br /> Versuche mit Ratten zeigen auch, dass bei Hypoxie ZIP12 hochreguliert wird. Dieser Befund wurde bei Rindern bestätigt, die in größeren Höhen bovinen Lungenhochdruck („brisket disease“) entwickeln. In einer Studie an Menschen, die im kirgisischen Hochland leben, konnte ebenfalls eine Hochregulation von ZIP12 nachgewiesen werden. Diese Population bewohnt das Hochland seit rund 1.000 Jahren und kommt damit offenbar nicht gut zurecht. Rund 14 % der Bevölkerung zeigen Zeichen von pulmonaler Hypertonie.<sup>2</sup> Mittlerweile ist es auch gelungen, ZIP12-Upregulation in Biopsaten aus den Lungenarterien von Patienten mit idiopathischer PAH zu identifizieren. In einem weiteren Schritt gelang es, zu zeigen, dass Knock-out-Mäuse keine pulmonale Hypertonie entwickeln, wenn sie unter hypoxischen Bedingungen leben müssen.<sup>3</sup> Damit bieten sich ZIP12 im Speziellen und die intrazellulären Zink-Spiegel im Allgemeinen als neue therapeutische Ziele in der Behandlung der PAH an. Prof. Zhao: „Das kam alles sehr überraschend. Wir wären nicht auf die Idee gekommen, Zink mit pulmonaler Hypertonie in Verbindung zu bringen.“</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Pneumo_1605_Weblinks_seite18.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Der rechte Ventrikel bestimmt die Prognose</h2> <p>Weitere offene Fragen im Zusammenhang mit der PAH betreffen die Insuffizienz des rechten Ventrikels. Diese tritt naheliegenderweise auf, weil der Herzmuskel nicht mehr in der Lage ist, gegen den erhöhten Widerstand der pulmonalen Strombahn anzupumpen. Hinter dieser oberflächlichen Erklärung liegen jedoch zahlreiche Unklarheiten. Beispielsweise weiß man nicht, warum es bei manchen Patienten sehr schnell zum Rechtsherzversagen kommt, bei anderen jedoch deutlich langsamer. Prof. Dr. Roxane Paulin vom Heart and Lung Institute Research Centre in Quebec, Kanada, betont, dass Rechtsherzversagen der wichtigste prognostische Faktor in der PAH ist und buchstäblich über Leben und Tod des Patienten entscheidet. Die Funktion des rechten Ventrikels nimmt auch unter wirksamer und erfolgreicher PAH-Therapie ab. Erschwerend kommt hinzu, dass der rechte Ventrikel aus unbekannten Gründen deutlich schneller dekompensiert als der linke. Die Gruppe von Prof. Paulin studiert die Dekompensation des rechten Ventrikels in einem Rattenmodell. Verstärkte Inflammation, metabolische Veränderungen im Sinne einer abfallenden Glukoseaufnahme und abnehmende Angiogenese wurden als Charakteristika des dekompensierenden Myo­kards identifiziert. Zumindest der Verlust von Mikrogefäßen wurde auch bereits beim Menschen nachgewiesen. Die zurückgehende Angiogenese konnte mit einer Downregulation der kurzen Non-Coding-RNA, miR-126, in Verbindung gebracht werden. Eine weitere Non-Coding-RNA, miR-208, dürfte in Verbindung mit den metabolischen Veränderungen stehen. Versuche im Tiermodell legen nahe, dass miR-208 speziell für Veränderungen im rechten, nicht jedoch im linken Ventrikel bedeutsam ist.</p> <h2>Empfehlungen für die Diagnose und Therapie: die PAH-Leitlinie</h2> <p>Im Rahmen einer Sitzung zu den wichtigsten ERS-Publikationen des Jahres 2016 wurde erneut auf die aktualisierte Leitlinie zur pulmonalen Hypertonie eingegangen, die zwar bereits im vergangenen Jahr vorgestellt, doch erst 2016 vollständig publiziert wurde. In der Leitlinie wird pulmonale Hypertonie durch einen mittleren Blutdruck in der Pulmonalarterie von mindestens 25mmHg in Ruhe definiert. Die Probleme entstehen einerseits dadurch, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen Druck ohne den invasiven und durchaus mit Risiken verbundenen Einsatz des Herzkatheters zu messen, und andererseits auch dadurch, dass es eine Unzahl von Erkrankungen gibt, die mit Lungenhochdruck in Verbindung stehen können. Die von ERS und ESC gemeinsam erstellte Leitlinie definiert fünf Formen der pulmonalen Hypertonie: pulmonal-arterielle Hypertonie (PAH), pulmonale Hypertonie infolge von Herzerkrankungen, pulmonale Hypertonie infolge von Lungenerkrankungen, thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) sowie pulmonale Hypertonie mit anderen Ursachen. Die präzise Diagnose ist wichtig, da es nur für die PAH und die CTEPH zugelassene Therapien gibt und diese nicht bei anderen Formen der PH verwendet werden sollen.<br /> Gemäß Leitlinie sollen grundlegende Untersuchungen an normalen kardiologischen Abteilungen durchgeführt und die Patienten bei begründetem Verdacht auf PH zur weiterführenden Diagnostik mit dem Rechtsherzkatheter an ein spezialisiertes Zentrum überwiesen werden. Es gilt der Grundsatz: keine Therapie ohne adäquate Diagnose im spezialisierten Zentrum. Die Echokardiografie eignet sich für ein Screening auf PAH, erlaubt jedoch keine definitive Diagnose, sondern lediglich die Zuordnung zu Risikoklassen, die dann in Kombination mit klinischen Faktoren und nach gründlicher kardiologischer und pulmologischer Abklärung zu einer Zuweisung zum Herzkatheter führen können.</p> <h2>Viele zugelassene Substanzen, solide Evidenz</h2> <p>Insgesamt soll das Management von Patienten mit pulmonaler Hypertonie immer in Zusammenarbeit mit spezialisierten Zentren erfolgen. Der Therapiealgorithmus der aktuellen Leitlinie enthält eine Reihe neuer Medikamente und definiert genau deren Einsatzbereich und die Qualität der zugrunde liegenden Evidenz, zusammengefasst in einem Algorithmus auf Basis des individuellen Risikoprofils des Patienten. Eine potenziell kurative Therapie steht nur bei der CTEPH in Form der pulmonalen Endarterektomie zur Verfügung, sofern der Patient für diese schwierige und belastende Operation geeignet ist. Für CTEPH-Patienten, die für eine chirurgische Therapie nicht infrage kommen oder auf die chirurgische Therapie nicht adäquat ansprechen, steht mit dem Guanylatcyclase-Stimulator Riociguat mittlerweile auch eine medikamentöse Option zur Verfügung.<br /> Mit einem Vasoreaktivitätstest soll abgeklärt werden, ob der Patient für eine Therapie mit hoch dosierten Kalziumkanalblockern geeignet ist – und damit langfristig eine gute Prognose hat. Das ist leider bei mehr als 90 % der Betroffenen nicht der Fall. Für sie stehen mittlerweile zahlreiche Substanzen zur Verfügung, die bei niedrigem oder mittlerem Risiko initial als orale Mono- oder Kombinationstherapie eingesetzt werden. Bei Hochrisikopatienten wird bereits initial eine Kombinationstherapie inklusive eines intravenösen Prostazyklins empfohlen. Diese Empfehlungen basieren auf der Evidenz aus mittlerweile mehr als 30 randomisierten, kontrollierten Studien in der Indikation PAH.<sup>4</sup> Die Leitlinie steht im Internet zum Download zur Verfügung:<br /> <a href="http://erj.ersjournals.com/content/46/4/903#sec-26" target="_blank">http://erj.ersjournals.com/content/46/4/903#sec-26</a><br /> <a href="http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/28/eurheartj.ehv317" target="_blank">http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/28/eurheartj.ehv317</a></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Penaloza D, Arias-Stella J: The heart and pulmonary circulation at high altitudes: healthy highlanders and chronic mountain sickness. Circulation 2007; 115(9): 1132-46 <strong>2</strong> Wilkins MR et al: α1-A680T variant in GUCY1A3 as a candidate conferring protection from pulmonary hypertension among Kyrgyz highlanders. Circ Cardiovasc Genet 2014; 7(6): 920-9 <strong>3</strong> Zhao L et al: The zinc transporter ZIP12 regulates the pulmonary vascular response to chronic hypoxia. Nature 2015; 524(7565): 356-60 <strong>4</strong> Galiè N et al: Pulmonary arterial hypertension: from the kingdom of the near-dead to multiple clinical trial meta-analyses. Eur Heart J 2010; 31(17): 2080-6</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Allergologische Diagnostik von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Arzneimittel
Ungefähr 10% der Allgemeinbevölkerung berichten von unerwünschten Arzneimittelreaktionen, welche sich allerdings nur in weniger als 10% der Fälle diagnostisch verifizieren lassen. ...
Mukoviszidose – eine Erkrankung mit Prädisposition für Pilzinfektionen
Pilzinfektionen stellen eine zunehmende Herausforderung in der Behandlung von Menschen mit Mukoviszidose (zystische Fibrose) dar. Spezifische diagnostische Schritte und therapeutische ...