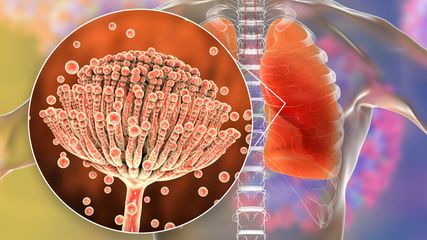©
Getty Images/iStockphoto
Pneumologische Notfälle
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
01.11.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Zahlen zur Morbidität und Mortalität ambulant erworbener Pneumonien stagnieren seit den 1980er-Jahren. Studien zeigen nun, dass eine Behandlung mit Steroiden in gewissen Fällen die Prognose verbessern könnte. Mit dem YEARS-Score gibt es einen neuen und einfachen Score, mit dem die Wahrscheinlichkeit einer akuten Lungenembolie (LE) abgeschätzt und die Anzahl an Thorax-CTs reduziert werden kann. Für die Behandlung der LE sind der klinische Schweregrad und das damit verbundene 30-Tage-Mortalitätsrisiko sowie das Rezidivrisiko entscheidend.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Kortikosteroide werden seit Mitte des letzten Jahrhunderts in der Behandlung des septischen Schocks eingesetzt. Vor dem Hintergrund der stagnierenden Morbidität und Mortalität ambulant erworbener Pneumonien («community acquired pneumonia», CAP) wird wegen ihrer antiinflammatorischen Wirkung auch in diesem Bereich ein Einsatz von Kortikosteroiden diskutiert. Die CAP gehört zu den häufigsten Gründen für einen septischen Schock.<br /> Die Akzeptanz von Kortikosteroiden zur Behandlung des septischen Schocks war in der Vergangenheit sehr unterschiedlich. Während in den 1980er-Jahren Kortikosteroide in sehr hohen Dosen zur Behandlung des septischen Schocks eingesetzt wurden, verzichtete man weitgehend darauf, nachdem die Autoren zweier 1995 publizierter Metaanalysen zum Schluss gekommen waren, dass die Behandlung mit hoch dosierten Kortikosteroiden mehr schadet als nützt.<sup>1, 2</sup> «Aktuell erleben wir nun einen zweiten Boom», sagte Dr. med. Claudine Blum, Oberärztin mbF am Kantonsspital Aarau an der SGP-Jahrestagung.</p> <h2>Ambulant erworbene Pneumonie: Zeit für Steroide?</h2> <p>In der Behandlung der schweren CAP hat der Trend zur Behandlung mit Kortikosteroiden als Ergänzung zu einer antibakteriellen Therapie unter dem Einfluss der Ergebnisse randomisierter kontrollierter Studien (RCT) stetig zugenommen. Das führte schon bald zu der Frage, welchen Effekt die Steroidbehandlung bei der CAP generell hat. Wie Blum et al. 2015 in einer Studie mit 785 Patienten zeigen konnten, führte die Behandlung mit Prednisolon im Vergleich zu Placebo schneller zur klinischen Stabilisierung der CAP-Patienten. Darüber hinaus konnten die Dauer der Antibiotikabehandlung sowie die Hospitalisationsdauer bei den mit Kortikosteroiden behandelten Patienten reduziert werden.<sup>3</sup> Obwohl sich die Komplikationsrate insgesamt zwischen den beiden Behandlungsgruppen nicht signifikant unterschied, wurden mehr Fälle von Hyperglykämie unter der Steroidbehandlung beobachtet (26 % vs. 17,3 % ).<br /><br /> In letzter Zeit sind verschiedene Reviews erschienen, die den Einfluss von Kortikosteroiden auf das Mortalitätsrisiko von CAP-Patienten untersucht haben. In einer Metaanalyse von sechs RCT unterschied sich die Gesamtmortalität bei den CAP-Patienten, die zusätzlich mit Kortikosteroiden behandelt wurden, nicht signifikant von den mit Placebo behandelten Patienten.<sup>4</sup> Ein im gleichen Zeitraum erschienener Review der Cochrane Collaboration mit einer Metaanalyse von 17 Studien kommt hingegen zu dem Ergebnis, dass die Behandlung mit Steroiden die Anzahl an Fällen von frühem Therapieversagen, die Mortalitätsrate sowie die Hospitalisationsdauer reduzieren kann.<sup>5</sup> Am effektivsten erwies sich die Behandlung bei schwerer CAP, wie eine Subanalyse zeigte. «Ob eine Behandlung mit Kortikosteroiden auch bei Patienten mit leichteren Formen einer CAP indiziert ist, ist jedoch unklar», sagte Blum. Es fehlen insbesondere Daten zur ambulanten Behandlung. <br /><br /><span style="color: #999999;"><strong>Fragen aus dem Publikum zur Behandlung der CAP und praktische Aspekte</strong> </span><br /><br /><strong>Studien haben gezeigt, dass die Behandlung mit Steroiden bei Personen mit Influenza die Sterberate erhöht hat. Sollte man daher nicht zwischen Personen mit einer bakteriellen und solchen mit einer viralen CAP differenzieren?<br /> C. Blum:</strong> Die von Ihnen erwähnten Studien wurden zu Beginn der Influenza- Epidemie publiziert.<sup>6, 7</sup> Die Ergebnisse einer anschliessend durchgeführten Metaanalyse waren nicht so eindeutig. <sup>8</sup> In einer Subanalyse unserer Studie konnten wir keine Unterschiede zwischen Patienten mit einer bakteriellen oder einer viralen CAP zeigen.<sup>9</sup> Ich denke, dass uns bei einer influenzainduzierten Pneumonie heute wirksamere Medikamente als Steroide zur Verfügung stehen. Bei anderen schweren viralen Pneumonien oder bei unbekanntem Erreger würde ich den Einsatz von Kortikosteroiden nicht ausschliessen.<br /><br /> <strong>Welche Dosis haben Sie in Ihrer Studie angewendet und wie wurde diese festgelegt?<br /> C. Blum:</strong> In unserer Studie wurden die Patienten während 7 Tagen mit 50mg Prednison behandelt. Das entspricht etwa der Dosierung, die in den positiven Studien ausserhalb der Intensivstation eingesetzt wurde, und war zum Zeitpunkt des Studienbeginns die empfohlene Standarddosis bei COPD-Exazerbationen. Wir haben uns an der oralen Dosierung orientiert, weil wir wussten, dass wir vor allem Patienten einschliessen würden, die auf der Normalstation hospitalisiert werden.<br /><br /><strong><strong> Gibt es Biomarker, die hilfreich sind, um die richtigen Patienten auszuwählen?<br /> C. Blum:</strong></strong> Wir haben verschiedene Prädiktoren angeschaut und festgestellt, dass weder das CRP noch das Procalcitonin oder die Leukozytenzahl zur Identifizierung von Patienten geeignet sind, die von der Behandlung mit Steroiden profitieren. Der Gruppe um Willem Jan Bos aus den Niederlanden ist es gelungen, aufgrund der Kombination von CRP und bestimmten Zytokinen eine solche Subgruppe zu identifizieren.<sup>10</sup> Die dazu notwendigen Assays sind bislang nur zu Studienzwecken erhältlich. Es gibt also im Moment noch keine geeigneten Biomarker, die wir zu diesem Zweck einsetzen können.<strong><br /><br /><strong> Gibt es eine «number needed to treat» für die Steroidtherapie?<br /> C. Blum:</strong> </strong>In der Cochrane-Metaanalyse von Stern et al. betrug die NNT, um bei Patienten mit schwerer CAP einen Todesfall zu verhindern, 35. Die «number needed to harm» für das Auftreten von unerwünschten Wirkungen betrug ebenfalls 35.<sup>5, 11</sup> Wir müssen also mit Nebenwirkungen rechnen, wenn wir diese Behandlung einsetzen. Umso wichtiger ist es, die Patienten mit Sorgfalt auszuwählen.</p> <h2>Die Diagnose der Lungenembolie bleibt schwierig</h2> <p>Die Lungenembolie (LE) ist nach Myokardinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste Ursache für ein akutes kardiovaskuläres (CV) Syndrom. Obwohl die Inzidenz – wahrscheinlich infolge der steigenden Lebenserwartung und besserer Diagnosemöglichkeiten – zunimmt, ist die Zahl tödlicher Lungenembolien rückläufig.<sup>12</sup> «Die Diagnose der Lungenembolie bleibt jedoch aufgrund der zumeist unspezifischen klinischen Symptome schwierig», sagte Prof. Dr. med. Silvia Ulrich, Leitende Ärztin an der Klinik für Pneumologie am Universitätsspital Zürich, an der SGP-Jahrestagung in St. Gallen.<br /> In der Diagnostik spielt die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit eine Rolle, das bedeutet das Vorhandensein von Risikofaktoren, die mit hoher, moderater oder geringer Wahrscheinlichkeit eine LE provozieren können. Neben den etablierten Scores «Wells» und «Geneva» existiert mit dem YEARS-Score ein neuer, einfacher Score, um die Wahrscheinlichkeit einer LE abzuschätzen und die Anzahl notwendiger Thorax-CTs zu reduzieren. Der YEARSScore macht den Einsatz diagnostischer bildgebender Verfahren von der D-Dimer- Konzentration und folgenden Faktoren abhängig: klinischen Zeichen einer tiefen Beinvenenthrombose, Hämoptyse und einer LE als wahrscheinlichster Diagnose (Abb. 1). Wie in einer Untersuchung gezeigt wurde, konnte das Vorhandensein einer LE mit dem YEARS-Score sicher ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wurde durch die Verwendung des Scores die Anzahl der CT-Angiografien deutlich reduziert.<sup>13</sup> Behandlung der akuten LE<br /> Für die Behandlung der akuten LE spielt der klinische Schweregrad eine Rolle. Ein Score, um die Patienten entsprechend ihrem Risiko zu stratifizieren, ist der «Pulmonary Embolism Severity Index» (PESI) zur Einschätzung der 30-Tage-Mortalität. Die ursprüngliche Version des PESI war sehr komplex. Heute kommt vor allem die vereinfachte Version (sPESI) zur Anwendung (Tab. 1).<sup>14</sup> Bei einem PESI von 0 Punkten ist das Mortalitätsrisiko niedrig (30-Tage-Mortalität 1 % ) und es ist deshalb eine ambulante Behandlung der LE möglich. Beträgt der PESI =1 Punkt, ist das Mortalitätsrisiko erhöht (30-Tage-Mortalität 10,9 % ) und die Patienten sollten hospitalisiert werden.<br /> «Bei bestätigter LE und hämodynamischer Instabilität muss unverzüglich eine Reperfusionsbehandlung eingeleitet werden », sagte Ulrich. «Unklarheit herrscht nach wie vor über die Behandlungsstrategie bei Patienten mit einem mittleren Risiko, die erhöhte Troponinwerte und/oder Zeichen einer Rechtsherzbelastung in der Bildgebung aufweisen, aber keine Schocksymptome », sagte Ulrich. Wie die Ergebnisse der PEITHO-Studie bei diesen Patienten gezeigt haben, konnte durch die systemische Thrombolyse mit Tenecteplase eine hämodynamische Dekompensation verhindert werden. Das Risiko für grosse, darunter auch intrakranielle Blutungen nahm unter der Behandlung aber zu, sodass sich die Gesamtmortalität nach 30 Tagen nicht von der bei den mit Placebo behandelten Patienten unterschied.<sup>15</sup> Deshalb wird in einer solchen Situation von einer systemischen Thrombolyse abgeraten. Zudem zeigte sich im Langzeit-Follow- up, dass das seltene Auftreten einer chronischen thromboembolischen pulmonalen Hypertonie durch die Thrombolyse nicht verhindert werden konnte.<sup>16</sup><br /> Wie eine kürzlich publizierte Metaanalyse zeigte, können katheterbasierte Interventionen wie beispielsweise die Low-dose- oder ultraschallgesteuerte Fibrinolyse sowie die Thrombusaspiration oder -fragmentation bei hämodynamisch stabilen LE-Patienten mit einem mittleren 30-Tage- Mortalitätsrisiko die Rechtsherzdimension verbessern.<sup>17</sup> «Bevor diese Interventionen empfohlen werden können, müssen sie zunächst in grösseren, randomisierten, kontrollierten Studien untersucht werden », so Ulrich.<br /> Wichtig ist, dass bei Verdacht auf eine akute LE unmittelbar mit der Behandlung begonnen wird. Patienten mit einem niedrigen bis mittleren Risiko erhalten entweder niedermolekulares Heparin, Fondaparinux oder ein nicht Vitamin-K-abhängiges orales Antikoagulans (NOAK; Abb. 2). Bei Verdacht auf ein mittleres oder hohes Risiko sollte eine Behandlung mit Heparin initiiert werden und eine Hospitalisation auf der Überwachungsstation erfolgen. Die Dauer der Behandlung ist abhängig davon, ob die LE durch Risikofaktoren provoziert wurde oder ob Risikofaktoren fehlen. Bei einer durch chirurgische Risikofaktoren provozierten LE beträgt die Behandlungsdauer in der Regel 3 Monate. «Patienten mit einer durch nicht chirurgische Risikofaktoren provozierten LE und solche mit einer nicht provozierten LE müssen aufgrund des erhöhten Rezidivrisikos länger, möglicherweise lebenslang, behandelt werden», sagte Ulrich.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1805_Weblinks_s14_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1095" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1805_Weblinks_s14_tab1.jpg" alt="" width="350" height="507" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1805_Weblinks_s16_abb2.jpg" alt="" width="1417" height="1004" /></p> <p> </p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Gemeinsame Jahresversammlung der Schweizerischen
Gesellschaft für Pneumologie (SGP), 24.–25. Mai 2018, St.
Gallen
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Cronin L et al.: Corticosteroid treatment for sepsis: a critical appraisal and meta-analysis of the literature. Crit Care Med 1995; 23: 1430-9 <strong>2</strong> Lefering R, Neugebauer EA: Steroid controversy in sepsis and septic shock: a metaanalysis. Crit Care Med 1995; 23: 1294-303 <strong>3</strong> Blum CA et al.: Adjunct prednisone therapy for patients with community- acquired pneumonia: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2015; 385: 1511-8 <strong>4</strong> Briel M et al.: Corticosteroids in patients hospitalized with community-acquired pneumonia: systematic review and individual patient data metaanalysis. Clin Infect Dis 2018; 66: 346-54 <strong>5</strong> Stern A et al.: Corticosteroids for pneumonia. Cochrane Database Syst Rev 2017; 12: CD007720 <strong>6</strong> Brun-Buisson C et al.: Early corticosteroids in severe influenza A/H1N1 pneumonia and acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: 1200-6 <strong>7</strong> Han K et al.: Early use of glucocorticoids was a risk factor for critical disease and death from pH1N1 infection. Clin Infect Dis 2001; 53: 326-33 <strong>8</strong> Zhang Y et al.: Do corticosteroids reduce the mortality of influenza A (H1N1) infection? A meta-analysis. Crit Care 2015; 19: 46 <strong>9</strong> Wirz SA et al.: Pathogen- and antibiotic-specific effects of prednisone in community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2016; 48: 1150-9 <strong>10</strong> Remmelts HH et al.: Biomarkers define the clinical response to dexamethasone in community- acquired pneumonia. J Infect 2012; 65: 25-31 <strong>11</strong> Hunter BR: Review: Adjunctive corticosteroids reduce mortality and clinical failure in adult inpatients with CAP. Ann Intern Med 2018; 168: JC40 <strong>12</strong> Konstantinides SV et al.: Management of pulmonary embolism: an update. J Am Coll Cardiol 2016; 67: 976-90 <strong>13</strong> van der Hulle T et al.: Simplified diagnostic management of suspected pulmonary embolism (the YEARS study): a prospective, multicentre, cohort study. Lancet 2017; 390: 289-97 <strong>14</strong> Jiménez D et al.: Simplification of the pulmonary embolism severity index for prognostication in patients with acute symptomatic pulmonary embolism. Arch Intern Med 2010; 170: 1383-9 <strong>15</strong> Meyer G et al.: Fibrinolysis for patients with intermediate- risk pulmonary embolism. N Engl J Med 2014; 370: 1402-11 <strong>16</strong> Konstantinides SV et al.: Impact of thrombolytic therapy on the long-term outcome of intermediate- risk pulmonary embolism. J Am Coll Cardiol 2017; 69: 1536-44 <strong>17</strong> Lou BH et al.: A meta-analysis of efficacy and safety of catheter-directed interventions in submassive pulmonary embolism. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2017; 21: 184-98</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Allergologische Diagnostik von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Arzneimittel
Ungefähr 10% der Allgemeinbevölkerung berichten von unerwünschten Arzneimittelreaktionen, welche sich allerdings nur in weniger als 10% der Fälle diagnostisch verifizieren lassen. ...
Mukoviszidose – eine Erkrankung mit Prädisposition für Pilzinfektionen
Pilzinfektionen stellen eine zunehmende Herausforderung in der Behandlung von Menschen mit Mukoviszidose (zystische Fibrose) dar. Spezifische diagnostische Schritte und therapeutische ...