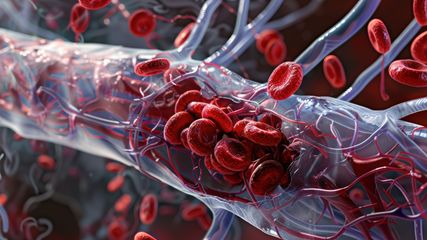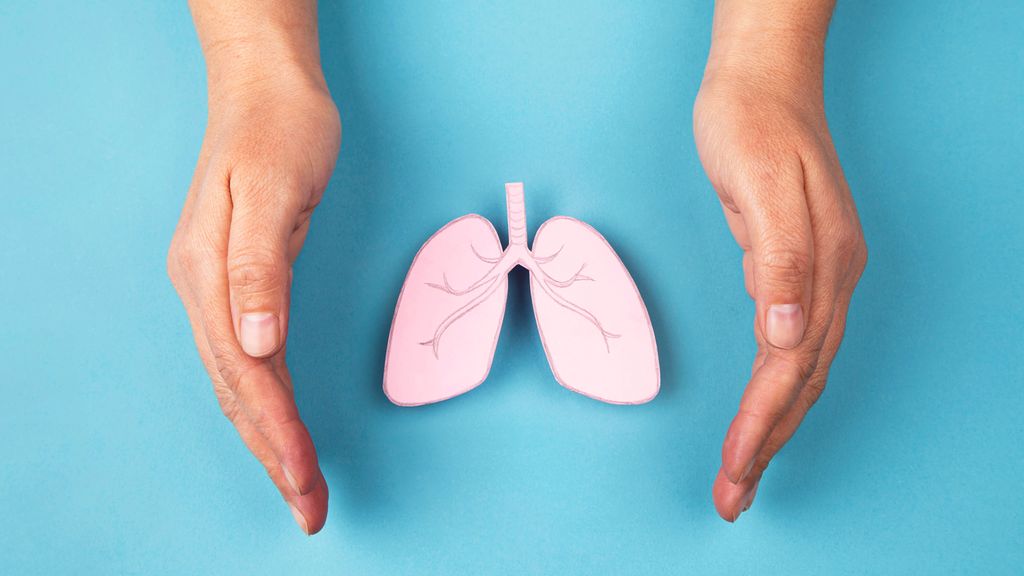
ILD und Orphan Diseases
Autor:
OA Dr. Hubert Koller
Leiter der Fibroseambulanz und der allgemeinen Lungenambulanz
Abteilung für Atemwegs- und Lungenerkrankungen
Klinik Penzing, Wien
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Am 11.6.2021 fand die virtuelle Fortbildungsveranstaltung „ILD und Orphan Diseases“ im Rahmen der ÖGP Summer School statt. Da es unmöglich ist, in diesem Format alle interstitiellen Lungenerkrankungen (ILD) abzuhandeln, hat sich der Referent in diesem Artikel auf die in der klinischen Praxis wichtigsten ILD und Orphan Diseases beschränkt.
Keypoints
-
In der Diagnostik und Therapie einer interstitiellen Lungenerkrankung (ILD) ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit ausschlaggebend.
-
Die für die klinische Praxis bedeutendsten ILD umfassen die idiopathische Lungenfibrose, die progrediente fibrosierende ILD, die Sarkoidose und die kryptogene organisierende Pneumonie.
-
Zu den wichtigsten Orphan Diseases zählen die pulmonale Alveolarproteinose und die Lymphangioleiomyomatose.
Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit von Klinik, Radiologie, Pathologie, Rheumatologie und auch Dermatologie von immenser Bedeutung in der Diagnostik und Therapie einer interstitiellen Lungenerkrankung (ILD), d.h., jeder Patient sollte einem ILD-Board vorgestellt werden.
Idiopathische pulmonale Fibrose (IPF)
Die IPF ist innerhalb der sogenannten idiopathischen interstitiellen Pneumonien jene Erkrankung, die die schlechteste Prognose aufweist. Die mittlere Überlebensdauer betrug bisher ohne effiziente Therapie 3,5 Jahre. Auch im Vergleich mit den meisten Malignomen hat die IPF eine schlechtere Prognose (außer Lungen- und Pankreas-Ca).
Die IPF
-
ist eine chronische progrediente fibrosierende Pneumonie,
-
betrifft ältere Erwachsene,
-
ist auf die Lunge beschränkt,
-
ist eine Krankheit, bei der sich radiologisch und/oder histopathologisch das „Usual interstitial pneumonia“(UIP)-Musterfindet,
-
ist eine Ausschlussdiagnose.
Der typische IPF-Patient ist männlich, über 60 Jahre alt, aktiver Raucher oder Exraucher (>20py), klagt über Reizhusten und Atemnot unter Belastung; klinisch findet man auskultatorisch ein Knisterrasseln („velcro rales“).
Da die IPF eine Ausschlussdiagnose darstellt, müssen wir Patienten auf CTD („connective tissue disease“) und Umweltexpositionen screenen, da ein radiologisches UIP-Muster auch bei diesen Erkrankungen vorliegen kann.
Im Zentrum der Diagnostik steht die Dünnschicht-Thorax-CT, die zwischen einem definitiven, einem wahrscheinlichen und einem „indeterminate“ UIP-Muster unterscheidet. Entsprechend dem Muster muss dann im ILD-Board entschieden werden, ob eine invasive Diagnostik (bronchoalveoläre Lavage [BAL], bronchologische oder chirurgische Lungenbiopsie) erforderlich ist. Eine moderne Methode der Lungenbiopsie ist die bronchologische transbronchiale Kryobiopsie, die jedoch nur in spezialisierten Zentren durchgeführt werden sollte.
Für die Therapie der IPF gibt es seit zehn Jahren in Österreich Pirfenidon, seit sechs Jahren Nintedanib. Beide orale Medikamente haben in großen internationalen Zulassungsstudien gezeigt, dass sie den progredienten Lungenfunktionsverlust – gemessen an der forcierten Vitalkapazität (FVC)– abbremsen und somit die Prognosedeutlich verbessern können. Für ausgewählte und jüngere Patienten ist die Lungentransplantation eine gute Therapieoption.
Progrediente fibrosierende ILD (PF-ILD)
Neben der idiopathischen Lungenfibrose (IPF), dem Prototyp der progredient fibrosierenden ILD (PF-ILD), entwickelt ein weiterer Teil der ILD-Patienten ebenfalls eine progrediente Lungenfibrose.
Zu diesen zählen unter anderem die exogen allergische Alveolitis (EAA), die idiopathische nichtspezifische interstitielle Pneumonie (iNSIP), die Sarkoidose, die Medikamenten-induzierte Fibrose sowie auch Kollagenosen (CTD-ILD), wie rheumatoide Arthritis (RA), systemische Sklerose (SSc) oder gemischte Kollagenosen (MCTD-ILD), und die unklassifizierbare Lungenfibrose (bis 10% aller ILD), aber auch die Asbestose und die IPAF (interstitielle Pneumonie mit Autoimmun-Features).
Neuere Studien (SENSCIS, INBUILD) haben die Wirksamkeit von Nintedanib bei diesen verschiedenenfibrosierenden Lungenerkrankungen belegt; somit haben wir ein weiteres Medikament zusätzlich zu den üblichen antiinflammatorischen und immunsuppressiven Therapien zur Verfügung.
Das bedeutet, dass wir als Pneumologen mit den Rheumatologen eine intensive interdisziplinäre Diskussion führen müssen, um hier individuell Therapiestrategien zu entwickeln.
Sarkoidose
Die Sarkoidose ist eine granulomatöse inflammatorische Multisystemerkrankung unbekannter Ursache, die histopathologisch durch nicht nekrotisierende epitheloid- und riesenzellige Granulome gekennzeichnet ist. Ursächlich liegt eine antigenspezifische Immunantwort auf ein bisher nicht identifiziertes Trigger-Antigen vor, wobei es nach T-Zell-Aktivierung zur Granulomformation kommt.
In unseren Breiten sind diese Granulome am häufigsten in den hilären und mediastinalen Lymphknoten und dem Lungenparenchym zu finden, prinzipiell können jedoch alle Organsysteme betroffen sein. Eine morphologische Diagnostik ist auf jeden Fall anzustreben. Nicht jede diagnostizierte Sarkoidose der Lungen und der Lymphknoten ist behandlungsbedürftig – die meisten Patienten können kontrolliert werden, um den Verlauf zu beobachten, bei deutlichen Einschränkungen der Lungenfunktion bzw. der Oxygenierung sind Kortikosteroide Mittel der Wahl. Bei den extrapulmonalen Manifestationen sind besonders Augen-, Haut-, Nerven- und Herzbeteiligungen zu bedenken und im Verdachtsfall interdisziplinär entsprechend abzuklären.
Kryptogene organisierende Pneumonie (COP)
Die COP zählt zu den idiopathischen interstitiellen Pneumonien und geht klinisch mit einem protrahierten „flu-likesyndrome“ einher; histopathologisch zeigen sich in der Lungenbiopsie typische Faserpolsterbildungen („Masson bodies“) im Lungenparenchym, radiologisch finden sich typischerweise fleckige bilaterale Konsolidierungen mit Aerobronchogramm, selten fokale Formen, teils mit Einschmelzungen, noch seltener diffus-infiltrative Formen wie bei Lungenfibrosen.
Eine morphologische Diagnostik ist unbedingt anzustreben, die Therapie der Wahl sind Kortikosteroide über mindestens sechs Monate, da es sonst zu Rezidiven kommen kann.
Differenzialdiagnostisch sind sekundäre organisierende Pneumonien auszuschließen, wie wir sie nun z.B. im Rahmen der Covid-19-Pandemie häufig sehen; aber auch andere virale und bakterielle Infekte und Medikamente (z.B. Immun-Checkpoint-Inhibitoren) können zur organisierenden Pneumonie führen; weiters sehen wir sekundäre Formen im Rahmen von Kollagenosen.
Orphan Diseases
Pulmonale Alveolarproteinose (PAP)
Die Alveolarproteinose ist gekennzeichnet durch eine massive Deposition von Surfactant-ähnlichem PAS-positivem lipoproteinösem Material in den Alveolen, wodurch es zu einer Oxygenierungsstörung kommt. Radiologisch typisch ist in der Dünnschicht-CT des Thorax ein „Crazy paving“-Muster. Für die Diagnose genügt in der Regel eine BAL, fast nie ist eine Lungenbiopsie erforderlich.
Seit 1999 weiß man, dass es sich bei der adulten Form der PAP um eine Autoimmunerkrankung handelt, da im Serum dieser Patienten neutralisierende Antikörper gegen GM-CSF nachgewiesen werden können. GM-CSF ist essenziell für die Reifung der Alveolarmakrophagen und damit für den Abbau von Surfactant in der Alveole, d.h., bei Dysfunktion der Makrophagen kommt es zu einem gestörten Abbau von Surfactant („ungraded surfactant“), welcher dann in der Alveole abgelagert wird.
Als Therapie der Wahl gilt immer noch die „große Lungenlavage“, welche nur in ausgewählten Zentren in Österreich durchgeführt wird – seit einigen Jahren in Kombination mit einer inhalativen Therapie mit GM-CSF. Als Ultima Ratio gelten die Therapie mit Rituximab, Plasmapherese oder Lungentransplantation.
Lymphangioleiomyomatose (LAM)
Die LAM ist eine sehr seltene systemische neoplastische Erkrankung, welche durch Mutationen im TSC1- oder TSC2-Gen bedingt ist. Die Mutationen führen zur mTOR-Aktivierung und zu einer klonalen neoplastischen Proliferation von „glatten Muskelzellen“, die die Lunge invadieren und zu ihremRemodeling führen. Man unterscheidet zwischen einer sporadischen LAM (S-LAM TSC2) und einer mit tuberöserSklerose (TSC1-LAM) assoziierten LAM (1%).
Die S-LAM zeigt sich nur bei Frauen in der Prämenopause. Bis zu 50% der Frauen präsentieren sich mit Pneumothorax (uni-/bilateral, rezidivierend), Chylothorax (20%); zu beachten sind mögliche extrapulmonale Manifestationen wie Angiomyolipome der Nieren, Zysten in Leber, Niere und Pankreas, Chyloascites und Meningeome. In der Dünnschicht-CT des Thorax finden sich dünnwandige rundliche Zysten von 2mm bis 5cm.
Lungenfunktionell weisen die Patientinnen eine obstruktive Ventilationsstörung auf, weswegen sie häufig als COPD- oder Asthma-Patientinnen geführt werden.
Als Serummarker hat sich VEGF-D erwiesen: Bei einem VEGF-D-Spiegel von >800pg/ml und einem FEV1<70%vom Soll können wir heute Sirolimus (Rapamycin=Inhibitor von mTOR) als Therapie anbieten. Letztlich ist auch bei der LAM die Lungentransplantation eine Therapieoption.
Grundsätzlich sollten Patienten mit allen genannten ILD nur in spezialisierten Zentren betreut werden.
Literatur:
beim Verfasser
Das könnte Sie auch interessieren:
Best of DGP: Kongress-Highlights für die Praxis
Dr. Sabine Lampert, niedergelassene Pneumologin in Erlangen, fasste die Erkenntnisse vom DGP-Kongress 2025 für die tägliche Praxis zusammen. Sie konzentrierte sich bei ihrem „Best of DGP ...
Lungenembolie: Engramme für den Behandlungspfad
Die Lungenembolie ist ein häufiges und potenziell lebensbedrohliches Krankheitsbild. Die Diagnose bleibt herausfordernd – immer noch zählt die Lungenembolie zu den Diagnosen, die am ...