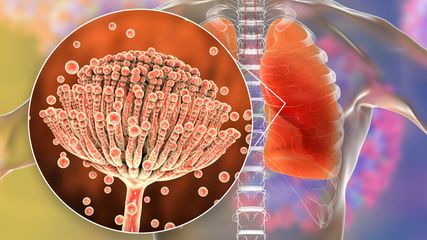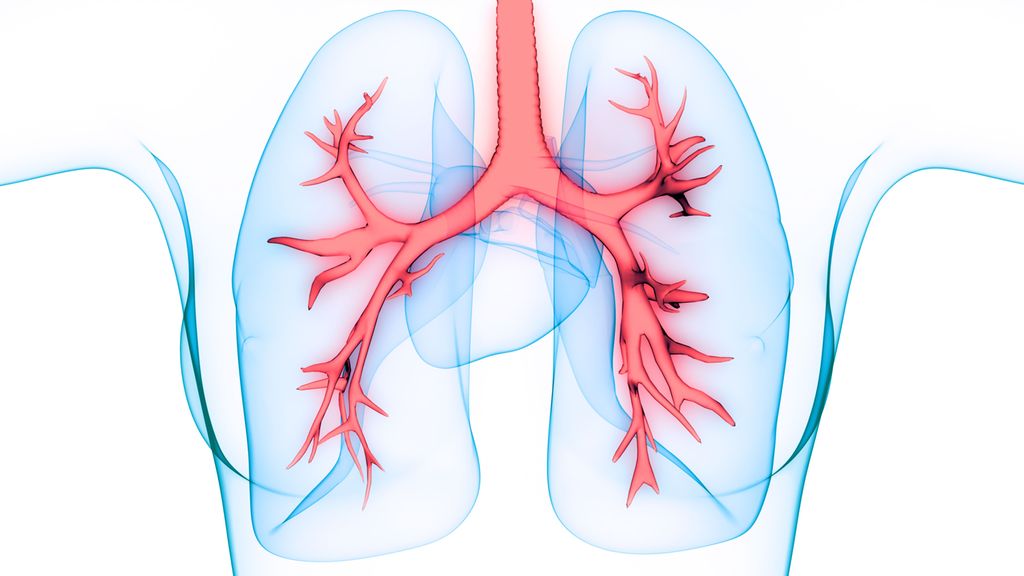
©
Getty Images/iStockphoto
Husten infektiöser Ursache – oft durch Impfung vermeidbar
Jatros
Autor:
Priv.-Doz. Dr. Ingrid Stelzmüller
Niedergelassene Fachärztin für Lungenheilkunde<br> Salzburg<br> E-Mail: praxis@drstelzmueller.at
30
Min. Lesezeit
13.12.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Im niedergelassenen Bereich stellt die Hustenabklärung einen wesentlichen Teil der täglichen Ordinationstätigkeit dar. Vor allem mit Beginn der nasskalten Jahreszeit stehen Infektionen als Hustenauslöser an vorderster Stelle.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Einteilung des Hustens</h2> <p>Je nach Hustendauer wird zwischen akut (bis zu 3 Wochen), subakut (3 bis 8 Wochen) und chronisch (mehr als 8 Wochen) unterschieden. Der Husten kann trocken oder produktiv sein. Infektionen der oberen und unteren Atemwege sind zumeist mit Husten bis zu etwa 8 Wochen verbunden. Eine Hustendauer von 8 Wochen und mehr findet sich häufig bei Pertussis, aber auch Tuberkulose oder Bronchiektasien.</p> <h2>Infektionen als Hustenursache</h2> <p>Infekte der oberen Atemwege – von der Rhinopharyngitis über die Epiglottitis bis hin zur Laryngotracheitis – sind die häufigsten Ursachen für Krankenstände in den Wintermonaten. Da die Genese zumeist viral ist, sind Antibiotika in der Regel nicht indiziert. Ausnahmefälle sind nachgewiesene bakterielle Infektionen wie eine bakterielle Sinusitis oder eine Angina durch Gruppe-A-Streptokokken. Ansonsten ist eine symptomatische Therapie mit NSAR, Nasentropfen und Hustensäften, die Phytopharmaka wie Thymian-, Pelargonium-, Eibisch-, Schlüsselblumen-, Efeu oder Spitzwegerichextrakte enthalten, ausreichend. Wichtig ist neben der körperlichen Schonung die Zufuhr von reichlich Flüssigkeit, um den Schleim bei trockenem Husten zu verflüssigen, damit er besser abgehustet werden kann. <br />Auch bei tiefen Atemwegsinfektionen wie der akuten Bronchitis steht die virale Genese mit Influenza-, Parainfluenza-, RS-, Rhino- oder Adenoviren im Vordergrund. Bei fehlenden Zeichen einer Superinfektion ist auch hier eine Antibiose verzichtbar. Bei einer obstruktiven Bronchitis können kurz wirksame β-Mimetika durchaus sinnvoll sein. Bei stark quälendem Husten (vor allem nachts) können Codein- Präparate verordnet werden, wobei es diesbezüglich keine wissenschaftliche Evidenz für einen relevanten Nutzen gibt. <br />Insbesondere bei Patienten mit rezidivierenden Atemwegsinfektionen oder COPD- Exazerbationen besteht die Möglichkeit, durch orale Immunstimulation das spezifische und angeborene Immunsystem bereits vorab zu stärken. OM-85 ist eine Mischung von Bakterienlysaten aus Kulturen von acht für respiratorische Infektionen wesentlichen Bakterien. Durch eine prophylaktische Gabe kann Infektionen im HNO-Bereich, in den tiefen Atemwegen sowie teilweise auch COPD-Exazerbationen vorgebeugt werden.</p> <h2>Durch Impfung vermeidbare Infektionen</h2> <p>Influenza und die ambulant erworbene Pneumonie sind weitere Ursachen eines Hustens. Bei diesen beiden Infektionen besteht die Möglichkeit der Schutzimpfung. Nach der Influenza-Epidemie der Saison 2017/18 durch den nicht im letztjährigen Impfstoff enthaltenen Influenza-B-Stamm, Linie Yamagata, sollte für die Saison 2018/19 flächendeckend der quadrivalente Influenza-Impfstoff mit je zwei A- und B-Stämmen verabreicht werden. <br />Geimpft werden sollten neben älteren Menschen auch Schwangere, Immunsupprimierte und Patienten mit chronischen Krankheiten wie Asthma, COPD, Diabetes, Nieren- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vor allem bei kardial oder pulmonal vorerkrankten Patienten ist die Influenza-Impfung nachweislich von wesentlichem Nutzen, da sie zu einer Reduktion schwerer Exazerbationen und kardialer Dekompensationen und somit zur Reduktion der kardiopulmonalen Mortalität führt. Insbesondere bei höhergradigen Erkrankungsstadien ist der protektive Effekt mit Vermeidung einer Hospitalisierung deutlich. Laut dem US-amerikanischen Center of Disease Control (CDC) können durch die Influenza- Impfung 90 068 Hospitalisierungen in den USA vermieden werden. Auf Österreich bezogen wären dies rund 2500 stationäre Behandlungen. <br />Der wichtigste Risikofaktor für eine ambulant erworbene Pneumonie („community- acquired pneumonia“, CAP) ist das Alter. Mit zunehmendem Alter steigt nicht nur die Morbidität, sondern auch die Mortalität rasant an. Häufig ist die CAP insbesondere bei Patienten mit zahlreichen Komorbiditäten eine End-of-Life-Erkrankung. Die häufigsten Erreger sind dabei Pneumokokken, gegen die ebenfalls eine Impfung zur Verfügung steht. Geimpft werden sollten alle Personen ab dem 51. Lebensjahr und Risikogruppen, unter anderem mit chronischen Erkrankungen. Die Schutzimpfung besteht aus zwei Teilen: Zunächst soll der 13-valente Pneumokokken-Konjugatimpfstoff verabreicht werden, da dieser zu einer T-Zell-abhängigen Immunantwort mit Ausbildung eines Immungedächtnisses und einer Boosterwirkung bei neuerlicher Impfung führt. Mindestens acht Wochen später sollte der 23-valente Pneumokokken- Polysaccharidimpfstoff verabreicht werden, um die Anzahl der geimpften Serogruppen zu erhöhen. Im österreichischen Impfplan 2018 wird erstmals für Risikogruppen alle fünf Jahre eine Auffrischung zunächst mit dem PCV13 und mindestens acht Wochen später mit PPV23 empfohlen.</p> <h2>Keuchhusten – nicht nur eine Kinderkrankheit</h2> <p>Galt Pertussis früher als Kinderkrankheit, erlebt diese durch das Bakterium Bordetella pertussis hervorgerufene Infektionskrankheit in den letzten Jahren speziell bei Personen höheren Alters eine Renaissance. Mittlerweile ist Pertussis erwachsen geworden, besonders 40- bis 45-jährige Erwachsene sind davon betroffen. Auch in Österreich sind die Erkrankungszahlen in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dies ist einerseits bedingt durch den Verlust der Seroprotektion innerhalb weniger Jahre nach Impfung oder Durchmachen der Erkrankung selbst. Andererseits ist bei den hustenabklärenden Ärzten das Bewusstsein für den Keuchhusten gestiegen und hat zu einer verstärkten Testung geführt. Auch Pertussis kann durch eine Schutzimpfung verhindert werden. Die Vierfachimpfung bestehend aus Diphtherie, Tetanus, Polio und Pertussis sollte bis zum 65. Lebensjahr alle zehn Jahre, danach alle fünf Jahre aufgefrischt werden. <br />Pertussis beginnt zunächst mit Zeichen einer unspezifischen Atemwegsinfektion in den ersten zwei Wochen (Stadium catarrhale), gefolgt von der typischen Keuchhustensymptomatik mit paroxsysmalen Hustenattacken, Husten-assoziiertem Erbrechen, Stakkatohusten und inspiratorischen Whoop (Stadium convulsivum) in den Wochen drei bis sechs. Der Husten kann bis zu zehn Wochen oder länger anhalten, wird jedoch im Verlauf schwächer (Stadium decrementi). Eine Antibiose mit Makroliden ist bei Kindern bereits bei Verdacht indiziert, bei Erwachsenen in Gesundheitsberufen oder Kinderbetreuungseinrichtungen ist diese bis zu acht Wochen nach Hustenbeginn sinnvoll, je früher, desto besser. Pertussis ist zudem eine meldepflichtige Erkrankung. <br />Geimpft werden sollten Frauen, die eine Schwangerschaft planen, schwangere Frauen ab dem 2. Trimenon bei unbekanntem Impfstatus, Personen in Gesundheitsberufen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Personen mit großem Publikumsverkehr.</p> <h2>Therapie des postinfektiösen Hustens</h2> <p>Der postinfektiöse Husten überdauert den auslösenden, zumeist viralen Infekt um Wochen und ist fast immer selbstlimitierend. Ursächlich sind entweder ein Epithelschaden mit Freilegung der „Irritant“- Rezeptoren der Bronchialschleimhaut (häufig bei Infektionen mit Pertussis oder Mykoplasmen), eine persistierende Entzündung der Atemwegsschleimhaut oder eine vorübergehende und spontan abklingende bronchiale Hyperreagibilität. Therapeutisch stehen inhalative Kortikosteroide (bei persistierender Entzündung), eine Kombination aus inhalativen Kortikosteroiden und lang wirksamen β-Mimetika (bei bronchialer Hyperreagibilität) oder Antitussiva wie Paracodein (Pertussis, Mykoplasmen) zur Verfügung.</p> <h2>Auch an seltenere Ursachen denken</h2> <p>Tuberkulose (TBC) als eine mögliche Ursache für länger dauernden Husten sollte nicht unbeachtet bleiben und auch bei nativen Österreichern und Österreicherinnen bedacht werden. Neben Husten finden sich häufig auch Nachtschweiß oder ungewollter Gewichtsverlust innerhalb kurzer Zeit. Neben typischen röntgenologisch nachweisbaren Veränderungen der Lunge (Kavernen, Spitzenverändungen) sind eine Sputumanalyse oder eine Bronchoskopie mit ZN-Färbung, eine Mykobakterienkultur und eine PCR zum Nachweis der aktiven TBC notwendig.<br /> Bei persistierendem Husten (länger als acht Wochen) ist ein Thorax-CT zur weiteren Abklärung (Tumor, Fremdkörper, Bronchiektasen) sinnvoll. In den letzten Jahren ist durch die flächendeckende Verfügbarkeit der CT und die größere Awareness auch die Zahl von Patienten mit Husten aufgrund einer weiteren Hustenursache, nämlich jener der Bronchiektasen, deutlich angestiegen. Diese irreversible zylindrische und sackförmige Erweiterung der Bronchien ist häufig mit chronischen bakteriellen Infektionen assoziiert. Die gestörte mukoziliäre Clearance geht mit Husten und Schleimproduktion einher und ist mit einer erheblichen Morbidität verbunden. Patienten mit ausgeprägter Bronchiektasenerkrankung sollten deshalb immer an einem erfahrenen Zentrum zur weiteren Abklärung und Therapie vorgestellt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1806_Weblinks_s28_tab1.jpg" alt="" width="2150" height="1106" /></p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1806_Weblinks_s28_tab2.jpg" alt="" width="600" height="776" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Beck S et al.: DEGAM-Leitlinie Nr. 11: Husten, Stand Februar 2014 (www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/053-013. html) <strong>2</strong> Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK): Österreichischer Impfplan 2018 (www.bmgf.gv.at/impfen) <strong>3</strong> Ewig S et al.: S3-Leitlinie Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie und Prävention – Update 2016 (www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/020-020. html) <strong>4</strong> Flick H et al.: Pertussis – Klinik, Diagnostik und Therapie. Pneumologie; UIM 04/2014 <strong>5</strong> Garrastuzu R et al.: Prevalence of influenza vaccination in chronic obstructive pulmonary disease patients and impact on the risk of severe exacerbation. Arch Bronconeumol 2016; 52: 88-95 <strong>6</strong> Kardos P et al.: Leitlinie der DGP zur Diagnostik und Therapie von Erwachsenen mit akutem und chronischem Husten. Pneumologie 2010; 64: 336-73 <strong>7</strong> Poole P et al.: Cochrane Review 2010: Influenza vaccine for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2006; 1: CD002733 <strong>8</strong> Positionspapier Jänner 2016: Broncho-Vaxom-Prävention spart Antibiotika bei rezidivierenden Atemwegsinfekten <strong>9</strong> Rademacher J, Welte T: Bronchiektasen – Diagnostik und Therapie. Dtsch Arztebl Int 2011; 108: 809-15 <strong>10</strong> Reed C et al.: Estimated influenza illnesses and hospitalizations averted by vaccination – United States, 2013-14 influenza season. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014; 63: 1151-54 <strong>11</strong> Smith SM et al.: Cochrane Library – Antibiotics for acute bronchitis (Review). Cochrane Database Syst Rev 2017; 6: CD000245</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Allergologische Diagnostik von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Arzneimittel
Ungefähr 10% der Allgemeinbevölkerung berichten von unerwünschten Arzneimittelreaktionen, welche sich allerdings nur in weniger als 10% der Fälle diagnostisch verifizieren lassen. ...
Mukoviszidose – eine Erkrankung mit Prädisposition für Pilzinfektionen
Pilzinfektionen stellen eine zunehmende Herausforderung in der Behandlung von Menschen mit Mukoviszidose (zystische Fibrose) dar. Spezifische diagnostische Schritte und therapeutische ...