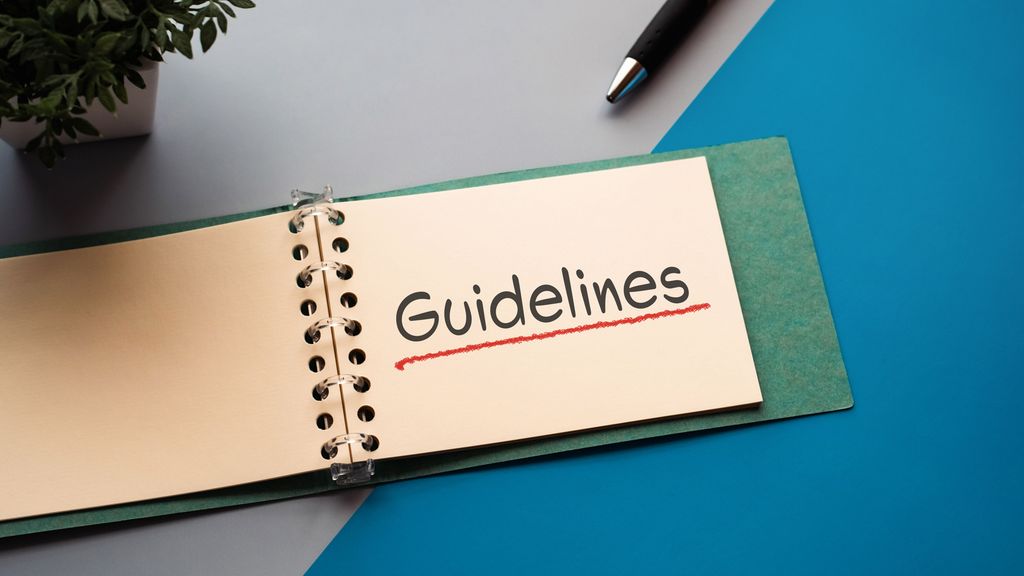
ERS-Guideline zu Bronchiektasie
Bericht:
Reno Barth
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die European Respiratory Society (ERS) hat neue Empfehlungen für das Management der Bronchiektasie erarbeitet. Eine wichtige Neuerung betrifft die klinische Schwelle, ab der von einem hohen Exazerbationsrisiko ausgegangen werden kann. Diese liegt nun bei zwei Exazerbationen oder zumindest einer schweren Exazerbation im vergangenen Jahr.
Bronchiektasen sind irreguläre Ausstülpungen eines Bronchus in das Lungengewebe. Das mit Bronchiektasen verbundene Krankheitsbild wird als Bronchiektasie bezeichnet und ist charakterisiert durch eine Teufelsspirale aus mechanischem Lungenschaden (Bronchiektasen), Inflammation, Infektion und dysfunktionalem Epithel. Das Management der Bronchiektasie muss folglich auf diese vier Komponenten fokussieren, so Prof. Dr. Stefano Aliberti, Universität Mailand.
Empfehlungen dazu wurden 2025 von der European Respiratory Society (ERS) anhand von acht PICO-Fragen („patient“, „intervention“, „comparison“, „outcome“) und drei narrativen Fragen erstellt. Die Fragen behandeln die Ursachen von Bronchiektasie, die Therapie sowie das Management von Exazerbationen und die Progression der Erkrankung. Die Empfehlungen beziehen sich zum einen auf nichtmedikamentöse und zum anderen auf medikamentöse Maßnahmen.
Vor Behandlungsbeginn das Risiko abschätzen
Empfohlen wird, bei allen Patienten mit neu diagnostizierter Bronchiektasie zunächst eine Evaluation mit dem Bronchiectasis Severity Index vorzunehmen, um das Risiko für zukünftige Komplikationen abschätzen zu können. Bei hohem Risiko werden engmaschigeres Follow-up und niederschwellige Behandlung empfohlen. Krankheitsursache, Komorbiditäten, Krankheitsaktivität und „treatable traits“ sollen nicht nur bei Erstdiagnose, sondern auch bei allen folgenden Visiten evaluiert werden.
Airway-Clearance-Techniken (ACT) stellen die wichtigsten nichtmedikamentösen Maßnahmen im Management der Bronchiektasie dar. Aliberti: „Airway-Clearance ist leicht zu erlernen und damit überall verfügbar, kostengünstig und bei den Patienten beliebt.“ Obwohl zur Airway-Clearance nur relativ schwache Evidenz verfügbar ist, wurde seitens der Taskforce eine starke Empfehlung abgegeben. Es gibt keine Hinweise, dass von den unterschiedlichen im Einsatz befindlichen Techniken eine ACT besser wäre als die anderen. Das Training sollte von spezialisierten Physiotherapeuten gestaltet werden. Angesichts widersprüchlicher Daten wird lediglich eine sehr vorsichtige Empfehlung für den Einsatz mukoaktiver Medikamente bei Versagen von ACT gegeben. Eine starke Empfehlung gibt es hingegen für den Einsatz pulmonaler Rehabilitation für Patienten mit Atemproblemen oder eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Aliberti betonte, dass zahlreiche, jedoch nicht alle Studien bei Patienten mit Bronchiektasie deutliche Verbesserungen der Leistungsfähigkeit durch regelmäßiges Training zeigen.
Bei unzureichendem Therapieerfolg: zurück zum Start
Eine Exazerbation liegt vor, wenn eine Verschlechterung der Symptome eintritt, die über die normale Tagesvariabilität hinausgeht. Als schwer wird eine Exazerbation eingestuft, wenn sie eine Hospitalisierung und/oder die intravenöse Anwendung von Antibiotika erforderlich macht. Vor Beginn einer antibiotischen Therapie sollte eine Sputumprobe genommen werden. Bringt die Behandlung nicht den gewünschten Erfolg, so soll die Sputumkultur wiederholt und die Therapie reevaluiert werden. Eine Therapie über zwei Wochen gilt als Standard, kann bei gutem Ansprechen und in leichten Fällen jedoch verkürzt werden. Ein Selbstmanagementplan sollte mit dem Patienten entwickelt werden, damit im Falle einer Exazerbation die notwendigen Schritte möglichst früh und vom Patienten selbst eingeleitet werden können.
Pharmakologische Therapie und Exazerbationen
Die pharmakologische Therapie betreffend besteht eine starke Empfehlung für inhalative Antibiotika für Patienten mit hohem Exazerbationsrisiko und chronischer Infektion mit Pseudomonas aeruginosa. Auch bei Infektionen mit anderen Keimen werden inhalative Antibiotika empfohlen, dies jedoch lediglich mit bedingtem Empfehlungsgrad. „Das liegt daran, dass sich die Daten, die wir zur inhalativen Antibiotikatherapie haben, fast zur Gänze auf Pseudomonas aeruginosa beziehen“, erläuterte Prof. Dr. James D. Chalmers, University of Dundee.
Die Diagnose eines hohen Exazerbationsrisikos kann anhand der aktuellen Guidelines leichter gestellt werden als zuvor (Abb.1). Von einem hohen Risiko kann nun ausgegangen werden, wenn der Patient im vergangenen Jahr zwei Exazerbationen oder zumindest eine schwere Exazerbation durchgemacht hat. Auch bei einer Exazerbation und täglichen Symptomen kann von einem hohen Exazerbationsrisiko ausgegangen werden. Inhalative Antibiotika sollten für eine definierte Zeitspanne verschrieben und bei mangelndem Therapieerfolg auch wieder abgesetzt werden. Die Empfehlung für inhalative Antibiotika beruht auf insgesamt 13 Studien, in denen eine Reduktion der Exazerbationsrate von durchschnittlich 20% erreicht wurde. Der Effekt auf schwere Exazerbationen war noch deutlicher.
Abb. 1: ERS-Algorithmus für die Langzeitbehandlung mit Antibiotika bei Patienten mit Bronchiektasie (modifiziert nach Chalmers JD et al. 2025)1
Einsatz von Makroliden
Makrolide sollen wegen ihrer antiinflammatorischen Effekte bei Patienten mit hohem Exazerbationsrisiko eingesetzt werden. Chalmers betonte, dass die Wirkung von Makroliden keine bakterielle Infektion voraussetzt, da die antiinflammatorische Wirkung nicht von der antibiotischen Wirkung abhängig ist. Makrolide sollten bei Patienten, die mit nichttuberkulösen Mykobakterien infiziert sind, nicht als Monotherapie eingesetzt werden. Das am häufigsten verwendete Makrolid ist Azithromycin.
Aufgrund möglicher Nebenwirkungen sind Patientenedukation, Abklärung auf Risikofaktoren und langfristiges Follow-up erforderlich. Die Evidenz für Makrolide ist stark, so Chalmers. Eine Metaanalyse der verfügbaren Studien zeigt eine Reduktion der Exazerbationsrate um rund die Hälfte. Aufgrund des Nebenwirkungsprofils sollten Makrolide aber nur bei Patienten eingesetzt werden, die trotz ACT exazerbieren. Orale Antibiotika außerhalb der Gruppe der Makrolide sollen mangels Evidenz nicht als First-Line-Therapie bzw. am besten gar nicht eingesetzt werden, es gebe jedoch Situationen, so Chalmers, in denen dies nicht zu vermeiden sei.
Nach einer Erstdiagnose einer Infektion mit Pseudomonas aeruginosa wird ein Eradikationsversuch empfohlen. Für andere Pathogene fehlen die Daten und eine Eradikation kann folglich nicht empfohlen werden. Die Evidenz ist auch für P. aeruginosa dünn. Da man aber um die ungünstigen Konsequenzen einer Infektion wisse, sollte man versuchen, den Keim loszuwerden, wenn das irgendwie möglich sei, so Chalmers. Regime zur Eradikation inkludieren intravenöse, orale und inhalative Antibiotika. Es gibt keine Studienevidenz, die Vorteile für eines der Regime gegenüber den anderen zeigt.
Inhalative Kortikosteroide sind keine geeignete Therapie
Inhalative Kortikosteroide (ICS) sollen bei Patienten mit Bronchiektasie nicht eingesetzt werden, sofern kein komorbides Asthma bzw. keine komorbide COPD besteht, das dies erforderlich macht. Eine Abklärung auf Asthma und/oder COPD wird generell empfohlen, da diese beiden Erkrankungen nicht selten mit Bronchiektasen vergesellschaftet sind. Keinesfalls sollen wegen einer komorbiden Bronchiektasie den Asthmapatienten ICS vorenthalten werden. Chalmers hält es für möglich, dass in Zukunft eine Subgruppe von Patienten mit eosinophiler Bronchiektasie definiert werden könnte, für die sich ICS als Therapie anbieten würden. Aktuell kann jedoch keine entsprechende Empfehlung gegeben werden, da in den drei verfügbaren Studien mit nicht selektionierten Bronchiektasiepopulationen ICS keinen Vorteil brachten und mit vermehrten unerwünschten Wirkungen assoziiert waren.
Klinische Verschlechterung erfordert rasche Intervention
Eine spezielle Population stellen Patienten mit rascher Verschlechterung ihrer Symptomatik dar. Den empfohlenen Umgang mit diesen Patienten umschreibt die Guideline mit dem Akronym RAPID („recognise and refer“, „assess“, „perform“, „initiate“, „deal with complications“). Eine klinische Verschlechterung liegt vor, wenn die Zahl der Exazerbationen zu- und/oder die Lungenfunktion abnimmt. In solchen Situationen ist rasches Handeln gefragt. Insbesondere müssen sowohl die laufende Therapie als u.U. auch die Diagnose hinterfragt werden. Zu evaluieren ist dabei nicht zuletzt auch die Adhärenz des Patienten. Auch an neu aufgetretene Komorbiditäten ist zu denken. CT-Scan und Sputumkultur sollten wiederholt werden. Der Patient sollte an ein spezialisiertes Zentrum überwiesen werden, wenn er nicht bereits in einem solchen Zentrum behandelt wird. In ausgewählten Fällen kann eine Lungenresektion angebracht sein, bei ausgeprägter Progression sollte frühzeitig Kontakt mit einem Transplantationszentrum aufgenommen werden.
Quelle:
Session „Management of bronchiectasis in adults“; ERS Congress, 29. September 2025
Literatur:
1 Chalmers JD et al.: Eur Respir J 2025. https://publications.ersnet.org//content/erj/early/2025/09/18/13993003.01126-2025.full.pdf ; zuletzt aufgerufen am 30.9. 2025
Das könnte Sie auch interessieren:
Nichttuberkulöse Mykobakterien (NTM): Klinik, Diagnose und Therapie
Infektionen mit nichttuberkulösen Mykobakterien nehmen global signifikant zu. Die Unterscheidung von Kolonisation, transienter Infektion und NTM-Erkrankung kann klinisch sehr schwierig ...
Innovative Pharmakotherapien bei ILD
Derzeit befinden sich mehrere Wirkstoffe für die Behandlung von idiopathischer pulmonaler Fibrose (IPF) und progredienter pulmonaler Fibrose (PPF) in der Entwicklung, wobei verschiedene ...


