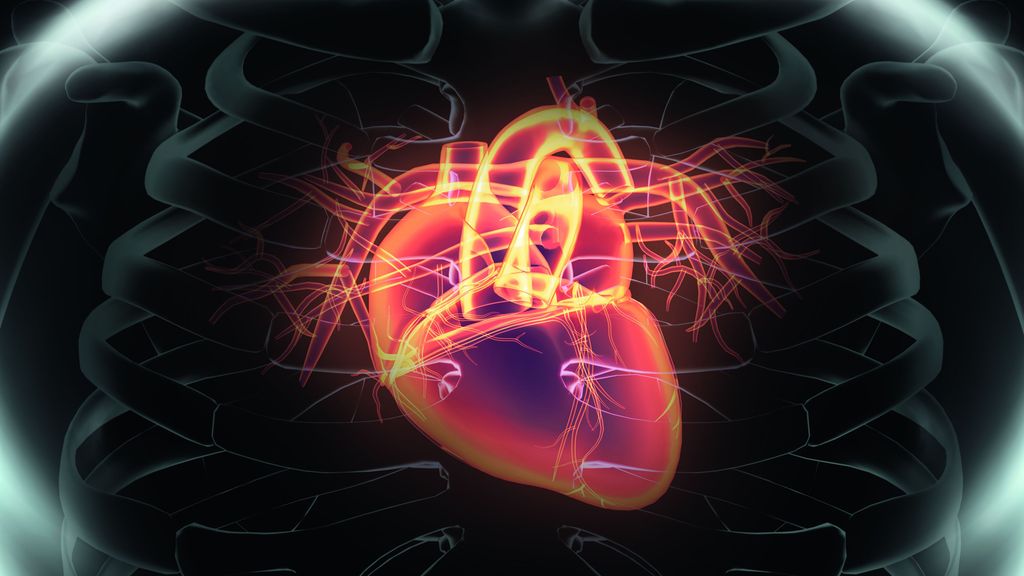
©
Getty Images/iStockphoto
Venenstenting: neue Optionen in der Behandlung der Venenthrombose und des postthrombotischen Syndroms
Jatros
Autor:
Assoc. Prof. Priv-Doz. Dr. Oliver Schlager
Klinische Abteilung für Angiologie<br> Universitätsklinik für Innere Medizin II<br> Medizinische Universität Wien<br> E-Mail: oliver.schlager@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
19.12.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Moderne Thrombektomiesysteme und spezielle Venenstents ermöglichen die interventionelle Behandlung der akuten Beckenvenenthrombose sowie chronischer thrombotischer und nichtthrombotischer Venenverschlüsse. Neben einer sorgfältigen gefäßmedizinischen Abklärung und einer die individuellen Läsionscharakteristika berücksichtigenden Indikationsstellung sind die Expertise in der Intervention iliocavaler Läsionen und das entsprechende Equipment notwendige Voraussetzungen für diese Therapieoption.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Bei akuter Beckenvenenthrombose sollte bei jungen Patienten mit niedrigem Blutungsrisiko eine endovaskuläre Behandlung in Erwägung gezogen werden, um das Risiko für ein späteres postthrombotisches Syndrom zu reduzieren.</li> <li>Chronische iliocavale und iliofemorale Verschlüsse sollten bei klinisch relevanter venöser Hypertension endovaskulär</li> <li>Für die endovaskuläre Rekanalisation akuter oder chronischer iliocavaler und iliofemoraler Läsionen bedarf es entsprechender Expertise, Material (geeignete Ballonkatheter, Thrombektomie- und Stentsysteme) sowie der Möglichkeit engmaschiger duplexsonografischer Nachkontrollen.</li> </ul> </div> <h2>Akute Venenthrombose</h2> <p>Das primäre Therapieziel der endovaskulären Behandlung der tiefen (Becken-) Venenthrombose ist neben der raschen Beschwerdereduktion vor allem die Reduktion des Risikos einer Chronifizierung der Thrombose mit einer Entwicklung eines postthrombotischen Syndroms (PTS). Dieses Bestreben ist klar vom Ziel der oralen Antikoagulation nach Venenthrombose abzugrenzen, welche die Thromboseprogression sowie das Thromboserezidiv verhindern soll. Aufgrund der unterschiedlichen Therapieziele sollten medikamentöse und interventionelle Therapie nicht als konkurrierende Therapieansätze, sondern als einander potenziell ergänzende Therapieoptionen bei Patienten mit akuter Venenthrombose gesehen werden. Bei der Indikationsstellung zur interventionellen Therapie sind die Anamnesedauer (< 14 Tage) und die Thromboselokalisation (Abb. 1) ausschlaggebend: Von einer interventionellen Behandlung profitieren in erster Linie Patienten mit deszendierender iliofemoraler Thrombose. Bei iliofemoraler Thrombose liegt häufig ein hämodynamisches Hindernis (Beckenvenenkompression/- stenose, Hypoplasie der V. cava inferior oder des Cava-Confluens) als mechanischer Risikofaktor vor.<sup>1</sup> Im Rahmen einer interventionellen Behandlung können zugrunde liegende Obstruktionen mittels Stenting beseitigt werden.<br /> Zudem werden bei iliakalen Thrombosen unter konservativer Therapie deutlich niedrigere Rekanalisationsraten beobachtet als bei femoropoplitealen Thrombosen, was – nach iliakaler Thrombose – im höheren Risiko für die Entwicklung eines PTS resultiert (Abb. 2).<sup>2</sup> Das erklärt, warum in erster Linie Patienten mit Beckenvenenthrombose von einer interventionellen Behandlung (deren Ziel die Reduktion des PTS-Risikos ist) profitieren.<br /> Die Datenlage zur interventionellen Behandlung der akuten Venenthrombose ist kontroversiell: In drei randomisiert kontrollierten Studien wurde bei Patienten mit akuter Venenthrombose ein Vorteil der endovaskulären Behandlung beschrieben. <sup>3–5</sup> Hingegen konnten die Autoren der zuletzt veröffentlichten ATTRACT-Studie – in einer binären Endpunktauswertung (PTS versus kein PTS) – keinen Vorteil einer Intervention hinsichtlich der Reduktion des Risikos für eine PTS-Entwicklung feststellen.<sup>6</sup> Die ATTRACT-Ergebnisse sollten jedoch in Hinblick auf folgende Kritikpunkte kritisch interpretiert werden: Aufgrund des zögerlichen Patienteneinschlusses wurde in dieser Studie ein gemischtes Patientenkollektiv (iliofemorale und femoropopliteale Thrombosen) zugelassen. Für die Diagnostik der den Thrombosen zugrunde liegenden Stenosen wurde kein intravaskulärer Ultraschall (IVUS) eingesetzt, obwohl der IVUS – gerade in dieser Indikation – der alleinigen Katheterangiografie deutlich überlegen ist. Das resultiert in einem Unterschätzen des Stentbedarfs – die Stentrate in der ATTRACT-Studie war mit 28 % auffallend niedrig. Des Weiteren wurden bei ca. 50 % der Studienpatienten arterielle Stents anstatt geeigneter Venenstents verwendet. Ob dieses Vorgehen die Offenheit der behandelten Gefäße im Rahmen der Studie beeinflusst hat, kann leider mangels duplexsonografischer Studiendaten nicht beurteilt werden.<br /> Eine rezent publizierte Subgruppenanalyse der ATTRACT-Daten (Patienten mit iliofemoraler Thrombose) bestätigt jedenfalls, dass die interventionelle Behandlung der akuten Beckenvenenthrombose den PTS-Schweregrad reduziert. Insbesondere wird das Risiko für die Entwicklung eines schweren PTS gesenkt. Bei jungen Patienten mit kurzer Anamnesedauer (< 14 Tage) sollte daher bei Vorliegen einer deszendierenden Beckenvenenthrombose eine interventionelle Behandlung an einem erfahrenen Zentrum in Erwägung gezogen werden.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Kardio_1905_Weblinks_s16_abb1.jpg" alt="" width="1041" height="620" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Kardio_1905_Weblinks_s16_abb2.jpg" alt="" width="1041" height="876" /></p> <p> </p> <p> </p> <h2>Postthrombotisches Syndrom (PTS) und nichtthrombotische iliakale Venenläsionen (NIVL)</h2> <p>Nach einer Venenthrombose entwickeln (unter konservativer Therapie) 20 bis 50 % der Patienten ein PTS. Insbesondere nach Beckenvenenthrombose besteht ein hohes Risiko für die Entstehung eines klinisch relevanten PTS. Ein chronischer Verschluss der Beckenvenen oder der V. cava inferior resultiert im betroffenen Bein in venöser Hypertension, die in weiterer Folge zu venöser Claudicatio, varikösen Kollateralvenenkreisläufen und trophischen Hautveränderungen bis hin zu Ulzerationen führen kann. Gerade bei jungen Patienten kann bereits eine venöse Claudicatio eine maßgebliche Einschränkung der Lebensqualität bedeuten. Neben dem durch das chronische Beschwerdebild verursachten Verlust an Lebensqualität hat das PTS auch sozioökonomische Folgen: US-amerikanische Berechnungen zeigen, dass ein PTS mit jährlichen Gesundheitskosten von circa USD 7000 verbunden ist.<sup>7</sup><br /> Insbesondere bei proximalen (iliofemoralen und iliocavalen) Verschlüssen kann durch konservative Therapiemaßnahmen oft nur eine geringe Beschwerdereduktion erreicht werden. Die endovaskuläre Rekanalisation ermöglicht eine effiziente Reduktion der zugrunde liegenden venösen Hypertension (Abb. 3). In großteils kleineren Single-Center-Studien konnten zufriedenstellende morphologische und klinische Ergebnisse durch die endovaskuläre Rekanalisation mit modernen Venenstents gezeigt werden. Bestätigt werden diese Resultate durch die ersten Ergebnisse zweier größerer US-amerikanischer multizentrischer Studien (VIRTUS Trial und VERNACULAR Trial), die dieses Jahr erstmals auf Kongressen präsentiert wurden (noch nicht publiziert). Die präsentierten 24-Monats-Ergebnisse des VERNACULAR Trial bestätigen eine primäre Stentoffenheitsrate von 84 % und eine deutliche Reduktion des PTS-Schweregrades nach Beckenvenenstenting. Auffallend ist jedoch, dass sich die VERNACULAR-Studie mit einer mittleren Läsionslänge von 68 mm und einer mittleren Stentanzahl von 1,3 (pro Patient) von den „Real world“- Gegebenheiten deutlich unterscheidet. Gerade bei schwerem PTS und ausgedehnten iliofemoralen oder iliocavalen Läsionen ist in der Regel ein längerstreckiges Stenting der betroffenen Gefäßsegmente erforderlich. Eine Stentverlängerung über das Leistenband nach distal/peripher wurde in der VERNACULAR-Studie in nur 10 % der Fälle durchgeführt, ist jedoch in der klinischen Routine bei einem Großteil der Fälle für eine anhaltende Stentoffenheit unumgänglich.<br /> Kürzere Stentlängen sind meist nur bei Patienten mit nichtthrombotischen iliakalen Venenläsionen (NIVL) möglich. Bei typischer Lokalisation wird der NIVL auch als May-Thurner-Anatomie – bzw. bei entsprechender Klinik – als May-Thurner- Syndrom (MTS) bezeichnet. Bei einem MTS liegt eine Kompression der linken V. iliaca communis zwischen der rechten A. iliaca communis und der Lendenwirbelsäule vor. Neben dieser typischen Kompressionslokalisation existieren auch atypische Kompressionspunkte im Bereich der proximalen rechten V. iliaca communis sowie beidseits im Bereich der V. iliaca communis und V. iliaca externa weiter peripher/ distal. Auch NIVL können den Blutrückfluss aus der betroffenen Extremität einschränken und somit zur venösen Hypertension im betroffenen Bein führen. Die endovaskuläre Behandlung von NIVL ist technisch einfacher und mit einer höheren Offenheitsrate nach Stenting verbunden.<br /> Alle bisherigen Studien zum Stenting von PTS- oder MTS-Läsionen verdeutlichen den Stellenwert moderner Venenstents. Venöse Stents zeichnen sich vor allem durch eine hohe „radial resistive force“, eine „crush resistance“ und eine entsprechende Flexibilität aus. Für unterschiedliche anatomische Segmente (V. cava inferior, V. iliaca communis, V. iliaca externa und V. femoralis communis) stehen mittlerweile verschiedene Stents mit unterschiedlichen biomechanischen Eigenschaften zur Verfügung (Abb. 4). Trotzdem sind derzeit nur Beobachtungsstudien ohne Vergleichsgruppe verfügbar, sodass es einen klaren Bedarf an prospektiv kontrollierten Studien zur endovaskulären Behandlung von Patienten mit PTS und MTS gibt.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Kardio_1905_Weblinks_s16_abb3.jpg" alt="" width="1042" height="852" /></p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Kardio_1905_Weblinks_s16_abb4.jpg" alt="" width="1560" height="512" /></p> <p> </p> <h2>Antithrombotische Therapie</h2> <p>Auch zur antithrombotischen Therapie nach Venenstenting gibt es kaum Evidenz. Eine 2018 publizierte britische Untersuchung zeigt eine große Diversität der eingesetzten antithrombotischen Therapieregimes nach Venenstenting. In den in Bezug auf Venenstenting erfahrenen Gefäßzentren wird meist initial eine therapeutische Antikoagulation mit niedermolekularem Heparin durchgeführt, welche nach 2–4 Wochen auf eine orale Antikoagulation umgestellt wird. Der Stellenwert einer zusätzlichen (einfachen) plättchenfunktionshemmenden Therapie wird in zukünftigen Studien untersucht werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Chung JW et al.: Acute iliofemoral deep vein thrombosis: evaluation of underlying anatomic abnormalities by spiral CT venography. J Vasc Interv Radiol 2004; 15: 249-56<strong> 2</strong> Rosfors S et al.: A prospective follow-up study of acute deep venous thrombosis using colour duplex ultrasound, phlebography and venous occlusion plethysmography. Int Angiol 1997; 16: 39-44 <strong>3</strong> Elsharawy M, Elzayat E: Early results of thrombolysis vs anticoagulation in iliofemoral venous thrombosis. A randomised clinical trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002; 24: 209-14 <strong>4</strong> Enden T et al.: Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial. Lancet 2012; 379: 31-8 <strong>5</strong> Sharifi M et al.: Endovenous therapy for deep venous thrombosis: the TORPEDO trial. Catheter Cardiovasc Interv 2010; 76: 316-25 <strong>6</strong> Vedantham S et al.: Pharmacomechanical catheter-directed thrombolysis for deep-vein thrombosis. N Engl J Med 2017; 377: 2240-52 <strong>7</strong> Kahn SR et al.: The postthrombotic syndrome: evidence-based prevention, diagnosis, and treatment strategies: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2014; 130: 1636-61</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Funktionsstörung des Myokards: wenn die Entspannung des Herzens gestört ist
Die hypertropheobstruktive Kardiomyopathie (HOCM) ist dadurch charakterisiert, dass die Entspannung des Myokards funktionsgestört ist. Die Folge ist eine zunehmende Verdickung der ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...


