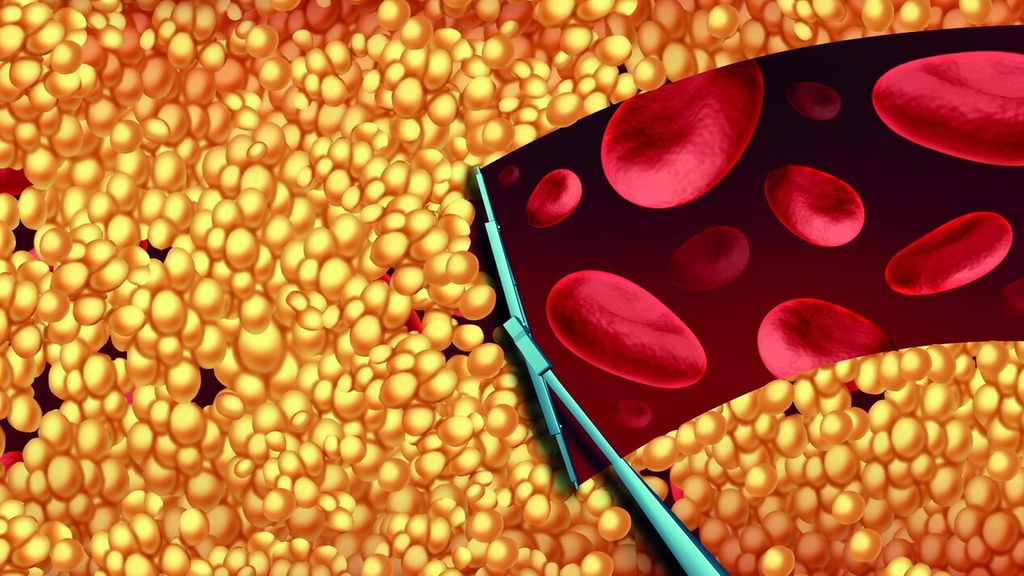
©
Getty Images/iStockphoto
Trikuspidalinsuffizienz – komplexer Problematik auf der Spur
Jatros
30
Min. Lesezeit
24.05.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der Trikuspidalklappe wird in jeder Hinsicht weniger Aufmerksamkeit geschenkt als den Klappen des linken Herzens. Dennoch ist ihre Insuffizienz häufig und für die Betroffenen folgenschwer. Chirurgische Korrekturen sind schwierig und nicht ohne Risiken.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Ursachen und Prognosefaktoren</h2> <p>Eine Trikuspidalinsuffizienz (TI) kann, so Univ.-Prof. Dr. Gerhard Pölzl von der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin III, funktioneller oder organischer Natur sein. Als Ursachen der organischen TI kommen unter anderem rheumatische Klappenerkrankungen oder eine Endokarditis und nicht zuletzt iatrogene Ursachen wie ein Prolaps infrage. Funktionell kann sich eine TI sowohl infolge eines Lungenhochdrucks als auch einer Erkrankung des linken Herzens einstellen. Häufig tritt sie gemeinsam mit einer Insuffizienz der Mitralklappe auf. Auch Vorhofflimmern kann zur TI führen. Nicht zuletzt iatrogene Ursachen wie beispielsweise Bestrahlung oder Probleme mit Schrittmacher- oder Defibrillator-Sonden. Funktionelle Ursachen sind bei TI weit häufiger als organische. Eine schwere TI führt in weiterer Folge zu einem Teufelskreis. Sie bewirkt eine Verschiebung des Blutvolumens zwischen rechtem Vorhof und rechtem Ventrikel, was zu einer weiteren Dilatation des rechten Ventrikels und einer Verschlechterung der Erkrankung führt.<br /> Die Trikuspidalinsuffizienz hat Einfluss auf die Mortalität. Die Details sind allerdings noch unklar. In einer 2004 publizierten großen Kohortenstudie erwies sich TI als unabhängiger negativer Prognosefaktor.<sup>1</sup> Eine fast zehn Jahre später publizierte Arbeit fand diesen Effekt nur noch bei Patienten mit leichter Herzinsuffizienz, während bei schwerer Herzinsuffizienz die TI keinen zusätzlichen Beitrag zur ohnedies hohen Mortalität mehr leistete.<sup>2</sup> Pölzl: „Bei Patienten mit einer weitgehend normalen Funktion des linken Ventrikels spielt die Insuffizienz der Trikuspidalklappe eine entscheidende Rolle für das Überleben.“ Leider hat sich mittlerweile auch gezeigt, dass die chirurgische Korrektur einer Linksherzpathologie (insbesondere der Mitralinsuffizienz) die TI nicht verhindern kann.<sup>3</sup></p> <h2>Korrekturen an der Trikuspidalklappe</h2> <p>Operative Korrekturen an der Trikuspidalklappe sind möglich, jedoch mit Schwierigkeiten und Risiken verbunden. Dies liege, so Pölzl, vornehmlich an den im Vergleich zur Mitralklappe komplizierteren anatomischen Verhältnissen: „Bei der Trikuspidalklappe ist nur das septale Segel an einem relativ festen Ring, nämlich am septalen Ring, fixiert. Hier ist eine gewisse Stabilität gegeben.“ Im Gegensatz dazu ist die Ventrikelwand im Bereich des vorderen und zum Teil auch des hinteren Segels relativ weich und instabil, sodass hier die Gefahr einer Überdehnung besteht. Daher tritt die Ringdilatation an der Trikuspidalklappe vorwiegend im anterolateralen Bereich auf. Doch auch andere Mechanismen der TI sind bekannt. Pölzl: „Mit zunehmender Überdehnung und Funktionseinschränkung des rechten Ventrikels kommt es zu einer Verlagerung der Papillarmuskeln nach kaudal und nach außen. Das bewirkt einen vermehrten Zug auf die Klappe und damit eine Störung der Koadaptation.“</p> <h2>Progrediente Erkrankung</h2> <p>Die Trikuspidalinsuffizienz entwickelt sich stadienhaft. Im Stadium 1 tritt eine leichte Ringdilatation auf. Im Stadium 2 kommen zunehmende Überdehnung des rechten Ventrikels und Koadaptationsstörung der Klappensegel hinzu, die Ringdilatation nimmt zu. Schließlich kommt es zur Restriktion am subvalvulären Apparat der Klappe („tethering“). Entschließt man sich zu einem Eingriff, muss das Timing dem Stadium der Klappenerkrankung entsprechen. Der Schweregrad der Insuffizienz alleine liefert dafür keine ausreichenden Informationen. Ringdilatation und Koadaptationsstörung müssen bei der Entscheidungsfindung einbezogen werden. So bedeutet das Stadium 2 mit Ringdilatation und Koadaptationsstörung eine Indikation für die Anuloplastie, während im Stadium 3 neben der Anuloplastie eine Reparatur der Segel vorgenommen werden muss. Kohortendaten der vergangenen Jahre zeigen im Zusammenhang mit Operationen an der Trikuspidalklappe eine nicht zu unterschätzende Mortalität. Die „In-hospital“-Mortalität lag bei 8,8 % , ohne dass über die Jahre eine Verbesserung festgestellt wurde. Die Studie fand allerdings eine steigende Zahl von Eingriffen.<sup>4</sup> Pölzl weist allerdings darauf hin, dass die hohe Sterblichkeit wesentlich von den Patienten getriggert wird, bei denen die Trikuspidalklappe in einem Sekundäreingriff in der Folge einer Operation am linken Herzen angegangen wird. Einen Algorithmus für die operative Therapie der Trikuspidalklappe liefert die ESC/ EACTS-Leitlinie zum Management von Klappenerkrankungen, wobei die Evidenz für Eingriffe an der Trikuspidalklappe generell niedrig ist.<sup>5</sup> Interventionelle Antworten auf die TI sind in Arbeit, mehrere Systeme werden untersucht, mangels adäquater Studiendaten gibt es allerdings derzeit noch keine Empfehlungen. Auch den MitraClip kann man, so Pölzl, an der Trikuspidalklappe anwenden.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 4. Hauptsitzung des 20. Kardiologie-Kongresses Innsbruck, 9. März 2018, Innsbruck
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Nath J et al.: J Am Coll Cardiol 2004; 43(3): 405-9 <strong>2</strong> Neuhold S et al.: Eur Heart J 2013; 34(11): 844-52 <strong>3</strong> Kammerlander AA et al.: J Am Coll Cardiol 2014; 64(24): 2633-42 <strong>4</strong> Zack CJ et al.: J Am Coll Cardiol 2017; 70(24): 2953-60 <strong>5</strong> Baumgartner H et al.: Eur Heart J 2017; 38(36): 2739-91</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Funktionsstörung des Myokards: wenn die Entspannung des Herzens gestört ist
Die hypertropheobstruktive Kardiomyopathie (HOCM) ist dadurch charakterisiert, dass die Entspannung des Myokards funktionsgestört ist. Die Folge ist eine zunehmende Verdickung der ...
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...


