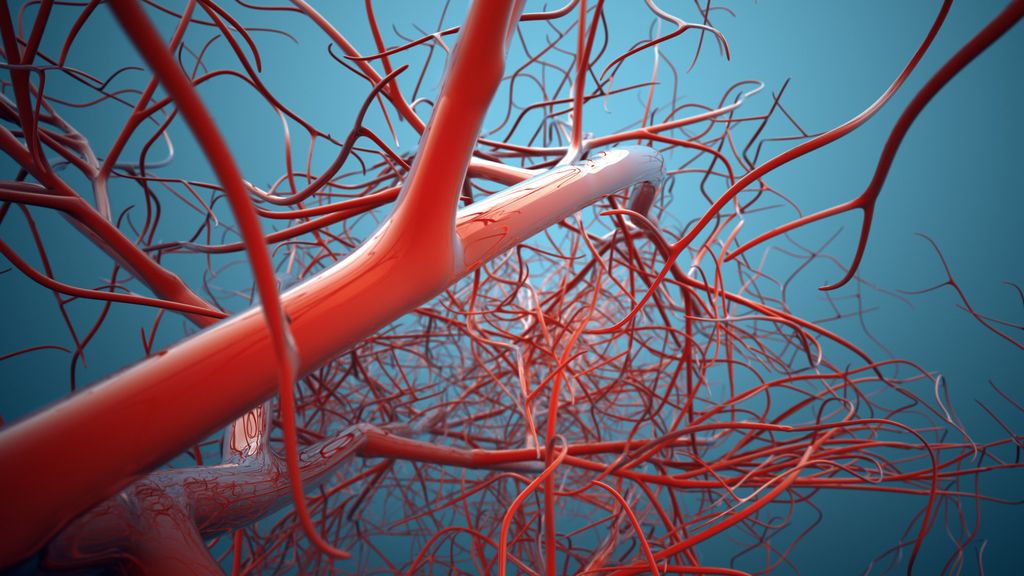
©
Getty Images
Neurochirurgen-Treffen in Magdeburg
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
29.06.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Wie tiefe Hirnstimulation bei schweren Zwangserkrankungen helfen kann, jüngste Erkenntnisse zum Schädel-Hirn-Trauma und neue Methoden in der Therapie von Fehlbildungen der Hirngefässe waren Themen bei der 68. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) im Mai.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Wenn Ordnung das Leben beherrscht</h2> <p>Ständiges Händewaschen, Gegenstände nach einem bestimmten Muster anordnen, Worte wiederholen – solche Rituale und Zwangshandlungen sind typische Symptome einer Zwangsstörung. Zwangserkrankungen sind charakterisiert durch die Kombination aus einer Zwangsvorstellung (nicht zu unterdrückende Gedanken, Impulse) und einer Zwangshandlung als Antwort darauf – mit dem Ziel, die Zwangsvorstellung zu unterdrücken oder zu neutralisieren.</p> <p>«Krankhafte Zwänge beeinträchtigen den Alltag der Betroffenen – die Berufsausübung, allgemeine soziale Aktivitäten oder partnerschaftliche Beziehungen – in erheblichem Umfang. Sie gehen oft einher mit Angstzuständen und Stress. Viele Patienten leiden zudem unter schweren Depressionen», sagt Prof. Dr. med. Jürgen Voges, Direktor der Universitätsklinik für Stereotaktische Neurochirurgie am Universitätsklinikum Magdeburg. Um die Symptome einer schweren Zwangserkrankung zu verbessern, werden die Betroffenen zunächst medikamentös und mit kognitiver Verhaltenstherapie behandelt. Bei 40–60 % der Patienten bleiben bei dieser Art der Therapie jedoch Restsymptome zurück; 20–30 % reagieren gar nicht auf die Behandlung. Die tiefe Hirnstimulation (THS) kann eine Alternative darstellen. Bei Morbus Parkinson, Dystonie und Tremor wird sie schon seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eingesetzt. Seit einigen Jahren wird die THS auch in der Behandlung von schweren Zwangserkrankungen angewendet. «In einem stereotaktisch-neurochirurgischen Eingriff werden dünne Elektroden ins basale Vorderhirn eingeführt und an einen Impulsgeber angeschlossen, der unter die Haut implantiert wird», erklärt Voges. Durch kontinuierliche elektrische Stimulierung werden diejenigen zerebralen Netzwerke beeinflusst, die für Entscheidungsfindung, Gefühle und Emotionen zuständig sind und deren Funktion aufgrund der Erkrankung bei diesen Patienten verändert ist.</p> <p>Aktuell kann die THS die Symptome der schweren Zwangserkrankung zwar nicht in jedem Fall vollkommen unterbinden, sie aber häufig lindern. «Bei mehr als der Hälfte der Patienten wurde eine Reduktion des Schweregrades um mindestens 35 % festgestellt», so Voges. Einhergehend mit der Reduktion der Zwangssymptome traten bei den Betroffenen auch weniger Angststörungen und Depressionen auf. Verhaltenstherapien – auch wenn sie bei den Patienten zuvor nicht anschlugen – können das Gesamtergebnis zusätzlich deutlich verbessern, wenn sie zeitgleich mit der Behandlung der THS durchgeführt werden.<sup>1</sup></p> <p>Nach Abstellen des Impulsgebers treten die Symptome innerhalb kürzester Zeit wieder auf, d.h., die THS verändert nicht grundlegend die Funktion neuronaler Netzwerke, sie wirkt lediglich neuromodulativ.</p> <h2>Funktionsstörung des Hirnstamms löst Koma aus</h2> <p>Mithilfe der Kernspintomografie ist es heute möglich, zu untersuchen, welche Anteile des Gehirns einen Funktionsausfall haben, wenn ein Patient nach einem Schädel-Hirn-Trauma bewusstlos ist. Wie es zur Bewusstlosigkeit kommt, war lange Zeit unklar. Früher nahm man an, dass durch den Aufprall Nervenfasern zerreissen, die vom Hirnstamm zur Hirnrinde verlaufen. Die Kernspintomografie hat zu neuen Erkenntnissen geführt. «Wir vermuten, dass die Bewusstlosigkeit Folge einer Funktionsstörung im Hirnstamm ist», berichtet Prof. Dr. med. Raimund Firsching, Direktor der Universitätsklinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Magdeburg. Bei einer mehr als 24 Stunden andauernden posttraumatischen Bewusstlosigkeit konnte ein Zusammenhang mit einer morphologischen Hirnstammbeteiligung statistisch nachgewiesen werden.<sup>2</sup> Nach acht Tagen anhaltender Bewusstlosigkeit waren in allen Fällen Veränderungen am Hirnstamm erkennbar (Abb. 1). «Diese Ergebnisse widersprechen früheren neuropathologischen Daten aus Zeiten, zu denen keine Kernspintomografie verfügbar war», so Firsching. Die neuen Erkenntnisse sind für die Behandlung des Schädel-Hirn-Traumas von grosser Bedeutung: Sie sprechen dafür, bei akuter Bewusstlosigkeit baldmöglichst eine Computertomografie durchzuführen, um Einengungen im Bereich des Hirnstammes rechtzeitig diagnostizieren zu können. «In diesem Fall entscheiden wir uns frühzeitig für eine Operation, um den Hirnstamm zu entlasten», so Firsching.</p> <h2>Hirngefässaneurysma: endovaskulär versus operativ</h2> <p>Das Gebiet der vaskulären Neurochirurgie (Hirngefässchirurgie) ist ein grosser und ständig wachsender Bereich der Neurochirurgie und daher auch Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Forschung. Zwei wissenschaftliche Studien zum Thema der Hirngefässaneurysmen sind für Prof. Dr. med. Volker Seifert, Universitätsklinikum Frankfurt, von besonderer Bedeutung.</p> <p>Die erste ist BRAT (Barrow Ruptured Aneurysm Trial), in der eine vergleichende Analyse die Ergebnisse der endovaskulären/neuroradiologischen sowie der mikrochirurgischen Therapie von Hirngefäss­aneurysmen untersuchte.<sup>3</sup> Anlass waren die Ergebnisse der ISAT (International Study on Aneurysm Treatment), in der erstmals der endovaskuläre und der mikrochirurgische Verschluss von rupturierten Hirngefässaneurysmen vergleichend untersucht wurde.<sup>4</sup> Die initialen Ergebnisse von ISAT zeigten ein deutlich besseres Resultat bei endovaskulär behandelten Patienten als bei solchen, bei denen ein operativer Verschluss des Aneurysmas erfolgt war. Verlaufsanalysen wurden regelmässig durchgeführt und publiziert. Bei der letzten Publikation dieser Analysen im Jahr 2015 zeigte sich, dass sich die Ergebnisse beider Behandlungsverfahren im Langzeitverlauf zunehmend anglichen und 7 Jahre nach der ursprünglichen Publikation kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Behandlungsarten mehr bestand.</p> <p>Dies hatte nun die Arbeitsgruppe um den Hirngefässspezialisten Robert Spetzler am Barrow Neurological Institut in Phoenix veranlasst, eine eigene Studie (BRAT) auf den Weg zu bringen, bei der nach strengen Kriterien Patienten per Zufall entweder in einen endovaskulären Arm oder in einen operativen Arm verteilt wurden, um eine objektive Analyse beider Verfahren zu ermöglichen. Ein nicht unerheblicher Teil der Patienten musste von dem endovaskulären Arm in den operativen übernommen werden, weil sich letztlich das Aneurysma über den Gefässweg nicht verschliessen liess. Vergleichbar mit den Ergebnissen von ISAT zeigte sich auch hier 1 Jahr nach Abschluss der Untersuchungen ein deutlich besseres Ergebnis im endovaskulären Arm, aber 3 Jahre später wurde der gleiche Trend wie bei ISAT sichtbar, nämlich ein zunehmendes Angleichen der Ergebnisse in beiden Behandlungsarmen, sodass sich ein statistisch signifikanter Unterschied, insbesondere bei Hirngefässaneurysmen im vorderen Hirnkreislauf, nicht mehr nachweisen liess. Im Gegenteil konnte klar aufgezeigt werden, dass operativ behandelte Aneurysmen eine signifikant geringere Rate an Wiederauffüllung des Aneurysmas mit notwendiger Nachbehandlung aufwiesen als die endovaskulär behandelten Aneurysmen.</p> <p>Fasst man die Langzeitergebnisse beider Studien zusammen, so wird deutlich, dass die endovaskuläre und die operative Behandlung intrakranieller Aneurysmen gleichwertig nebeneinanderstehen und langfristig zu identischen Resultaten führen. «Das bedeutet, dass Patienten mit einem geplatzten Aneurysma in Hirngefässzentren behandelt werden sollten, in denen beide Behandlungsarten rund um die Uhr durchgeführt werden können und wo die endgültige Entscheidung über die Art der Behandlung von hocherfahrenen und kompetenten Neurochirurgen und Neuroradiologen gemeinsam in Abhängigkeit von Art und Lage des Aneurysmas und den speziellen klinischen Gesichtspunkten des individuellen Patienten getroffen wird», so Seifert.</p> <h2>Flow-Diverter im Einsatz</h2> <p>Die Behandlung von Erkrankungen der hirnversorgenden Gefässe über einen Katheter, die minimal invasive endovaskuläre Therapie, ist seit vielen Jahren etabliert und bei zahlreichen Erkrankungen bereits die Methode der Wahl. Nachdem bereits seit geraumer Zeit auch Stents in die vergleichsweise kleinen intrakraniellen Gefässe über einen Katheter eingebracht und dort abgesetzt werden können, wurde mit der Entwicklung von Flow-Divertern eine neue Ära in der endovaskulären Therapie eingeläutet: Während die bisher zur Verfügung stehenden Stents, ähnlich wie in der Kardiologie, die Weite und Form eines Gefässes therapeutisch ändern, sind Flow-Diverter Implantate, bei denen vorrangig eine gezielte Veränderung der Hämodynamik im Blutgefäss und damit funktionelle Aspekte im Vordergrund stehen. Dies wird durch eine hohe Maschendichte erreicht, wodurch der Durchtritt des Bluts zwar reduziert, aber nicht grundsätzlich verhindert wird.</p> <p>«Flow-Diverter sind eine ingenieurtechnische Meisterleistung, da sie eine Vielzahl von eigentlich widersprüchlichen Eigenschaften in sich vereinen müssen», sagt Prof. Dr. med. Martin Skalej, Direktor des Instituts für Neuroradiologie am Universitätsklinikum Magdeburg. «Sie müssen eine hohe Maschendichte aufweisen und nach der Freisetzung aus dem Katheter selbst expandieren und dadurch wandadhärent werden. Im nicht entfalteten Zustand müssen sie jedoch so dünn sein, dass sie in einen Mikrokatheter von weniger als einem Millimeter Durchmesser passen, und dabei immer noch so flexibel sein, dass sie sich auch extremen Gefässkrümmungen und engen Radien der Hirngefässe problemlos anpassen können.» Obwohl durch das Maschenwerk auch die Abgänge von kleineren, ebenfalls hirnversorgenden Gefässen überdeckt werden, darf der Einsatz eines Flow-Diverters nicht zu einer kritischen Minderdurchblutung der von diesen Gefässen abhängigen Hirnareale führen.</p> <p>Neben den Herausforderungen an den Flow-Diverter selbst und den für die Implantation benutzten Katheter ist die Etablierung dieser Technik ohne die parallele Entwicklung in der Bildgebung nicht denkbar. Da der Eingriff minimal invasiv typischerweise von einer Gefässpunktion der Leistenarterie aus durchgeführt wird, sind die Materialien im Gegensatz zu einer offenen Operation für den Neuroradiologen nicht direkt im Gefäss sichtbar, sondern müssen mit geeigneten Bildgebungstechniken dargestellt werden. Üblicherweise erfolgen solche Eingriffe in einem Angiografieraum unter sterilen Bedingungen. Moderne digitale Subtraktionsangiografie-Anlagen (DAS) verwenden Röntgenstrahlen, mit denen metallische Objekte wie Flow-Diverter besonders gut dargestellt werden können. Die Gefässe selbst können durch Kontrastmittel sichtbar gemacht werden. Neben der reinen Projektionsradiografie sind moderne Geräte aber auch in der Lage, dreidimensionale Aufnahmen von Gefässen und Implantaten in hoher Qualität anzufertigen, sodass der Operateur dadurch jederzeit die volle räumliche Orientierung über das zu behandelnde Gefäss und die Instrumente hat.</p> <p>«Durch die beschriebenen Eigenschaften der Flow-Diverter ist es erstmals möglich geworden, auch bisher unbehandelbare Erkrankungen von Hirngefässen erfolgreich und dauerhaft zu therapieren», so Skalej. Dies gilt vor allem für Riesen-Aneurysmen und fusiforme Aneurysmen, die im Gegensatz zu den sakkulären Aneurysmen durch das reine Einbringen von Implantaten in das Aneurysma-Lumen nicht ausreichend behandelt werden können. Durch die Fähigkeit der Flow-Diverter, den Blut­ein- und -ausstrom aus der krankhaften Aussackung positiv zu beeinflussen, können die erkrankten Gefässe praktisch rekonstruiert werden, ohne dass Implantate in das Aneurysma eingebracht werden müssen.</p> <p>Das Zusammenspiel aller genannten Techniken zeigt das Beispiel eines Patienten, der infolge einer angeborenen Bindegewebsschwäche an einer hochgradigen krankhaften Aufweitung der Arteria basilaris (Megadolichobasilaris) litt. Die immer weiter fortschreitende Aufweitung des Gefässes führte zur Ablagerung von Blutgerinnseln an der Gefässwand, sodass letztlich eine grosse Raumforderung entstand, die auf die umgebenden Hirnstrukturen drückte (Abb. 2).</p> <p>Nach Implantation mehrerer Flow-Diverter (überlappend) in dem sehr langstreckig erkrankten Gefässabschnitt konnte ein normales Innenlumen rekonstruiert werden (Abb. 3). Bereits die Kontrollaufnahmen kurz nach Implantation der Flow-Diverter zeigen eine Verbesserung der Situation mit einem reduzierten Ausstrom von kontrastiertem Blut durch das Maschenwerk der Flow-Diverter. Parallel dazu war bereits direkt nach dem Eingriff klinisch eine Besserung der Symptome aufgetreten. Das Fortschreiten der Erkrankung kann dadurch zum Stillstand gebracht werden, im Idealfall schrumpfen die Blutgerinnsel um das rekonstruierte Gefässlumen, sodass auch der Druck auf die umgebenden Hirnstrukturen wieder nachlässt. «Diese Technik weist noch sehr viel Potenzial auf, das durch die weitere Technikentwicklung – sowohl auf Seite der Bildgebung und der Simulationstechniken als auch der Materialentwicklung bei Kathetern und Flow-Divertern – noch erschlossen werden kann», meint Skalej. <em class="Copy-italic">(red)</em></p> <p><em class="Copy-italic"><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Neuro_1703_Weblinks_s17_1.jpg" alt="" width="1417" height="918" /></em></p> <p><em class="Copy-italic"><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Neuro_1703_Weblinks_s17_2.jpg" alt="" width="2149" height="946" /></em></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Pressemitteilungen zur 68. Jahrestagung der DGNC, 14.–17. Mai 2017, Magdeburg
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Mantione M et al: Cognitive-behavioural therapy augments the effects of deep brain stimulation in obsessive-compulsive disorder. Psychol Med 2014; 44(16): 3515-22 <strong>2</strong> Firsching R: Coma after acute head injury. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 313-20 <strong>3</strong> Spetzler RF et al: The Barrow Ruptured Aneurysm Trial: 6-year results. J Neurosurg 2015; 123(3): 609-17 <strong>4</strong> Molyneux AJ et al: The durability of endovascular coiling versus neurosurgical clipping of ruptured cerebral aneurysms: 18 year follow-up of the UK cohort of the International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT). Lancet 2015; 38589969): 691-7</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Funktionsstörung des Myokards: wenn die Entspannung des Herzens gestört ist
Die hypertropheobstruktive Kardiomyopathie (HOCM) ist dadurch charakterisiert, dass die Entspannung des Myokards funktionsgestört ist. Die Folge ist eine zunehmende Verdickung der ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...


