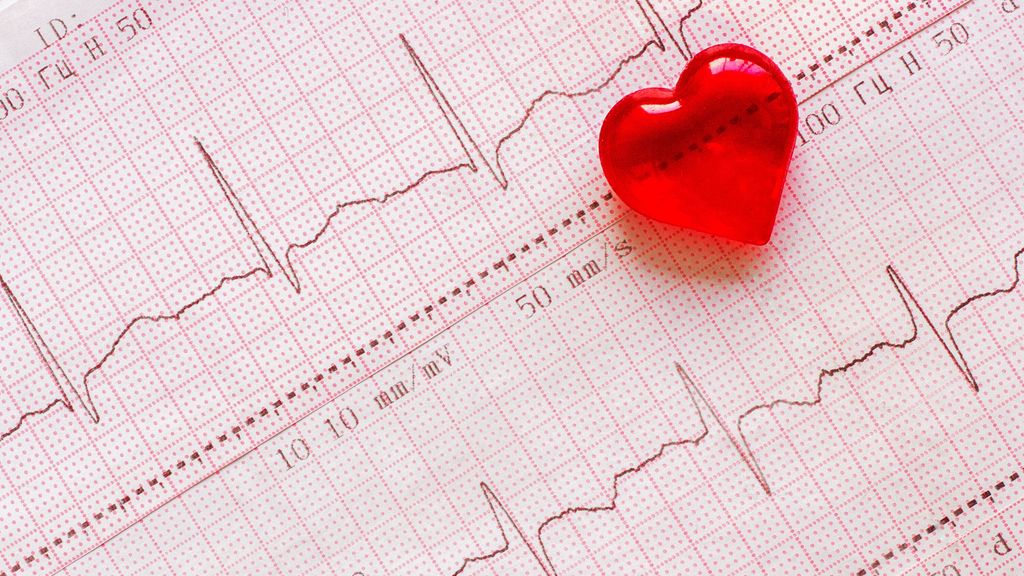<p class="article-intro">Die Herzinsuffizienz ist hinsichtlich Ausmaß, Prognose und Kosten weit unterschätzt. In Tirol wurde nun mit 1. Jänner 2017 mithilfe der Krankenkassen das Disease-Management-Programm HerzMobil Tirol eingeführt. Zu hoffen ist, dass sich durch das Mitwirken von vielen Menschen im Gesundheitsdienst – Krankenhausärzten, niedergelassenen Ärzten und Pflegepersonen – mit dem Disease- Management-Programm HerzMobil Tirol die Zahl der Wiederaufnahmen reduziert und die Prognose der Patienten verbessert.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Rolle des Krankenhausarztes im DMP HerzMobil Tirol ist es, eine möglichst genaue Diagnose zu stellen, ein erstes Therapieziel festzulegen und Patienten auszuwählen, die für das Disease-Management- Programm geeignet sind.</li> <li>Die Rolle des niedergelassenen Arztes im DMP HerzMobil Tirol ist es, auf Abweichungen von Zielwerten bzw. Bandbreiten in Kommunikation mit der Herzinsuffizienzschwester zu reagieren und den Patienten gegebenenfalls zu kontaktieren oder einzubestellen, um die Therapie eventuell anzupassen.</li> <li>Die Rolle der Pflege im DMP HerzMobil Tirol ist die Schulung des Patienten. Diese beinhaltet unter anderem Informationen zu seiner Erkrankung, richtige Medikamenteneinnahme, Ernährung sowie eine technische Schulung bezüglich der zu bedienenden technischen Geräte.</li> </ul> </div> <h2>Die Rolle des Krankenhausarztes</h2> <p>Bereits 2002 wurde in der „Zeit online“ auf eine auf uns zukommende Epidemie hingewiesen. Gemeint war nicht eine Epidemie durch Mikroben, sondern die Epidemie der Herzinsuffizienz. Das Erstaunliche war, dass selbst die Ärzteschaft lange brauchte, um diese Epidemie in ihrem ganzen Ausmaß wahrzunehmen und zu verstehen. Immer mehr Patienten überleben die akuten Ereignisse verschiedenster Herzerkrankungen. Ihre zugrunde liegenden Ursachen sind oft nicht heilbar und so verschieben sich die Probleme zunehmend in Richtung einer chronischen Herzinsuffizienz. Damit gehen immer wieder stattfindende Krankenhausaufenthalte Hand in Hand. Trotz wirksamer Medikamente und Interventionen ist die Mortalität bei chronischer Herzinsuffizienz erschreckend hoch. In den letzten Jahren wurde erkannt, dass die Vermeidung erneuter kardialer Dekompensationen eine günstige Modifikation des Krankheitsverlaufes bewirkt. Dazu bedarf es allerdings eines Disease- Managements, bei dem die verschiedenen Akteure in einem Netzwerk zusammenarbeiten. Dem Krankenhausarzt fällt dabei meist die Rolle des Erstbehandelnden zu. Außerdem wird er in der Folge die weiteren notwendigen Schritte für die Behandlung des Patienten im Netzwerk einleiten (Abb. 1). Damit alle in diesem Behandlungsnetzwerk effektiv eingreifen können, ist der Krankenhausarzt gefordert, eine möglichst genaue Diagnose zu stellen (Spezifizierung der Herzinsuffizienz, deren Trigger und Schweregrad), ein erstes Therapieziel festzulegen und Patienten auszuwählen, die für das Disease-Management- Programm geeignet sind. Frühere Erfahrungen haben gezeigt, dass nicht jeder Patient für ein solches integriertes Herzinsuffizienzprogramm geeignet ist, braucht es dazu doch ein hohes Maß an Adhärenz und eine gewisse Fertigkeit im Umgang mit den wenigen technischen Hilfsmitteln. Um die Auswahl treffsicherer zu machen, wird der Charlson-Komorbiditäts-Index herangezogen (Abb. 2). Ein Index >6 disqualifiziert Patienten für die Teilnahme am Programm. Vor der Entlassung sollte das Bewusstsein des Patienten nochmals für die Therapieziele und Grenzwerte geschärft, und diese sollten festgelegt und im Arztbrief klar kommuniziert werden. Der Patient wird von jetzt an im Netzwerk „transparent“. Durch den Einblick aller verantwortlichen Netzwerkbeteiligten entsteht ein „gesunder Zwang“ für den Krankenhausarzt, die Herzinsuffizienz noch standardisierter und richtliniengerechter zu verfolgen. Damit ergibt sich aber auch die Chance, eine Qualitätskontrolle für das Krankenhaus einzurichten.<br /> Nach der Entlassung bleibt der Krankenhausarzt weiter eine wichtige Schnittstelle zwischen niedergelassenem Netzwerkarzt und der mobilen Herzinsuffizienzpflege, um schwereren Komplikationen bestmöglich zu begegnen und weitere Maßnahmen, wie spezielle Nachkontrollen oder auch die Entscheidung für die Implantation eines Device, zu ergreifen. Am Ende besteht die Hoffnung, dass eine konsequente Betreuung des Patienten in diesem vernetzten Herzinsuffizienzprogramm eine erneute akute Dekompensation mit stationärer Wiederaufnahme verhindert oder weitestmöglich hinausschiebt.<img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_seite14_abb1.jpg" alt="" /><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_seite15_abb2.jpg" alt="" width="1417" height="1405" /></p> <h2>Die Rolle des niedergelassenen Netzwerkarztes</h2> <p>Die Rolle des Netzwerkarztes beginnt nach der Aufnahme des Patienten in das Versorgungsprogramm HerzMobil Tirol, der Einschulung und Entlassung aus dem Krankenhaus. Initial werden Zielwerte für Gewicht, Blutdruck und Herzfrequenz aus der stationären Behandlung übernommen. Die Anpassung erfolgt sofern notwendig bei der ersten klinischen Untersuchung der ambulanten Betreuung innerhalb der ersten Woche nach der Entlassung. Der Patient ist wieder in seiner gewohnten Umgebung, in der sowohl die Ernährung als auch die Bewegung dem angepassten Alltag entsprechen. Wöchentliche Kontrollen der übermittelten Werte von Blutdruck, Herzfrequenz und Gewicht, der Medikation sowie der subjektiven Befindlichkeit erfolgen elektronisch (Abb. 3). Abweichungen von den eingegebenen Zielwerten bzw. Bandbreiten der Abweichung verursachen eine Meldung an die betreuende Pflegeperson und ist im System für alle Stakeholder ersichtlich. In Kommunikation mit dem Netzwerkarzt wird darauf reagiert und der Patient kontaktiert oder einbestellt. Vorgesehen ist eine weitere klinische Untersuchung mit Bestimmung von NT-proBNP, Kreatinin und Elektrolyten vier Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus und am Ende als Abschlussuntersuchung. Die Vorteile für den Netzwerkarzt durch die Teilnahme am DMP HerzMobil Tirol sind klar ersichtlich:</p> <ul> <li>Standardisierte Ausgangslage der Patientenversorgung (Grenzwerte/Medikation)</li> <li>Klare Entscheidungsbäume der Therapie mit möglicher individueller Anpassung</li> <li>Vorausgegangene intensive Patientenschulung</li> <li>Überschaubarer Zeitaufwand der Versorgung bei guter Verlaufsdokumentation</li> <li>Referenzzentrum bei schwierigen Entscheidungen/ instabilen Patienten</li> <li>Hohe Motivation der Patienten mit guter Therapieadhärenz</li> <li>Zufriedene Patienten mit mehr Selbstsicherheit und Krankheitseinsicht</li> <li>Entlastung der Hausärzte von instabilen Patienten</li> <li>Besseres Outcome für Patienten mit subjektiv deutlich reduzierter Aufnahmehäufigkeit</li> <li>Kontinuierliche Patientenversorgung durch interne Vertretungen im System</li> </ul> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_seite16_abb3.jpg" alt="" width="1417" height="1467" />Zusammenfassend kann man sagen, dass die Praktikabilität von HerzMobil Tirol mit der geeigneten Patientenauswahl (Kognition/Prognose) steht und fällt. Die Struktur und die Software von HerzMobil Tirol sind gut, die problemlose Integration in den Praxisbetrieb ist möglich. Die Betreuung so motivierter Patienten ist ein Ansporn in der täglichen klinischen Praxis. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Herzinsuffizienz-DGKP rundet die Versorgung optimal ab. Nahezu alle Patienten wollen nach der Betreuungsphase mit dem Monitoring fortfahren.</p> <h2>Die Aufgaben der Pflege im Versorgungsprogramm HerzMobil Tirol</h2> <p>Die Diagnose Kardiomyopathie mit den Symptomen der Herzinsuffizienz ist für den Patienten mit zum Teil massiven Änderungen und Einschränkungen seines bisherigen Lebensstils verbunden. Dazu kommen bisher nicht bekannte medizinische Ausdrücke, Ängste und Unsicherheiten im Umgang mit der Erkrankung und oft eine Vielzahl an neu einzunehmenden Medikamenten mit unbekannten Wirkungen und Nebenwirkungen.<br /> Um dem betroffenen Patienten und seinen Angehörigen das notwendige Wissen und die damit verbundene Sicherheit im Umgang mit seiner Erkrankung zu geben, erhält der Patient bei der Aufnahme in das Versorgungsprogramm HerzMobil Tirol eine speziell auf seine Bedürfnisse abgestimmte Schulung durch eine Herzinsuffizienzpflegeperson. Diese Schulung beinhaltet einerseits Informationen zu seiner Erkrankung und andererseits eine technische Schulung bezüglich der zu bedienenden Geräte.</p> <p><strong>Themen im Rahmen der Schulung zur Erkrankung</strong><br /> Die Schulungsinhalte sind die Erkrankung mit ihren Symptomen und Zeichen einer drohenden Verschlechterung (Gewichtszunahme von 2kg in 3 Tagen, zunehmende Atemnot, Ödeme, Völlegefühl . . .) auch bei noch subjektiv gutem Wohlbefinden, die Medikamente einschließlich ihrer Wirkungen und des jeweils richtigen Einnahmezeitpunktes, die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung (leichte Vollkost) mit Flüssigkeits- und Kochsalzrestriktion, Möglichkeiten der Bewegung (in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand), Impfungen, Krankheit und Reisen, Bevorratung von Medikamenten sowie „End of life“-Strategien.<br /> Um die persönliche Schulung zu unterstützen, werden die Patienten mit Schulungsunterlagen versorgt (Abb. 4). Großen Wert legen wir auf die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und Vereinigungen. Je nach Bedarf werden Diätassistenten, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, mobile Dienste, Selbsthilfegruppen usw. vermittelt bzw. hinzugezogen.<img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_seite16_abb4.jpg" alt="" width="1420" height="1342" /></p> <p><strong>Geräteschulung</strong><br /> Um die im Krankenhaus begonnene medikamentöse Therapie auch nach der Entlassung weiter zu optimieren und um eine drohende Verschlechterung der Erkrankung frühzeitig zu erkennen, ist die kontinuierliche Messung einzelner Vitalparameter wichtig. Dafür erhält der Patient ein Set mit Blutdruckmessgerät (Abb. 5) und Körperwaage und überträgt mittels Smartphone die gemessenen Werte an die beteiligten Stakeholder. Außerdem bestätigt er die Einnahme der verordneten Medikamente und dokumentiert sein aktuelles Befinden.</p> <p>Im Anschluss an eine zu Beginn intensive Schulungsphase (z.T. auch im Rahmen von Hausbesuchen) überträgt der Patient die gemessenen Parameter für 3–6 Monate täglich selbständig und hält bei Bedarf telefonischen Kontakt zur Pflegeperson und/oder zum Arzt. Nach dieser Zeit sollte der Patient fortlaufend seine Vitalparameter messen und dokumentieren, sich um gemeinsam festgelegte Zielvereinbarungen bemühen (z.B. weitere Gewichtsabnahme, vermehrte Bewegung …), um so eine weitere Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen. Der Patient sollte eine drohende Verschlechterung frühzeitig erkennen und darauf adäquat reagieren bzw. seinen behandelnden Arzt kontaktieren.<img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1702_Weblinks_seite16_abb5.jpg" alt="" width="685" height="1412" /><br /> Das Feedback der bisher betreuten Patienten war durchwegs positiv, wobei die meisten Patienten die neu gewonnene Sicherheit im Umgang mit dieser chronischen Erkrankung als den für sie größten Nutzen erwähnten.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p> </p> <p> </p>
</div>
</p>