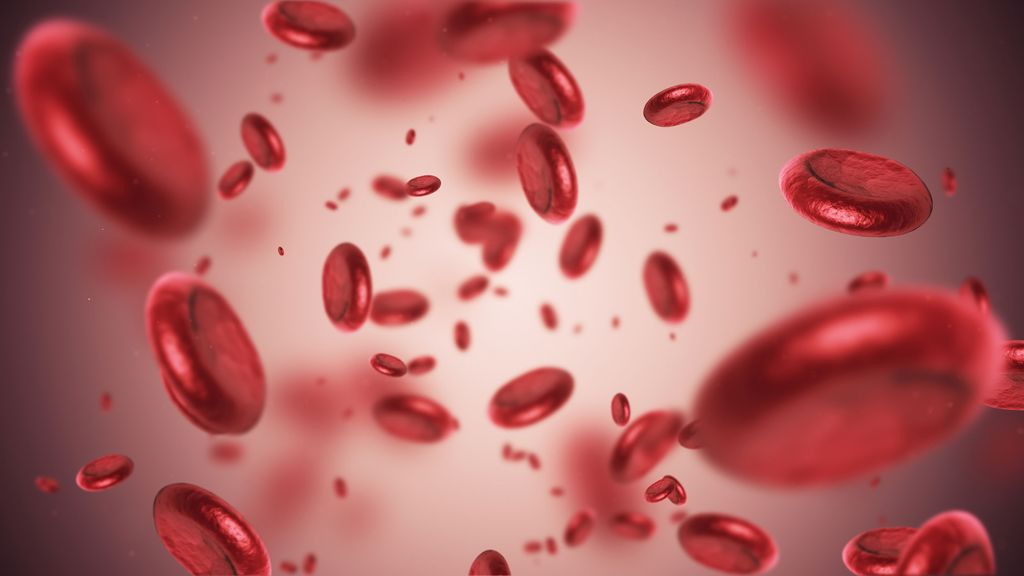<p class="article-intro">Über die Zeit gesehen wird fast jeder diabetische Patient eine Herzinsuffizienz entwickeln, die eine extrem schlechte Prognose aufweist. Unsere Optionen bei diesen Patienten sind vielfältig und haben sich in letzter Zeit erweitert. Der Einsatz von neuen Antidiabetika und Herzinsuffizienzmedikamenten ermöglicht nun seit Kurzem die Prognose auch dieser Hochrisikopatienten zu verbessern.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Therapiebeginn mit ACE-Hemmern (bei Unverträglichkeit AT<sub>1</sub>-Hemmern) und Betablockern: Aufdosierung in Abhängigkeit von den Nebenwirkungen, klinische Symptome zusätzlich diuretisch behandeln!</li> <li>Herzfrequenzziel von 60/min im ­Sinusrhythmus: Kann dies nicht mit Betablockern erreicht werden, sollte der If-Kanal-Blocker Ivabradin in Kombination bei einer EF ≤30 % frühzeitig gegeben werden (max. 2-mal 7,5mg).</li> <li>Niedrig dosierte Aldosteronantagonisten (z.B. Spironolacton, Eplerenon), jeweils maximal (50mg/Tag), bereits ab NYHA II und einer EF <35 % empfohlen. Cave: eingeschränkte Nierenfunktion und Kaliumretention!</li> <li>ARNI bei EF ≤30 % und/oder weiterer Verschlechterung trotz optimaler ­Therapie möglich. Cave: nicht mit ACE-Hemmern/AT<sub>1</sub>-Antagonisten kombinieren und Umstellungsschema einhalten!</li> <li>Defibrillatoren: Sekundärprophylaxe oder Primärprophylaxe bei EF <35 % </li> <li>Resynchronisationssystem (CRT): bei Vorhandensein eines Links­schenkelblocks oder sehr breitem QRS-Komplex (>150ms) und EF <35 % </li> </ul> </div> <h2>Herzinsuffizienz und Diabetes mellitus</h2> <p>Sowohl die chronische Herzinsuffizienz (CHF) als auch Diabetes mellitus (DM) zählen zu den häufigsten Erkrankungen in der westlichen Gesellschaft. Etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischer Herzinsuffizienz. Damit ist sie aber nicht nur eine der häufigsten, sondern auch kostenintensivsten Erkrankungen in Deutschland. DM und CHF sind oft miteinander vergesellschaftet und führen zu einer insgesamt schlechteren Prognose.<sup>1</sup> Herzinsuffizienz wird mittlerweile in drei verschiedene Formen unterteilt. Die wohl bekannteste Form ist die Herzinsuffi­zienz mit reduzierter Pumpfunktion (HFrEF) mit einer linksventrikulären Auswurffraktion von weniger als 40 % . Neben dieser gibt es noch die sogenannte Herzinsuffizienz mit mittelgradig reduzierter Pumpfunktion (HFmrEF, LVEF 40–49 % ) und die sogenannte Herzinsuffizienz mit noch erhaltener Pumpfunktion (HFpEF, LVEF >50 % ).<sup>2</sup> Da es bisher nur nicht ­ausreichend belegte Therapieformen für HFpEF und HFmrEF gibt, wollen wir uns im Folgenden nur mit der HFrEF beschäftigen.<sup>2</sup></p> <h2>Herzinsuffizienzbasistherapie</h2> <p>Die diuretische Therapie stellt die Grundvoraussetzung der Symptomkontrolle dar. Die europäischen Richtlinien empfehlen bei allen Patienten mit CHF die Einleitung einer Basistherapie mittels eines ACE-Hemmers und Betablockers mit dem Ziel einer maximalen Ausdosierung zur Senkung der Gesamtsterblichkeit (Abb. 1).<sup>3</sup> Sie gilt für Diabetiker wie für Nichtdiabetiker. Im Gegensatz zu den deutschen Leitlinien werden Angiotensinrezeptorblocker (AT<sub>1</sub>-Blocker) in Europa nur noch bei Unverträglichkeit von ACE-Hemmern (z.B. Reizhusten) empfohlen.<sup>2</sup> Interessanterweise zeigen Betablocker bei Patienten mit CHF, sowohl mit als auch ohne begleitenden Diabetes mellitus, eine Mortalitätsreduktion. Carve­dilol scheint hierbei einen positiveren Effekt auf das metabolische Syndrom auszuüben als vergleichbare Betablocker.<sup>4</sup> Dabei ist die angestrebte Sinusherzfrequenz bei 60/bpm. Oft gelingt das nur durch eine Kombination aus Betablocker und Ivabradin. Zusätzlich haben Aldosteronrezeptorantagonisten bei hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion bereits bei oligosymptomatischen Patienten (NYHA II) zu einer deutlichen Verbesserung der Prognose beigetragen und sollten daher in einer leitliniengerechten Herzinsuffizienztherapie enthalten sein.<sup>5</sup> Aldosteronrezeptorantagonisten gehören in die Gruppe der kaliumsparenden Diuretika (im Gegensatz zu z.B. Schleifendiuretika) und können vor allem bei eingeschränkter Nierenfunktion zu klinisch relevanten Hyperkaliämien führen; daher sind sie bei schwerer Niereninsuffizienz kontraindiziert. <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Kardio_1604_Weblinks_seite35.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <p><strong>Tipp für die Praxis: </strong><br /> Unter den gängigen Aldosteronrezep- torantagonisten hat Spironolacton die Nei- gung zur Ausbildung einer Gynäkomastie, die sich durch eine Umstellung auf ­Epleronon zurückbildet.</p> <h2>Diabetestherapie in der Herzinsuffizienz</h2> <p>Die Diabetestherapie bei Patienten mit CHF sollte nicht zu intensiv begonnen werden und vor allem Medikamenten den Vorzug geben, deren Sicherheit bei herzinsuffizienten Patienten bewiesen ist. Metformin, welchem ein vermeintlich negativer Effekt nachgesagt wurde, hat sich als sicher bei herzinsuffizienten Patienten erwiesen und sollte Therapie der Wahl sein.<sup>6, 7</sup> Aufgrund der Gefahr einer Lak­tatazidose gilt dies nicht für Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion.</p> <p>Bei der Therapie mittels Insulin sollte beachtet werden, dass es durch die Natriumretention und die zusätzlich reduzierte Glykosurie zu einer deutlichen Ansammlung von Wasser kommen kann und so zu einer Verschlechterung der Herzinsuffizienz.<sup>2</sup> Sulfonylharnstoffe haben ebenfalls einen nachgewiesenen negativen Effekt auf CHF und sollten deshalb ebenso vermieden werden. Eine klare Kontraindikation gibt es für Glitazone, diese sollten bei herzinsuffizienten Patienten vermieden werden.<sup>8, 9</sup> Empagliflozin, ein SGLT2-Inhibitor, führte in einer Studie zu einer verminderten Hospitalisation aufgrund von Herzinsuffizienz und reduzierten Mortalität.<sup>10</sup> Dieser Effekt war bei Diabetikern ohne Herzinsuffizienz wie auch bei Diabetikern mit Herzinsuffizienz in der Studie positiv. Allerdings gab es keinen positiven Effekt auf Schlaganfall und Herzinfarktraten. Von den europäischen Leitlinien wird dieser SGLT2-Inhibitor als Kombinationspartner zu Metformin empfohlen. Ebenfalls positive Effekte auf die kardiovaskuläre Mortalität wurden in der gerade publizierten Studie zu dem Glu­kagonanalogon Liraglutid veröffentlicht.<sup>11</sup></p> <h2>Device-Therapien</h2> <p>Eine primär prophylaktische Defibrillatortherapie ist bei Patienten mit hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion (EF <35 % ), die im Rahmen einer ischämischen Kardiomyopathie aufgetreten ist, indiziert. Der Effekt einer solchen Therapie bei Kardiomyopathien ist nicht gesichert. Darüber hinaus kann eine Resynchronisationstherapie vor allem bei Patienten mit breiter QRS-Morphologie (>130ms und Linksschenkelblock oder >150ms) zu einer Verbesserung der Pumpfunktion und des subjektiven Wohlbefindens führen. Eine Device-Therapie sollte immer in einem Zentrum erfolgen, wo auch gewährleistet ist, dass eine entsprechende Indikation gestellt wird und eine adäquate weitere Versorgung gegeben ist.<sup>12</sup></p> <h2>ARNI als neuer Weg in der Herzinsuffizienztherapie</h2> <p>Auch wenn man Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz mithilfe der oben genannten Methoden optimal therapiert, beträgt das 5-Jahres-Überleben nur etwa 50 % . Daher ist man noch immer auf der Suche nach weiteren Methoden und Substanzen. <br />Die PARADIGM-HF-Studie konnte 2015 erstmals den Nutzen einer neuen Substanzklasse, des sogenannten Neprilysininhibitors (in diesem Fall Sacubitril), in Kombination mit einem AT<sub>1</sub>-Hemmer gegenüber einer konventionellen Therapie mit einem ACE-Hemmer zeigen.<sup>13</sup> <br />Sacubitril entfaltet seinen Effekt über die Hemmung der membranständigen Peptidase Neprilysin. Neprilysin spaltet unter anderem die aus der Herzinsuffizienz wohlbekannten natriuretischen Peptide ANP, CNP und BNP. Natriuretische Peptide werden in der Herzinsuffizienz innerhalb körpereigener Regulationsmechanismen gegen die Volumenüberladung sezerniert. Sie wirken gefäßerweiternd, diuretisch und haben auch direkten Einfluss auf das „cardiac remodeling“ und weisen somit wünschenswerte Effekte auf. Unter normalen Bedingungen haben sie jedoch nur eine sehr kurze Halbwertszeit, welche durch die Funktion von Neprilysin bedingt ist. Eine Inhibition von Neprilysin führt also zu einer längeren Wirkdauer dieser in der Herzinsuffizienz erwünschten Peptide. Leider wird auch Angiotensin II, welches in der Herzinsuffizienz eher unerwünschte Effekte hervorruft, durch Neprilysin gespalten. Eine direkte Hemmung von Neprilysin führt also auch zur verstärkten Wirkung von Angiotensin II, weshalb Sacubitril mit einem AT<sub>1</sub>-Antagonisten kombiniert werden muss. <br />LCZ696 – als Entresto® in den Markt eingeführt – setzt sich aus Valsartan und dem Prodrug Sacubitril in molarer ­Äquivalenzdosis zusammen. Diese neue Kombinationsklasse wird bezeichnet als An­giotensinrezeptor-Neprilysininhibitoren (ARNI). Die PARADIGM-HF-Studie verglich bei Patienten mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion (LVEF <40 % ) ARNI gegen eine konventionelle Therapie mit ACE-Hemmern. Die Studie zeigte einen so deutlichen Vorteil von ARNI gegenüber konventionellen ACE-Hemmern in allen Studienendpunkten, wie z.B. kardiovaskulärer Sterblichkeit, Gesamtmortalität sowie der Notwendigkeit zur Device-Therapie, dass die Studie schlussendlich abgebrochen und ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für ARNI eingeleitet wurde. Spannend in diesem Zusammenhang ist, dass bis zu 70 % der Patienten klinisch stabil (NYHA II) und somit nicht bezüglich einer Dekompensation klinisch auffällig waren, obwohl ihre BNP-Plasmaspiegel erhöht waren. Das gilt auch für diabetische Patienten, bei denen ebenfalls die Hospitalisationsrate gesenkt werden konnte. Bezüglich der Sterblichkeitssenkung war in diesem Zusammenhang das Ergebnis auch für Patienten mit Prädiabetes positiv, nicht jedoch signifikant für Diabetiker. Dieses letzte Ergebnis überrascht etwas, unterliegt weiteren Analysen und mag möglicherweise aufgrund einer geringeren Fallzahl zustande gekommen sein. Nach den europäischen Leitlinien wird daher auch keine Differenzierung zwischen diabetischen und nicht diabetischen Patienten mit Herzinsuffizienz zum Einsatz von LCZ696 gemacht.</p> <p><strong>Tipp für die Praxis:</strong><br /> In der Praxis ist es oft nicht einfach zu entscheiden, ob der Patient mit Herzinsuffizienz wirklich „stabil“ ist. Eine NYHA-Klassifikation ist oft falsch negativ. Daher sind kleine Belastungsuntersuchungen inkl. Fahrradergometrie oder Spiroergometrie hilfreiche Werkzeuge, um Patienten zu identifizieren, die in Ruhe kompensiert erscheinen, aber von LCZ696 dennoch profitieren würden. Auch vermeintlich stabile und klinisch unauffällige Patienten profitieren von LCZ696, wenn sie erhöhte Plasma-BNP/NT-proBNP-Spiegel aufweisen.</p> <p>ARNI zeigten ein ähnliches Nebenwirkungsprofil wie konventionelle ACE-Hemmer. Mit ARNI behandelte Patienten neigten vermehrt zu Hypotonie, während Hyperkaliämien, Nierenfunktionsstörungen und Reizhusten seltener waren. Sie dürfen nicht mit ACE-Hemmern kombiniert werden, diese müssen 36h zuvor abgesetzt werden. Bei AT<sub>1</sub>-Rezeptor-vorbehandelten Patienten kann unter Kontrolle des Blutdrucks direkt auf LCZ696 gewechselt werden. Auch Patienten mit einer positiven Anamnese für Angioödeme scheiden als ARNI-Kandidaten aus.</p> <p><strong>Tipp für die Praxis: </strong><br /> Vor Einleiten einer Therapie mit LCZ696 muss der ACE-Hemmer 36h zuvor abgesetzt werden. Während dieser Zeit bietet sich eine „Überbrückungsphase“ mit einem AT<sub>1</sub>-Blocker wie z.B. Valsartan an. <br />Zuletzt entstand eine Diskussion um die möglichen Nebeneffekte von Neprilysin am zentralen Nervensystem. Neprilysin wird unter anderem auch im Gehirn exprimiert und ist am Abbau, neben mehr als 20 anderen Enzymen von β-Amyloid mitbeteiligt, welches wiederum im Verdacht steht, eine Rolle in der Entwicklung von Morbus Alzheimer zu spielen. Patienten in PARADIGM-HF zeigten keine Häufung kognitiver Störungen, jedoch war auch der Untersuchungszeitraum verhältnismäßig kurz. Die Herstellerfirma Novartis wurde daher von der FDA zu einer Langzeitbeobachtung verpflichtet, um mögliche Verläufe frühzeitig abzuwenden.</p> <p>ARNI wurden bereits in die neuen ESC-Herzinsuffizienzleitlinien von 2016 aufgenommen und erhielten eine IB-Indikation bei therapieresistenter Herzinsuffizienz. In PARADIGM-HF waren auch Patienten eingeschlossen, welche nur oligosymptomatisch waren, woraus hervorgeht, dass ARNI auch bei solchen Patienten angewandt werden können. Kommt es unter einer optimalen Herzinsuffizienztherapie zu einer weiteren klinischen, laborchemischen oder echokardiografischen Verschlechterung, sollte eine Umstellung von einer ACE-Hemmer/AT<sub>1</sub>-Hemmer-Therapie auf einen ARNI in Betracht gezogen werden. Bei Patienten wie Frau Ö. aus dem Fallbeispiel, welche sogenannte „frequent flyer“ sind, sollte dieses Vorgehen auch erfolgen.<sup>2</sup></p> <p><strong>Tipp für die Praxis: </strong><br /> Da es unter LCZ696 zu einem verminderten Abbau von BNP kommt, ist ein BNP-Spiegel-Verlauf unter LCZ nicht zielführend. Dieser Spiegel muss bei ausreichender Compliance des Patienten ansteigen. Die NT-proBNP-Spiegel würden jedoch aufgrund der Entlastung des Herzens abfallen.</p> <p>Bei der Einleitung und Aufdosierung von ARNI sollte darauf geachtet werden, dass der systolische Blutdruck >100mmHg ist und keine symptomatische Hypotonien bestehen, denn der neu hinzugewonnene Effekt der Neprilysininhibition beinhaltet einen vasodilatatorischen und diuretischen Effekt. Durch eine Reduktion der Diuretikabegleittherapie ist unter Umständen etwas „Platz“ für LCZ696 zu schaffen. Das Nebenwirkungsprofil entspricht ansonsten dem bekannten Profil von ACE-Hemmern und AT<sub>1</sub>-Blockern. Während Wechselwirkungen mit Phosphodiesterasehemmern (Viagra) nicht vorkommen, kann sich der Atorvastatin-Wirkspiegel um das Zweifache ­erhöhen und das Medikament sollte daher angepasst werden.</p> <h2>Kasuistik</h2> <p>Frau Ö., 62 Jahre, stellt sich erneut im lokalen Klinikum vor und klagt über Luftnot und deutlich geschwollene Beine. Sie stellt sich bereits das vierte Mal in diesem Jahr mit denselben Beschwerden vor, da ihr Körper erneut zu viel Wasser eingelagert hat. Seit ihrem Herzinfarkt vor 10 Jahren, welchen man aufgrund ihres Diabetes leider zu spät erkannt hatte, leidet sie an „Wassersucht“, besser bekannt als ­chronische Herzinsuffizienz. Trotz optimaler medikamentöser Therapie und Versorgung mit einem „cardiac resynchronisation device“ (CRT) ist Frau Ö. mittlerweile ein sogenannter „frequent flyer“. Frau Ö. ist zu alt für eine Herztransplantation und das „cardiac assist device“ VAD lehnt sie aus Angst vor einer Operation ab. Eine Therapie mit dem erst neu zugelassenen Angiotensinrezeptor-Neprilysininhibitor (ARNI) LCZ696 wird eingeleitet. Frau Ö. stellt sich 6 Monate später wieder vor, dieses Mal jedoch nur zur Kontrolluntersuchung. Seit einigen Monaten bekommt sie nun besser Luft und kann wieder alltäglichen Aktivitäten, wie Einkaufen oder Spazierengehen, nachgehen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Gilbert RE, Krum H: Heart failure in diabetes: effects of anti-hyperglycaemic drug therapy. Lancet 2015; 385: 2107-17 <strong>2</strong> Ponikowski P et al: 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardio­logy (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail 2016; ENG <strong>3</strong> Garg R, Yusuf S: Overview of randomized trials of angiotensin-converting enzyme inhibitors on mortality and morbidity in patients with heart failure. Collaborative Group on ACE Inhibitor Trials. JAMA 1995; 273: 1450-6 <strong>4</strong> Bakris GL et al: Metabolic effects of carvedilol vs metoprolol in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 292: 2227-36 <strong>5</strong> Pitt B et al: The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999; 341: 709-17 <strong>6</strong> MacDonald MR et al: Treatment of type 2 diabetes and outcomes in patients with heart failure: a nested case-control study from the U.K. General Practice Research Database. Diabetes Care 2010; 33: 1213-8 <strong>7</strong> Boussageon R et al: Reappraisal of metformin efficacy in the treatment of type 2 diabetes: a meta-analysis of randomised controlled trials. PLoS Med 2012; 9: e1001204 <strong>8</strong> Hernandez AV et al: Thiazo­lidinediones and risk of heart failure in patients with or at high risk of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis and meta-­regression analysis of placebo-controlled randomized ­clinical trials. Am J Cardiovasc Drugs 2011; 11: 115-28 <strong>9</strong> Komajda M et al: Heart failure events with rosiglitazone in type 2 diabetes: data from the RECORD clinical trial. Eur Heart J 2010; 31: 824-31 <strong>10</strong> Zinman B et al: Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373: 2117-28 <strong>11</strong> Marso SP, Daniels GH et al: Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 ­diabetes. N Engl J Med 2016; 375: 311-22 <strong>12</strong> Brignole M et al: 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchroni­zation therapy. Rev Esp Cardiol (English Ed) 2014; 67: 58 <strong>13</strong> McMurray JJ et al: Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014; 371: 993-1004</p>
</div>
</p>