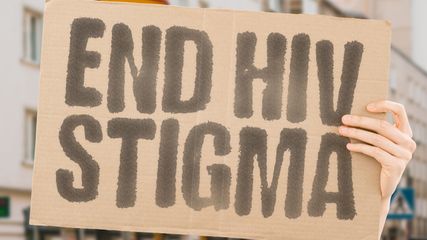<p class="article-intro">Auf der Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), die als bedeutendster HIV-Kongress einmal jährlich stattfindet, versammelten sich heuer von 4. bis 7. März erneut Tausende Biowissenschaftler, Epidemiologen und HIV-Behandler aus aller Welt in Seattle.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Fortschritte und Rückschläge im Kampf gegen die HIV-Epidemie</h2> <p>Gleich zu Beginn legte Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) den Plan der US-Behörde zur Beendigung der Aidsepidemie in 10 Jahren dar. Derzeit gibt es in den USA jährlich ca. 38 000 HIV-Neuinfektionen. Als wichtigste Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie nannte Fauci die Therapie und den Präventionseffekt durch die Therapie („treatment as prevention“, TasP). Hinzu kommt die Präexpositionsprophylaxe (PreP) als wirkungsvoller Schutz vor Neuansteckung mit einer projizierten Wirksamkeit von >95 % . Theoretisch könnte durch TasP und PreP die Epidemie rasch beendet werden, in der Praxis sieht es aber noch anders aus. Landesweit sieht man in den USA noch keinen Rückgang der Neuinfektionen, der Zugang zu medizinischer Versorgung und die Aufnahme der PreP in die Erstattung bleiben manchen Bevölkerungsschichten verwehrt, dennoch ist in Städten wie San Francisco, New York und Washington DC bereits eine deutliche Abnahme der Zahl an Neuinfektionen zu verzeichnen. <br />Um Hotspots mit erhöhter HIV-Inzidenz rasch zu erkennen, wurden Behördenfunktionen zusammengelegt. Neue Methoden aus der molekularen Epidemiologie helfen den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), zusammenhängende Infektionen (ohne Möglichkeit, die Ansteckungsrichtung nachzuweisen) rasch zu erkennen und Präventionsbemühungen damit gezielter einzusetzen. <br />Seinen Vortrag schloss Fauci mit der Feststellung, dass es (zumindest in den USA) keine weiteren Entschuldigungen gebe: „Wir haben die Werkzeuge in der Hand, um die HIV-Epidemie zu beenden“, so Fauci.<br /> Prinzipiell wären diese Bemühungen auch hierzulande wünschenswert, um die Epidemie möglichst rasch zu beenden, allerdings müssten beispielsweise erst die gesetzlichen Grundlagen für eine konsequente Meldung der Neuinfektionen geschaffen werden.</p> <h2>Ansätze der Vakzineentwicklung</h2> <p>In den letzten Jahren weit fortgeschritten ist die Erforschung von wirksamen Antikörpern, die HIV neutralisieren können. Immerhin entwickeln 5–10 % der HIV-Infizierten nach 2–3 Jahren neutralisierende Antikörper. Dies dauert deshalb so lange, weil passende Antikörper erst mehrere Mutationen und repetitive Runden einer Affinitätsreifung benötigen, um Epitope des HI-Virus, die zum Großteil mit Glykanen geblockt sind, zu erkennen und zu binden. Eine Vakzine muss daher diese nahezu komplette Anpassung simulieren. Konventionelle Vakzinedesigns greifen hier nicht. Möglicherweise könnte eine sogenannte sequenzielle Vakzinierung mit mehreren Impfstoffen, die unterschiedliche Epitope erkennen, Erfolg haben. <br />Die besten Chancen auf Erfolg einer Impfung scheinen Kinder zu haben, deren Immunsystem nach der Geburt noch relativ unbefangen im Umgang mit Umweltepitopen ist. Eine Vakzinierung mit herkömmlich entwickelten HIV-Impfstoffen, die bei Erwachsenen insuffiziente Schutzraten gezeigt haben, ist bei kleinen Kindern ca. 20-mal wirksamer und kann einen lang anhaltenden Schutz bieten.</p> <h2>STI-Raten nehmen weiter zu</h2> <p>Ein weiterer thematischer Schwerpunkt galt heuer den sexuell übertragbaren Infektionen (STI), die gemeinsam mit HIV oder unabhängig davon auftreten können. Die WHO geht derzeit von jährlich 376 Millionen neuen STI bei 15–49-Jährigen aus (verursacht durch Chlamydien, Gonorrhö, Syphilis und Trichomonaden). Probleme sind u.a. Resistenzentwicklungen bei Gonorrhö, das Wiederauftreten von „Klassikern“ wie der LGV-Proktitis und eine steigende Inzidenzrate von Syphilis. In den USA gibt es jedes Jahr 918 Fälle von kongenitaler Syphilis. Andere STI nehmen seit 2011 ebenso zu: Raten rektaler und pharyngealer Besiedelungen mit<em> Chlamydia trachomatis</em> (CT) und <em>Neisseria gonorrhoeae</em> (GC) sind im Kollektiv HIV-Positiver stets höher. Nach wie vor unklar ist, was eine pharyngeale Besiedelung durch Neisserien bedeutet, welche Rolle sie für die Gesundheit der Betroffenen spielen, wie lange diese infektiös sind und wie viele Infektionen spontan ausheilen. Interessant ist überdies, dass Daten aus Neuseeland zeigten, dass die Meningitis-B-Impfung (OMV-Vakzine) mit einer reduzierten Gonorrhöinzidenz vergesellschaftet war. Die Effektivität dieser Vakzine, die dem bei uns verwendeten Bexsero ähnlich ist, betrug immerhin 33 % . <br />In der französischen Ipergay-PreP-Studie reduzierte Doxycyclin die Chlamydienund Syphilisinzidenz um 70 % . Klar ist, dass so eine Dauereinnahme von Antibiotika auch zu Problemen führt (u.a. zu Resistenzen, Effekten auf das Mikrobiom, Dysbiose bei Frauen, abnorme Gewichtszunahme unter längerer Anwendung bei einem Viertel der Patienten). <br />Die Behandlung von STI spielt jedoch auch eine Rolle, wenn wir die HIV-Epidemie beenden wollen. Je mehr wir von „undetectable is untransmittable“ (U=U) sprechen, desto mehr nimmt der Kondomgebrauch ab und die STI-Raten nehmen zu. Die mukosale Inflammation, die durch STI sogar bei asymptomatischen Trägern ausgelöst wird, führt zu einem erhöhten Ansteckungsrisiko. In Modelldaten bei MSM („men who have sex with men“) wird angenommen, dass ca 10 % der HIVAnsteckungen durch Chlamydien und Gonokokkeninfektion mit verursacht werden! Für die Zukunft brauchen wir neue Tests, lückenlose Screeningprogramme für asymptomatische Personen und Strategien zur Behandlung von Sexualpartnern.</p> <h2>Erneuter Fall einer dokumentierten „Heilung“ von HIV</h2> <p>Große Aufregung gab es nach der Vorstellung des „Londoner Patienten“, der nach Transplantation eines Spenderknochenmarks ohne CCR5-Rezeptor aufgrund eines fortgeschrittenen Hodgkin-Lymphoms nach mittlerweile 18 Monaten ohne antiretrovirale Therapie frei von HIV ist. Das bedeutet: Bislang kann selbst in genauesten Untersuchungen kein HIV bei dem Patienten nachgewiesen werden. Obwohl die Nachbeobachtungszeit noch kürzer ist als bei dem sehr ähnlichen Fall des „Berliner Patienten“, der bereits 8 Jahre ohne ART und ohne viralen Rebound lebt, könnte der Londoner Patient der zweite Mensch sein, der nachweislich von seiner HIV-Infektion geheilt wurde. <br />Auch aus Düsseldorf ist ein ähnlicher Fall bekannt. Wieder wurde dabei CCR5- freies Knochenmark (das homozygot bei 1 % der europäischen Bevölkerung vorkommt) in einen Patienten transplantiert und dieser ist seit nunmehr 4 Monaten ohne ART frei von zirkulierendem Virus. <br />Die genannten Beispiele belegen allesamt, dass eine Heilung unter gewissen Bedingungen denkbar ist, allerdings darf nicht vergessen werden, dass bislang alle geheilten Patienten an einer anders nicht zu behandelnden hämatologischen Erkrankung litten und die Heilung der HIV-Infektion dabei eigentlich nur ein Nebeneffekt der erfolgreichen Krebsbehandlung war. <br />Interessant war auch eine Studie zu Pembrolizumab bei HIV-infizierten Patienten mit soliden Krebserkrankungen. Der PD-1-Inhibitor kann anscheinend latente HIV-infizierte Zellen aktivieren und in Zukunft vielleicht eine Rolle bei der Anwendung sogenannter „Kick and kill“-Strategien spielen. Eine neue Präzisierung des Risikos für das Auftreten von Neuralrohrdefekten bei Embryonen unter laufender Dolutegravir( DTG)-Therapie beziffert dieses als absolut gering (unter 0,7 % ), allerdings noch immer als 6–7-fach erhöht im Vergleich mit anderen ART-Regimen inklusive solcher mit anderen Integrasehemmern (INSTI). Dieser Zusammenhang wird derzeit nur in Ländern beobachtet, wo keine Folsäuresubstitution während der Schwangerschaft durchgeführt wird. Insgesamt ist das Risiko somit etwas niedriger als ursprünglich angenommen, wobei die Empfehlung, DTG nicht im ersten Trimester und bei Frauen mit Kinderwunsch einzusetzen, bestehen bleibt. In den Ländern Afrikas, in denen dieses Signal erkannt wurde, sind prinzipiell der Vorteil für die Mutter durch die sehr potente Viruslastunterdrückung, die auch die wichtigste Voraussetzung für die Verhinderung einer Mutter-auf-Kind-Übertragung (MTCT) bleibt, und das insgesamt sehr niedrige Fehlbildungsrisiko für das Kind gegeneinander abzuwägen. Vermutlich wäre auch die Folsäuresupplementation wichtig. Längere Beobachtungen aus diversen Schwangerschaftsregistern werden die Assoziation weiter präzisieren.</p> <h2>Neue Daten zur PreP</h2> <p>Weltweit profitieren etwa 500 000 Menschen von dem effektiven Schutz vor einer HIV-Ansteckung durch eine PreP. <br />In der DISCOVER-Studie wurde bei über 5000 MSM und Transgender-Frauen eine PreP mit Emtricitabin/Tenofovirdisoproxilfumarat (F/TDF, Truvada®) versus Emtricitabin/ Tenofoviralafenamid (F/TAF, Descovy®) verglichen. Nach 48 Wochen zeigte sich die Nichtunterlegenheit der TAF-basierten PreP, mit einer tendenziell (aber nicht signifikant) niedrigeren Ansteckungsrate unter TAF. Bei den insgesamt 7 Ansteckungen, die im TAF-Arm auftraten, hatte ein Studienteilnehmer eine nicht erkannte HIV-Infektion zu Baseline, 5 hatten nicht nachweisbare Wirkstoffspiegel und damit die PreP nicht genommen. Im TAF-Arm gab es keine versus 4 Resistenzen im TDF-Arm. Insgesamt wurden in beiden Armen sehr wenige Nebenwirkungen beobachtet. Wie in den TAF-Therapiestudien zeigte sich bei TAF im Vergleich zu TDF eine bessere Knochen- und Nierenverträglichkeit. Die Rate an sexuell übertragbaren Infektionen in der Studie war hoch, die Schutzrate bezüglich einer HIVAnsteckung sehr hoch. Im TDF-Arm kann, verglichen mit historischen Daten, von einer Reduktion der HIV-Neuinfektionsrate von 98 % ausgegangen werden. Teilnehmer im TAF-Arm nahmen hingegen im Schnitt 1kg mehr zu als im TDF-Arm.</p> <h2>Gewichtszunahme unter Integrasehemmern</h2> <p>Die Gewichtszunahme unter einer Therapie mit Integrasehemmern (INSTI), die deutlicher ausgeprägt ist als etwa bei Protease-Hemmern (PI) und vor allem bei nicht nukleosidischen Reverse-Transkriptasehemmern (NNRTI), war Gegenstand mehrerer Vorträge und Diskussionen. Besonders ausgeprägt schien bei Patienten, die in der NA-ACCORD-Studie eine ART begannen, die Gewichtszunahme unter Dolutegravir (+6kg) zu sein, gefolgt von Raltegravir (+4,9kg) und Elvitegravir (+3,8kg nach 2 Jahren Therapie). <br />Neben einem (negativen) Einfluss der Integrasehemmer auf die Appetit- und Insulinregulation ist vor allem denkbar, dass sich Patienten, die einen Integrasehemmer erhalten, aufgrund der guten Verträglichkeit der Therapie gesünder fühlen und beispielsweise mehr essen und auch Alkohol trinken. In einer Studie wurde gezeigt, dass vor allem Patienten mit erhöhter Inflammation zu Baseline (ausgedrückt durch höhere sCD163-Spiegel im Plasma) nach ART-Beginn mit INSTI zu einer deutlicheren Gewichtszunahme neigten. Ursache für die Gewichtszunahme könnte somit auch eine stärkere Reduktion der Inflammation durch eine INSTI-hältige Therapie sein.</p> <h2>Neue Entwicklungen von injizierbaren Therapien</h2> <p>Die lange erwarteten 48-Wochen-Daten der injizierbaren Kombination aus Cabotegravir und lang wirksamem Rilpivirin (CARLA) wurden ebenfalls auf der CROI vorgestellt. In der ATLAS-Studie wurden insgesamt 616 therapienaive Patienten untersucht, immerhin waren darunter auch 33 % Frauen. Die Intervention bestand aus einer Injektion der lang wirksamen Substanzen alle 4 Wochen versus eine konventionelle orale antiretrovirale Therapie (cART). Der Studienendpunkt wurde nach 48 Wochen erreicht, es zeigte sich eine ausgezeichnete Wirksamkeit in beiden Studienarmen (92,5 % <50c/ml mit CARLA und 95,5 % mit cART). Damit konnte die Nichtunterlegenheit der Injektionstherapie demonstriert werden. Die Verträglichkeit war in beiden Armen sehr gut, 21 % der Patienten mit der Injektionstherapie gaben leichtgradige Schmerzen und Schwellungen im Bereich der Injektionsstelle an. Nur wenige (1,7 % ) zeigten schwerere Reaktionen. <br />In der „Open-label“-Studie FLAIR wurden Patienten, die unter einer ART mit Triumeq voll virussupprimiert waren, auf eine Therapie mit CARLA umgestellt, die Vergleichsgruppe wurde auf Triumeq belassen. Nach 48 Wochen zeigten sich exakt gleich hohe Raten von Virussuppression von 93,3 % in beiden Armen. Die Reaktionen an der Einstichstelle waren etwas ausgeprägter als in der ATLAS-Studie. Fast 30 % der Studienteilnehmer hatten durchgehend lokale Reaktionen nach jeder der 4-wöchentlichen Injektionen. Abgesehen davon gab es jedoch eine gute Verträglichkeit und antivirale Effektivität. Bei 3 Patienten im CARLA-Arm mit dem HIV-Subtyp A6 zeigten sich INSTI- und NNRTIResistenzen. Ob dies mit dem insgesamt recht seltenen Subtyp zusammenhängt, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. <br />Als interessante experimentelle Substanz wurde auf der CROI ein neuer Kapsid- Inhibitor vorgestellt, der aufgrund einer sehr niedrigen wirkungsvollen Konzentration und der schlechten Löslichkeit ideal als lang wirksame (injizierbare) Medikation infrage kommt. Nach einer einmaligen Injektion im Rahmen einer Phase-I-Studie mit gesunden Probanden zeigten sich auch noch 24 Stunden nach Exposition relevante Wirkspiegel. Die Substanz wurde gut vertragen und soll weiter klinisch getestet werden.</p></p>