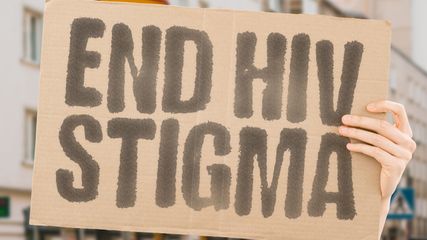©
Getty Images/iStockphoto
Influenza: Stand der Dinge
Jatros
30
Min. Lesezeit
05.06.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Influenza ist weiterhin eine gefährliche und potenziell – auch für Kinder – tödliche Erkrankung. Kinder sind auch die Hauptbetroffenen und -multiplikatoren der Influenza. Neue Therapeutika stehen vor der Tür und auch an verbesserten Impfstoffen wird gearbeitet. Die derzeitige Influenzaimpfung ist nicht ideal, aber die beste verfügbare Prophylaxe.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Kinder sind die von Influenza am schwersten betroffene Altersgruppe und die Hauptverbreiter der Infektion.</li> <li>Influenza-Schnelltests sind wenig aussagekräftig – PCR-basierte „point of care“-Tests hingegen sehr gut.</li> <li>Eine spezifische antivirale Therapie sollte möglichst früh und bei hohem Komplikationsrisiko verabreicht werden.</li> <li>Als spezifische Therapie stehen derzeit Neuraminidasehemmer im Vordergrund, in naher Zukunft werden neue Substanzen wie Baloxavir dazukommen.</li> <li>Es gibt unterschiedliche Influenza- Impfstoffe, wobei im Allgemeinen den tetravalenten Vakzinen heute der Vorzug gegeben wird.</li> </ul> </div> <h2>Epidemiologie, Klinik und Diagnostik</h2> <p>„Grob kann man sagen, dass sich während einer Influenzasaison 5–10 % der Erwachsenen und 10–20 % der Kinder infizieren. Rund 23 % der Mitarbeiter im Gesundheitswesen zeigen eine Serokonversion. Durchschnittlich gibt es 19,1 Todesfälle pro 100 000 Einwohner und Saison, was ungefähr auf 1300 Todesfälle/Jahr in Österreich hinausläuft. Hier besteht eine Bandbreite zwischen ca. 400 und 4000 Todesfällen, je nach Saison und dominantem Subtyp“, erläuterte Priv.-Doz. Ing. Dr. Monika Redlberger-Fritz, Zentrum für Virologie, MedUni Wien. <br />Jede Influenzasaison ist anders. Gab es 2017/18 eine starke Dominanz von Influenza-B-Infektionen, traten 2018/19 fast ausschließlich Influenza-A-Viren auf, davon etwa 70 % A(H1N1)pdm09, der Rest A(H3N2). „Es war mit einer Erkrankungszahl von rund 130 000 auch keine starke Saison – 2017/18 hatten wir 440 000 Erkrankungen, also eine sehr starke Saison“, so die Expertin. <br />In jeder Saison am stärksten betroffen ist die Altersgruppe von 0 bis 14 Jahren, gefolgt von den 15- bis 64-Jährigen, während die Gruppe 65+ am wenigsten Erkrankungen aufweist. „Kinder sind daher auch die Motoren bei der Verbreitung der Influenza, sie stecken sich im Kindergarten oder in der Schule an und verbreiten die Infektion zu Hause, am Spielplatz und so weiter“, sagte Redlberger-Fritz. „Deshalb gibt es während der Weihnachts- sowie Semesterferien immer ein Sistieren der Grippewelle.“ <br />Ein plötzlicher Ausbruch von hohem Fieber in Verbindung mit trockenem, unproduktivem Husten spricht für eine Influenza und weniger für einen grippalen Infekt. Andere Symptome sind Kopf- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen, starkes Krankheitsgefühl, rinnende Nase sowie Durchfall und Erbrechen (dies häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen). <br />„Es ist übrigens nicht wahr, dass Influenza B mildere Krankheitsverläufe macht als Influenza A“, betonte die Virologin. „Das liegt wahrscheinlich nur daran, dass die Diagnostik früher schlechter war und B-Stämme schlechter anzuzüchten sind.“ <br />Es gibt Unterschiede im klinischen Verlauf, nicht nur zwischen Influenza-A- und -B-Viren, sondern auch zwischen A(H3N2) und A(H1N1)pdm09. Dazu kommen Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern. Kinder haben häufiger Rhinitis, Emesis und höheres Fieber, im Labor findet sich eine Erhöhung von CRP, CK und Leukozyten, die Komplikationsrate liegt bei 43 %. Erwachsene haben eher Arthralgien und Cephalea, eine Leukopenie und eine Komplikationsrate von 33 %. <br />„Tragische Beispiele aus der Saison 2018/19 zeigen, dass Influenza auch bei Kindern zu Todesfällen führen kann“, mahnte Redlberger-Fritz. <br />Was die Diagnostik angeht, so ist in der akuten Krankheitsphase (1. Woche) der direkte Virusnachweis mittels PCR zu bevorzugen. In der zweiten Woche muss ein indirekter Nachweis, beispielsweise über einen Hämagglutinations-Hemmtest (HHT) erfolgen, da zu diesem Zeitpunkt die Virämie bereits vorbei ist. „Influenza-Schnelltests sollte man vermeiden, da bei klinischem Verdacht ein negativer Schnelltest eine Influenzainfektion nicht ausschließen kann. Die PCR-basierten „Point of care“-Tests dagegen sind ausgezeichnet“, so die Expertin abschließend.</p> <h2>Therapieoptionen</h2> <p>„Bei der Therapie der Influenza muss zwischen supportiver und spezifisch antiviraler Therapie unterschieden werden“, erklärte Univ.-Prof. Dr. Robert Krause, Sektion für Infektiologie und Tropenmedizin, Universitätsklinik für Innere Medizin, MedUni Graz. Die supportive Therapie umfasst Antibiotika (bei bakterieller Sekundärinfektion), antifungale Therapie (bei sekundärer Aspergillose), extrakorporale Oxygenierung, antientzündliche Maßnahmen (z. B. Kortikoide) und immunsupportive Therapie (z. B. Immunglobuline). <br />Für die spezifische Therapie stehen seit einiger Zeit Neuraminidasehemmer zur Verfügung, die über eine Hemmung der Freisetzung von Viruspartikeln aus der befallenen Zelle wirken. Hierzulande gibt es Oseltamivir (p. o.), Zanamivir (inhalativ und evtl. in Zukunft i. v.) und Peramivir (i. v.). <br />Eine neue Substanzgruppe sind Polymeraseinhibitoren wie Baloxavir-Marboxil, das oral verabreicht werden kann. Diese Medikamente hemmen selektiv die Endonuklease der Influenzavirus-Polymerase. Allerdings hat Baloxavir in der EU noch keine Zulassung, wohl aber in Japan und den USA. <br />Adamantane wie Amantadin und Rimantadin sind wegen der hohen Resistenzraten von Influenza-A-Viren nicht zu empfehlen. <br />Wenn eine antivirale Therapie indiziert ist, sollte sie bei gesicherter oder vermuteter Influenza so früh wie möglich verabreicht werden, auch bei geimpften Patienten. Dies gilt einerseits für Patienten mit einem hohen Komplikationsrisiko, andererseits unter Umständen auch für Patienten mit geringerem Komplikationsrisiko, wenn der Symptombeginn vor weniger als 48 Stunden war. Risikofaktoren für einen schweren Verlauf sind in Tabelle 1 angeführt. <br />Prinzipiell sollten alle Patienten, die wegen einer Influenza im Krankenhaus aufgenommen wurden, spezifisch antiviral behandelt werden, wobei die Therapie in den ersten 48 Stunden nach Symptombeginn am besten wirkt.<br /> Ambulant gibt man Oseltamivir und Zanamivir fünf Tage lang, Peramivir (bei unkomplizierter Influenza) als Einzeldosis. Stationär beträgt die Therapiedauer prinzipiell auch fünf Tage, je nach Klinik und Grunderkrankung kann aber auch länger behandelt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Infekt_1902_Weblinks_s16_tab1.jpg" alt="" width="550" height="399" /></p> <h2>Grippeimpfung</h2> <p>„Durch Antigendrift, also kleine Veränderungen des Influenzavirus durch zufällige Mutationen, entstehen immer wieder neue oder leicht veränderte Influenzaviren, was auch eine jährliche Anpassung der Impfstoffe gegen Grippe erforderlich macht“, sagte Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, Universitätsklinik für Innere Medizin II, MedUni Innsbruck.<br /> Es stehen unterschiedliche Influenza-Impfstoffe zur Verfügung: ein tetravalenter, nasaler Lebendimpfstoff, tetravalente und trivalente (zum Teil adjuvierte) Totimpfstoffe. Tetravalente Impfstoffe enthalten im Gegensatz zu trivalenten Vakzinen beide Linien des Influenza-B-Virus. <br />Grundsätzlich gilt, dass laut Österreichischem Impfplan Kinder bis zum vollendeten 8. oder (bei tetravalentem Totimpfstoff) 9. Lebensjahr bei Erstimpfung oder wenn bisher erst eine Impfung verabreicht wurde (abweichend von der Fachinformation) zweimal im Abstand von mindestens vier Wochen geimpft werden sollen. <br />Bevorzugte Impfstoffe sind: bei Kindern vom vollendeten 6. Lebensmonat bis zum vollendeten 2. Lebensjahr: tetravalenter Totimpfstoff, vom vollendeten 2. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: tetravalenter Lebendimpfstoff (der in Österreich nur für diese Altersgruppe zugelassen ist), vom 18. bis zum 65. Lebensjahr: tetravalenter Totimpfstoff. Ab dem 65. Lebensjahr ist es sinnvoll, den adjuvierten trivalenten Totimpfstoff zu verwenden. <br />Falls eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des B-Virus der Yamagata-Linie besteht, kann ergänzend oder stattdessen der tetravalente Totimpfstoff verwendet werden. <br />„An verbesserten und breiter wirksamen Grippeimpfstoffen wird gearbeitet. Die aktuellen Influenza-Impfstoffe sind bei Weitem nicht optimal, aber sie sind die beste Prophylaxe, die wir momentan haben“, betonte Weiss abschließend.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: „Influenza“, Symposium 7 des 13. ÖIK Saalfelden, 29. März 2019
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei den Vortragenden</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Diskriminierung von Menschen mit HIV in Deutschland und Österreich
Leider müssen Menschen, die mit HIV leben, auch im Jahr 2025 noch mit Schlechterbehandlung und Ablehnung leben – überwiegend in Hinblick auf Leistungen im Gesundheitsbereich. Die ...
Update EACS-Guidelines
Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal der KongressHIV Drug Therapy Glasgow, kurz HIVGlasgow, statt. Eines der Highlights des Kongresses war die Vorstellung ...
Best of CROI 2025
Im März 2025 fand in San Francisco die 32. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) statt. Wie gewohnt nahmen zahlreiche Expert:innen teil, um diverse ...